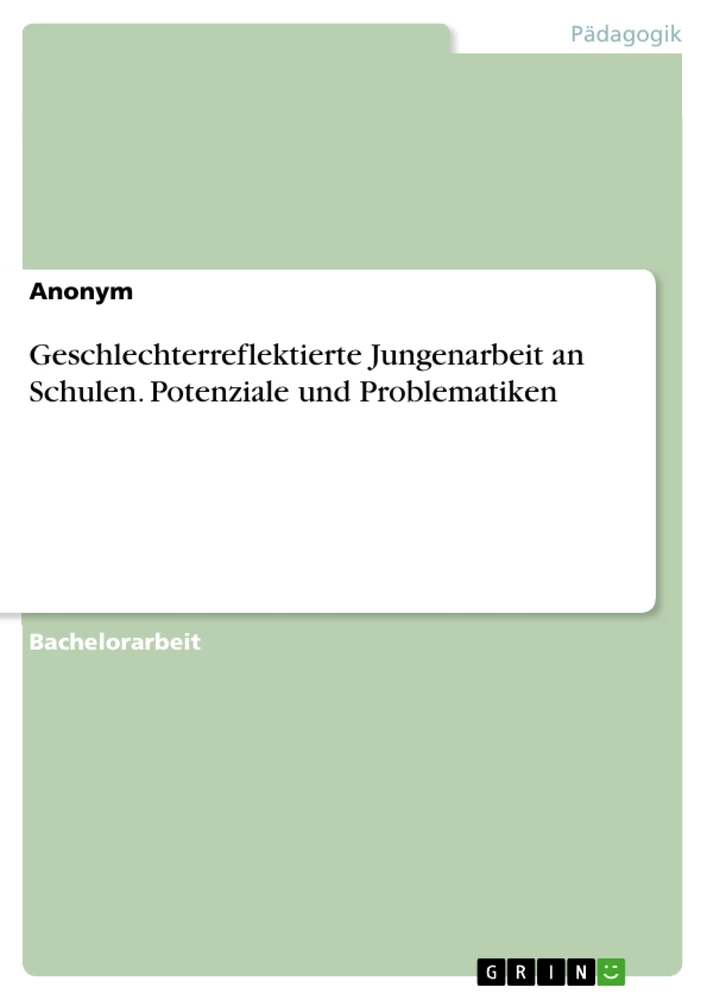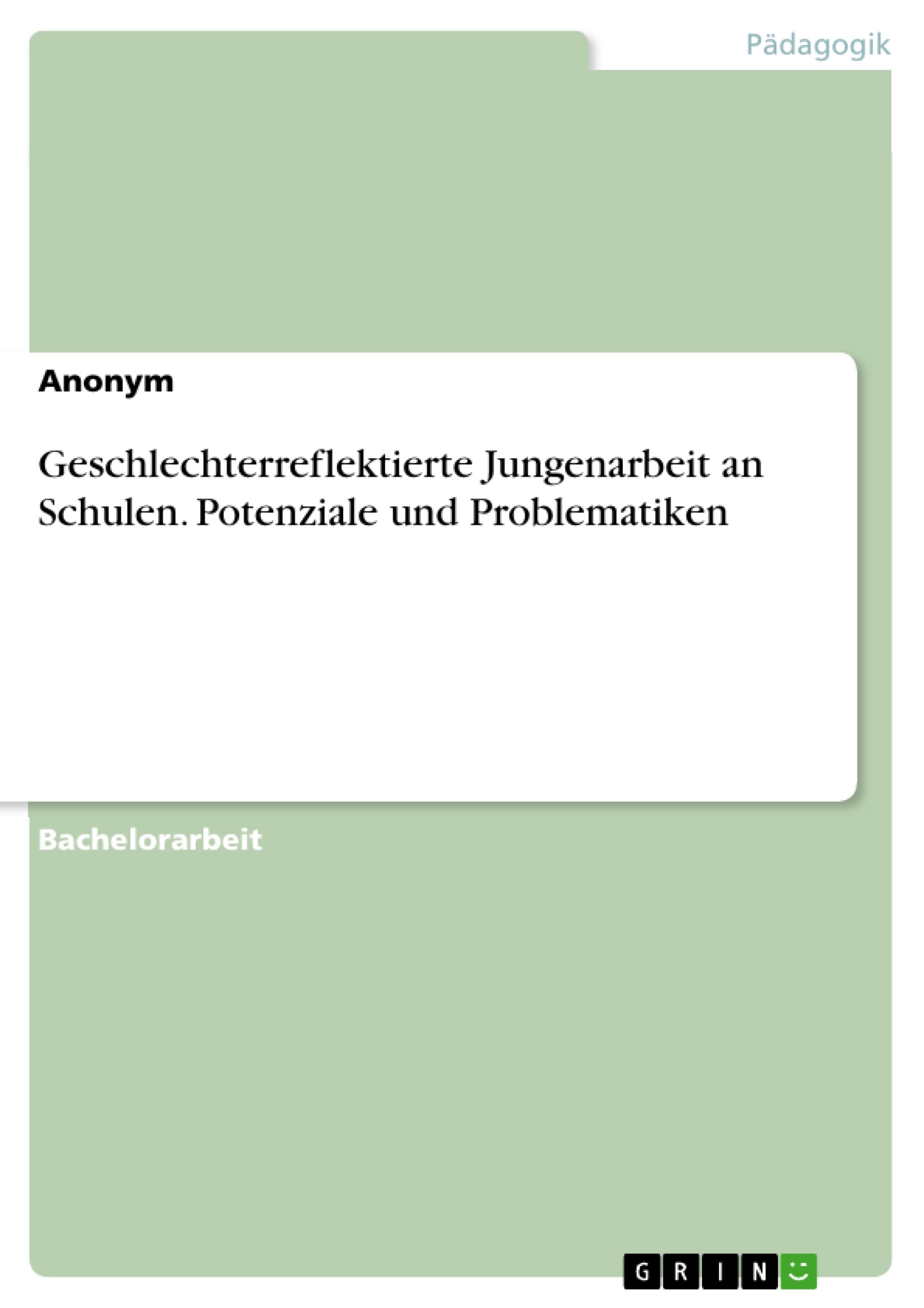Im Rahmen dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit geschlechterreflektierte Jungenarbeit in der Institution Schule umsetzbar ist und welche Potenziale und Problematiken mit jungenspezifischer Arbeit einhergehen.
Zu Beginn werden die Sozialisationsbedingungen und Herausforderungen von Jungen in Deutschland beschrieben, um die Relevanz von jungenpädagogischem Handlungsbedarf zu zeigen. Es wird unter anderem auf die Lebenswelt und Männlichkeitsanforderungen an Jungen sowie Individualisierungsprozesse und deren Einfluss auf Jungen eingegangen.
Danach wird das Verhalten von Jungen im System Schule betrachtet, um den Bedarf für geschlechterreflektierte Jungenarbeit an Schulen herauszustellen. Zur allgemeinen Begriffsbestimmung von geschlechterreflektierter Jungenarbeit werden die theoretischen Überlegungen von Reinhard Winter und Kurt Möller herangezogen. Im Anschluss daran werden Zielbestimmungen und Kernsätze von Jungenarbeit vorgestellt, und es werden verschiedene Möglichkeiten für die Umsetzung in der Praxis des Schulalltags angeführt. Im letzten Kapitel wird behandelt, welche Schwierigkeiten sich bei jungenspezifischen Angeboten ergeben und welche Grenzen es gibt. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit.
Bis etwa zum Jahre 2000 galt die Aufmerksamkeit geschlechtsbezogener Theorie und Praxis vor allem den Mädchen. Immer häufiger werden aber auch Jungen in den Fokus genommen und finden Beachtung in Pädagogik und Bildungspolitik. Es wird anerkannt, dass auch Jungen spezifisch gefördert werden müssen. Die Debatte um Jungenpädagogik ist allerdings nicht neu. Bereits in den 1980er Jahren galt die Orientierung an traditionellen hegemonialen Mustern als problematisch, aufgrund von sich wandelnden gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Verstärkt entwickelten ausgebildete Jungenarbeiter, engagierte Lehrer oder Sozialpädagogen pädagogische Formate, „die explizit an Jungen als Jungen gerichtet sind“. Mittlerweile gilt geschlechterbewusste Jungenarbeit als sinnvoll und ist regulärer Teil von pädagogischen Institutionen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Männliche Sozialisation
- 1.1. Frauendominierte Lebenswelten
- 1.2. Sozialisationsbedingungen und deren Bewältigungsfallen
- 1.3. Homosoziale Peergroups
- 1.4. Männlichkeitsanforderungen
- 1.5. Individualisierung und Männlichkeit
- 1.6. Jungen in der Schule
- 2. Geschlechterreflektierte Jungenarbeit
- 2.1. Entstehungsgeschichte von Jungenarbeit
- 2.2. Definition von Jungenarbeit
- 2.3. Inhalte und Themen
- 2.4. Zielbestimmungen
- 2.5. Kernsätze von Jungenarbeit
- 2.5.1. Sichtweise
- 2.5.2. Homosoziale Gruppenarbeit
- 2.5.3. Männliche Leitung
- 2.5.4. Prinzip der Freiwilligkeit
- 2.5.5. Handlungs- und Erlebnisorientierung
- 2.5.6. Beziehungsarbeit
- 2.6. Voraussetzungen für erfolgreiche Jungenarbeit
- 2.6.1. Reflektierte PädagogInnen
- 2.6.2. Haltung
- 2.6.3. Methodik und Didaktik
- 3. Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an Schulen
- 3.1. Relevanz von geschlechterreflektierter Arbeit an Schulen
- 3.2. Praktische Umsetzung an der Schule
- 3.2.1. Getrennter Unterricht
- 3.2.2. Blockseminare
- 3.2.3. Jungenkonferenzen
- 3.2.4. Jungenarbeitsgemeinschaften
- 3.2.5. Einbeziehung von Vätern in der Schule
- 3.2.6. Schnupperpraktikum
- 4. Schwierigkeiten der Jungenarbeit
- 4.1. Vorannahmen über Jungen
- 4.2. Heteronormierungen
- 4.3. Grenzen bei der Umsetzung
- 5. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit von geschlechterreflektierter Jungenarbeit in der Institution Schule. Sie analysiert die Potenziale und Problematiken, die mit jungenspezifischer Arbeit einhergehen.
- Die Sozialisationsbedingungen und Herausforderungen von Jungen in Deutschland
- Die Lebenswelt und Männlichkeitsanforderungen an Jungen
- Die Relevanz von geschlechterreflektierter Jungenarbeit an Schulen
- Die verschiedenen Ansätze und Methoden der Jungenarbeit
- Die Schwierigkeiten und Grenzen bei der Umsetzung von Jungenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Sozialisationsbedingungen und -schwierigkeiten von Jungen in Deutschland, fokussiert auf die Bereiche der frauendominierten Lebenswelt von Jungen, die Sozialisationsbedingungen und Bewältigungsfallen in der Kindheit und Jugendphase sowie die Bedeutung der männlichen Peergroup und gängige Männlichkeitsanforderungen. Das zweite Kapitel widmet sich der geschlechterreflektierten Jungenarbeit. Es behandelt die Entstehungsgeschichte, die Definition, die Inhalte und Themen, die Zielbestimmungen und die Kernsätze dieser Arbeit. Es werden auch Voraussetzungen für erfolgreiche Jungenarbeit beleuchtet, wie reflektierte PädagogInnen, Haltung und Methodik und Didaktik. Das dritte Kapitel behandelt die geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an Schulen. Es untersucht die Relevanz dieser Arbeit und zeigt praktische Umsetzungsformen an der Schule auf, wie getrennter Unterricht, Blockseminare, Jungenkonferenzen, Jungenarbeitsgemeinschaften, die Einbeziehung von Vätern in der Schule und Schnupperpraktika. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Schwierigkeiten der Jungenarbeit und thematisiert Vorannahmen über Jungen, Heteronormierungen und Grenzen bei der Umsetzung. Das fünfte Kapitel bietet eine abschließende Betrachtung der Thematik.
Schlüsselwörter
Geschlechterreflektierte Jungenarbeit, Männliche Sozialisation, Lebenswelt von Jungen, Männlichkeitsanforderungen, Jungenarbeit, Schule, Pädagogische Praxis, Potenziale und Problematiken.
- 1. Männliche Sozialisation
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Geschlechterreflektierte Jungenarbeit an Schulen. Potenziale und Problematiken, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154350