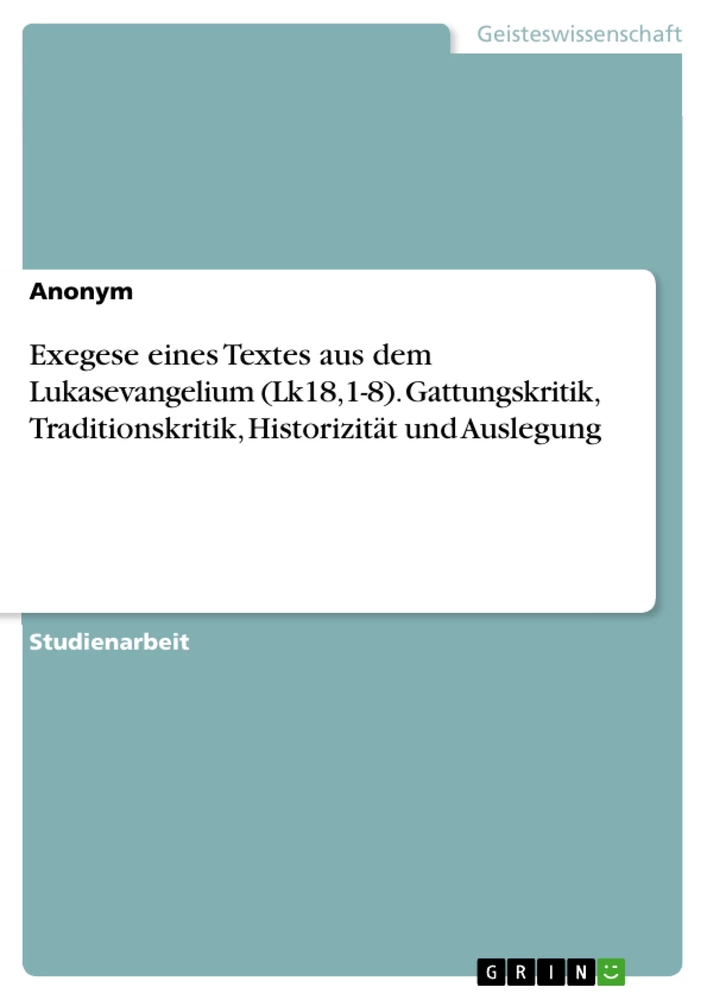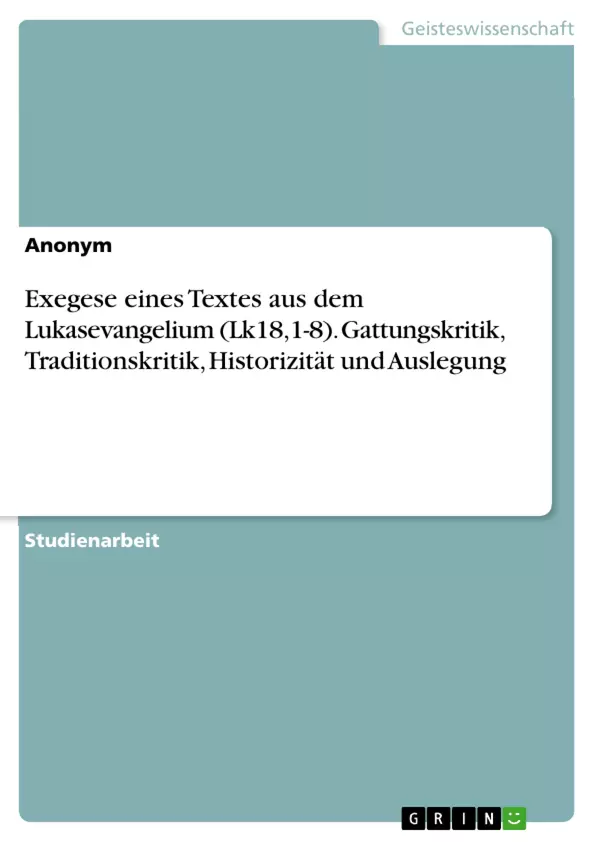Diese Hausarbeit stellt die Exegese des Textes 18, 1-8 aus dem Lukasevangelium. Der Text Lk18, 1-8 lässt sich in Rahmenhandlung und Gleichniserzählung gliedern, was insgesamt zu drei großen Textabschnitten führt. Die Einleitung beläuft sich lediglich auf den ersten Vers und bildet den Anfangsrahmen für das darauffolgende Gleichnis. Die Situation beginnt damit, dass Jesus seine Anhänger zum unermüdlichen Beten bewegen möchte. Dies will er durch ein Gleichnis bewirken, welches den zweiten Abschnitt bildet und sich von Vers zwei bis fünf erstreckt. Es handelt von einer Witwe, die nach mehreren Versuchen, dank ihrem Durchhaltevermögen ihr Recht bei einem Richter einfordert. Dieser geht darauf jedoch nur ein, weil er befürchtet sie schlüge im sonst ins Gesicht. Die Handlung spielt sich in einer unbestimmten Stadt ab. Der Richter wird so beschrieben, dass er weder Gott fürchte, noch auf die Menschen achte. Der letzte Textteil beinhaltet Vers sechs bis acht, bei dem Jesus das Wort an seine Zuhörer richtet und sie fragt, ob Gott denen, die ohne Unterlass zu ihm beten helfen oder zögern wird. In Lk 18, 8 beantwortet er die Frage selbst damit, dass Gott ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen wird und beendet den Text mit der Frage, ob der kommende Menschensohn noch Glauben vorfinden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Literarische Analyse des Textes.
- Form- und Gattungskritik.
- Gleichnis
- Aussageabsicht..
- Traditionskritik
- Das Beten
- Die Witwe
- Der Richter..
- Der Menschensohn
- Der historische Ort.
- Die Rolle der Frau in der Antike
- Die Gemeinde um Lukas.........
- Auslegung.
- Ergebnis......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text aus dem Lukasevangelium 18,1-8 analysiert die Bedeutung des Gebets und beleuchtet die Rolle des Menschensohns in der Geschichte. Der Text will die Leser dazu anregen, die Bedeutung des Gebets zu erkennen und die Notwendigkeit, unermüdlich zu beten, zu verstehen.
- Das unermüdliche Beten als Weg zum Erfolg
- Die Bedeutung der Rolle des Menschensohns in der Geschichte
- Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen
- Die Rolle der Frau in der antiken Gesellschaft
- Die Bedeutung der Gemeinde um Lukas
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Gleichnisses von der Witwe und dem Richter beschreibt. Jesus ermutigt seine Anhänger zum unermüdlichen Beten und veranschaulicht dies mit dem Gleichnis. Die Witwe, die unermüdlich um ihr Recht kämpft, repräsentiert den Menschen, der durch seine Beharrlichkeit zum Erfolg gelangt. Der Richter symbolisiert die menschliche Ungerechtigkeit, die jedoch durch Gottes unerschütterliche Gerechtigkeit übertrumpft wird. Die Schlussfolgerung betont die Bedeutung des unaufhörlichen Gebets und die Gewissheit, dass Gott denen hilft, die zu ihm beten. Die Frage nach dem Glauben des Menschensohns beim Kommen lässt den Text mit einem offenen Ende enden.
Schlüsselwörter
Die Kernthemen des Textes beinhalten das unermüdliche Beten, das Kommen des Menschensohns, die Rolle der Frau in der Antike, die Geschichte der Gemeinde um Lukas und die Auseinandersetzung mit dem Thema Gleichnis.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Exegese eines Textes aus dem Lukasevangelium (Lk18,1-8). Gattungskritik, Traditionskritik, Historizität und Auslegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154566