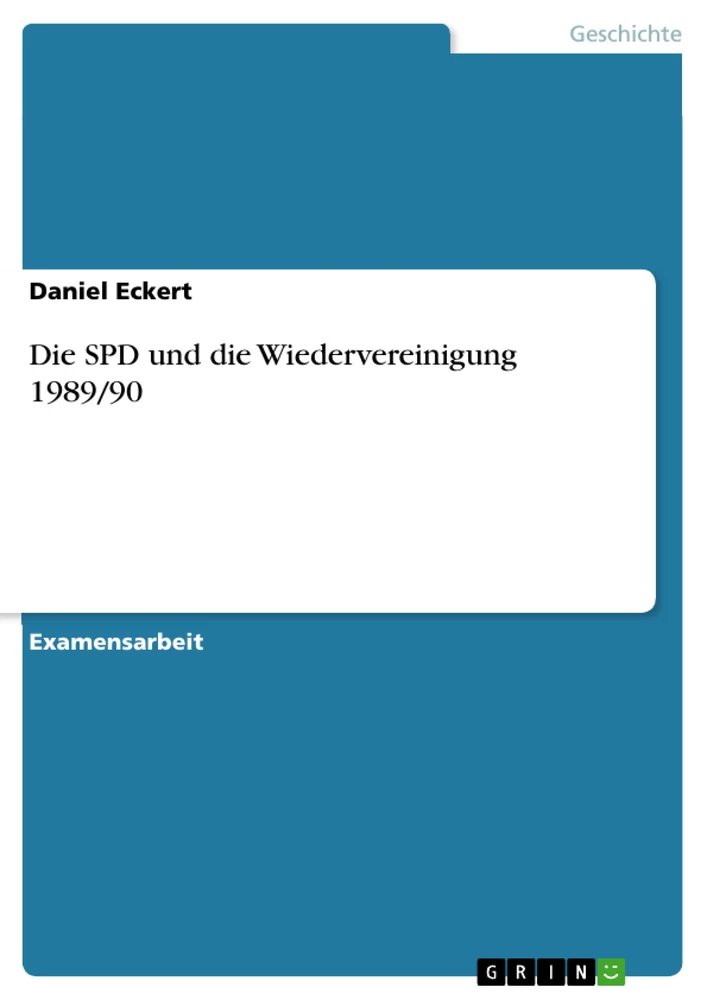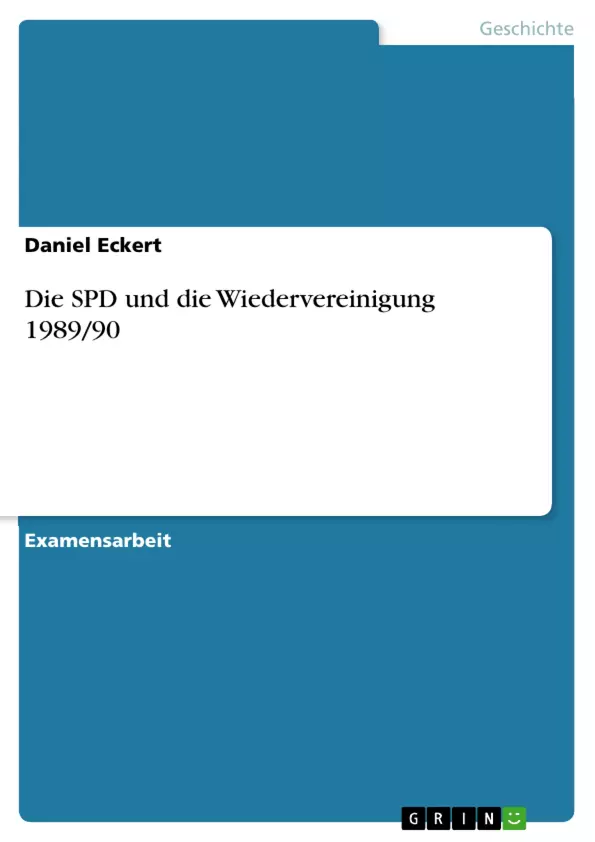Ausgehend von einem drastischen Politikwechsel (Glasnost und Perestroika) in der UdSSR durch Michael Gorbatschow kam es auch in den osteuropäischen Ländern zu revolutionären Umbrüchen. Der Reihe nach lösten sich Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei, Bulgarien und Rumänien von der Sowjetunion. Auch wenn sich die Regierung der DDR dieser Welle zunächst widersetzte und energisch gegen das drohende Ende des Sozialismus wehrte, so war doch schnell klar, dass dies nicht auf Dauer möglich sein würde: Täglich wuchsen die öffentlichen Demonstrationen, ebenso wie die im Sommer 1989 einsetzende Fluchtbewegung, die im Herbst ihren Höhepunkt fand und letztendlich zum Mauerfall führte. Zunehmend zeichnete sich ab, dass SED und Politbüro diesem geballten Volkeswillen keine adäquaten Mittel entgegenzusetzen hatten, und die sowjetische Militärmacht verweigerte ihre Unterstützung.
Zwangsläufig fielen erst Honecker, dann die Mauer, und schließlich die SED. Diese unglaublich rasante Wendung traf alle westdeutschen Politiker völlig unerwartet. Darüber hinaus änderte sich nahezu täglich die Lage in der DDR. Die bundesdeutsche Regierung und Opposition differierten jedoch entscheidend in ihren Reaktionen auf das Geschehen dort. Während die Union bald die unaufhaltsam in eine Richtung laufende Dynamik des Prozesses erkannte, und der Bundeskanzler sein Angebot einer Währungs- und Wirtschaftsunion unterbreitete, tat sich die SPD wesentlich schwerer, auf die Ereignisse zu reagieren. Dies lag einerseits an der eigenen, bis dato betriebenen Deutschlandpolitik, die Frieden und Sicherheit über alles stellte, also auch über Freiheit, andererseits auch an engen Kontakten zur SED und einer daraus resultierenden Vernachlässigung der oppositionellen Kräfte. Hinzu kamen innerparteiliche Differenzen zwischen den Gruppierungen und Parteipersönlichkeiten – hier spielt nicht zuletzt das Alter und die daraus folgenden unterschiedlichen Lebensrealitäten der einzelnen Akteure eine Rolle.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Die Deutschlandpolitik der SPD vor dem Mauerfall
- 2.1.1 Sozialdemokratische Deutschlandpolitik von 1982 bis 1989
- 2.1.2 Krisenzeichen in der DDR in der ersten Jahreshälfte 1989
- 2.1.3 Ausreisewelle und Reformstillstand
- 2.1.4 Die Gründung formeller Gruppen
- 2.2 Vom Mauerfall bis zur Volkskammerwahl
- 2.2.1 Bekenntnis zur Einheit?
- 2.2.1.1 Die SPD und die deutsche Frage
- 2.2.1.2 Kohls Zehn-Punkte-Plan und die Haltung der SPD
- 2.2.1.3 Der Berliner Parteitag
- 2.2.2 Positionsfindung zum Einigungsprozess
- 2.2.2.1 Die Übersiedlerfrage
- 2.2.2.2 Die Wirtschafts- und Währungsunion
- 2.2.2.3 Die rechtliche Basis der Wiedervereinigung
- 2.2.2.4 Der Wahlkampf zur Volkskammerwahl
- 2.2.2.5 Nach der Wahlniederlage
- 2.3 Die Modalitäten der Wiedervereinigung
- 2.3.1 Außenpolitische Abstimmung
- 2.3.1.1 Die Grenzfrage
- 2.3.1.2 Die Bündnisfrage
- 2.3.2 Kontroversen beim ersten Staatsvertrag
- 2.3.2.1 Der Umtauschkurs
- 2.3.2.2 Kosten und Finanzierung der Wiedervereinigung
- 2.3.2.3 Die Umweltunion
- 2.3.3 Kontroversen beim Wahlvertrag
- 2.3.3.1 Wahltermin
- 2.3.3.2 Wahlrechtsmodus
- 2.3.4 Kontroversen beim Einigungsvertrag
- 2.3.4.1 Eine neue Verfassung?
- 2.3.4.2 Die Eigentumsfrage
- 2.3.4.3 Die Abtreibungsfrage
- 2.3.4.4 Die Kosten- und Finanzierungsfrage
- 2.3.1 Außenpolitische Abstimmung
- 3. Zusammenfassung
- Abkürzungsverzeichnis
- Quellen und Literatur
- A. Quellen
- B. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zulassungsarbeit analysiert die Rolle der SPD im deutschen Einigungsprozess von 1989/90. Sie untersucht die Deutschlandpolitik der SPD vor dem Mauerfall, die Positionierung der Partei während der Vereinigung und die Kontroversen innerhalb der SPD über die Modalitäten der Wiedervereinigung. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die die SPD im Umgang mit der deutschen Frage und dem Einigungsprozess zu bewältigen hatte.
- Die Deutschlandpolitik der SPD vor dem Mauerfall
- Die Positionierung der SPD während des Einigungsprozesses
- Die Kontroversen innerhalb der SPD über die Modalitäten der Wiedervereinigung
- Die Herausforderungen der SPD im Umgang mit der deutschen Frage
- Die Rolle der SPD im Kontext der europäischen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Deutschlandpolitik der SPD vor dem Mauerfall. Es analysiert die sozialdemokratische Deutschlandpolitik von 1982 bis 1989 und zeigt die Herausforderungen auf, die die SPD in dieser Zeit zu bewältigen hatte. Das Kapitel untersucht die Krisenzeichen in der DDR in der ersten Jahreshälfte 1989, die Ausreisewelle und den Reformstillstand sowie die Gründung formeller Gruppen innerhalb der SPD, die sich mit der deutschen Frage auseinandersetzten.
Das zweite Kapitel behandelt die Zeit vom Mauerfall bis zur Volkskammerwahl. Es analysiert die Positionierung der SPD zum Thema der deutschen Einheit und die Kontroversen innerhalb der Partei über die Modalitäten der Wiedervereinigung. Das Kapitel beleuchtet die Übersiedlerfrage, die Wirtschafts- und Währungsunion, die rechtliche Basis der Wiedervereinigung sowie den Wahlkampf zur Volkskammerwahl und die Reaktion der SPD auf die Wahlniederlage.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Modalitäten der Wiedervereinigung. Es analysiert die außenpolitische Abstimmung, insbesondere die Grenzfrage und die Bündnisfrage. Das Kapitel untersucht die Kontroversen beim ersten Staatsvertrag, insbesondere den Umtauschkurs, die Kosten und Finanzierung der Wiedervereinigung sowie die Umweltunion. Es beleuchtet auch die Kontroversen beim Wahlvertrag, insbesondere den Wahltermin und den Wahlrechtsmodus. Schließlich analysiert das Kapitel die Kontroversen beim Einigungsvertrag, insbesondere die Frage nach einer neuen Verfassung, die Eigentumsfrage, die Abtreibungsfrage und die Kosten- und Finanzierungsfrage.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die deutsche Frage, die Wiedervereinigung, die SPD, die Deutschlandpolitik, die Modalitäten der Wiedervereinigung, die Kontroversen innerhalb der SPD, die Übersiedlerfrage, die Wirtschafts- und Währungsunion, die rechtliche Basis der Wiedervereinigung, die Grenzfrage, die Bündnisfrage, der Umtauschkurs, die Kosten und Finanzierung der Wiedervereinigung, die Umweltunion, der Wahltermin, der Wahlrechtsmodus, die Eigentumsfrage, die Abtreibungsfrage und die Kosten- und Finanzierungsfrage.
- 2.2.1 Bekenntnis zur Einheit?
- 2.1 Die Deutschlandpolitik der SPD vor dem Mauerfall
- Quote paper
- Daniel Eckert (Author), 2005, Die SPD und die Wiedervereinigung 1989/90, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115468