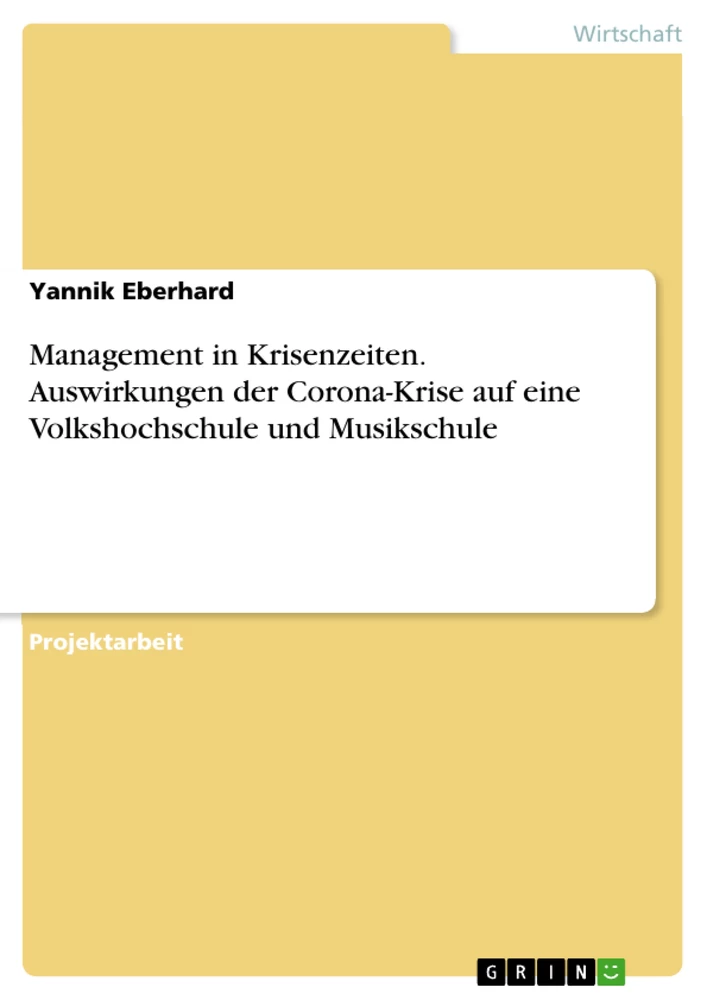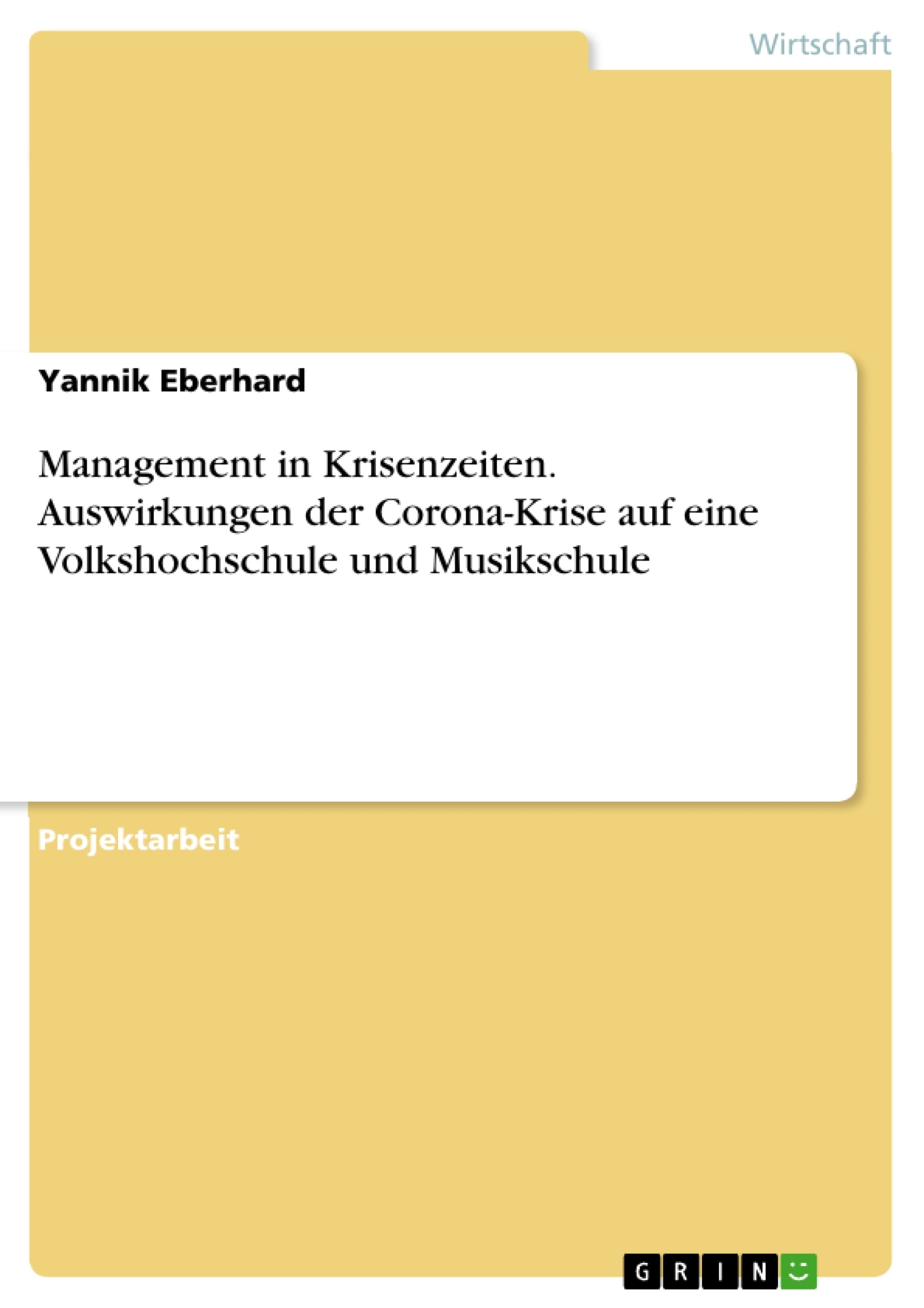Das Ziel dieser Arbeit ist es, systematisch zu untersuchen, wie sich die Unterbrechung des Kursbetriebs aufgrund der COVID-19-Pandemie und die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Weiterbildungsbranche auswirken. Die Phasen der Auseinandersetzung mit der Krise werden auf die Volkshochschule Bingen bezogen und es werden die daraus resultierenden Erkenntnisse aufgezeigt. Der Fokus liegt dabei auf der Arbeit der vhs Bingen sowie der internen und externen Kommunikation. Neben den Herausforderungen werden auch die Chancen der Krise aufgezeigt.
Es ergeben sich die folgenden Forschungsfragen: Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Gestaltung des Kursangebots? Wird sich die Pandemie nachhaltig auf die Arbeit und die Strategie der Einrichtung auswirken oder gibt es ein Zurück zum Status ante Corona?
Seit mehr als einem Jahr sind die gesamte Gesellschaft und damit auch die Volkshochschule und Musikschule Bingen mit einer globalen Pandemie konfrontiert. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus greifen massiv in das gesellschaftliche Leben, die Privatsphäre der Menschen und letztlich auch die Arbeit der vhs Bingen ein. Für das Managen der Auswirkungen einer weltweiten Krise mit verheerenden Folgen gibt es noch keinen Ablaufplan.
Mit dem Verbot aller Präsenzveranstaltungen im Kulturbereich verlieren von einem Tag auf den anderen nahezu alle Kulturschaffenden ihre Arbeit und ihr Einkommen, Millionen Arbeitnehmer finden sich plötzlich im Home-Office wieder, Schulen und auch die Weiterbildung müssen plötzlich auf Online-Lehre umstellen. Vor allem die Digitalisierung und die schnelle Umstrukturierung des Kursangebots auf Online-Lernen verursachen erhebliche Mehrarbeit. Im Gegensatz zu Schulen und Hochschulen muss die vhs Bingen ihre Teilnehmer aktiv zum Online-Unterricht motivieren, was besonders zu Beginn der Pandemie, als viele Menschen noch von einem zeitlich kurzen Lockdown ausgehen, eine große Herausforderung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Arbeit
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2. Management in Krisenzeiten
- 2.1 Krisen
- 2.2 Krisenphasen
- 2.3 Krisenmanagement
- 2.4 Die Corona Krise
- 2.5.1 Katastrophe - Phase der Verwirrung
- 2.5.2 Schnelle Lösungen – Krisen-Plateau
- 2.5.3 Neustart – Krisenbewältigung
- 2.5.4 Die neue Normalität – Nachkrisen-Zeit
- 2.5.5 Repulsives Krisenmanagement in der Corona-Pandemie
- 3. Die vhs Bingen in Zeiten der Krise
- 3.1 Die Volkshochschule und Musikschule Bingen e.V.
- 3.2 Chronologie der Pandemie an der vhs Bingen
- 3.2.1 Phase I – Katastrophe
- 3.2.2 Phase II – Schnelle Lösungen
- 3.2.3 Phase III - Neustart
- 3.2.4 Phase IV - Die neue Normalität
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Volkshochschule und Musikschule Bingen e.V. Sie analysiert die Herausforderungen, die das Management in Krisenzeiten bewältigen musste, und untersucht die Anpassungsstrategien, die implementiert wurden. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung der einzelnen Krisenphasen und deren Auswirkungen auf den Betrieb der Einrichtung.
- Management in Krisenzeiten
- Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf Bildungseinrichtungen
- Anpassungsstrategien und Krisenmanagement
- Digitalisierung im Bildungsbereich
- Zukünftige Herausforderungen für die Volkshochschule und Musikschule Bingen e.V.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung der Arbeit ein. Die Zielsetzung und der Gang der Untersuchung werden erläutert. Das zweite Kapitel beleuchtet das Thema "Management in Krisenzeiten" und beschreibt Krisen, Krisenphasen und das Krisenmanagement. Der Fokus liegt dabei auf der Corona-Krise und deren spezifischen Herausforderungen für Bildungseinrichtungen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der vhs Bingen und deren Erfahrungen mit der Corona-Krise. Die einzelnen Phasen der Pandemie und die entsprechenden Maßnahmen werden detailliert dargestellt. Das vierte Kapitel bietet ein Fazit und einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen für die vhs Bingen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Krisenmanagement, Corona-Krise, Bildungseinrichtungen, Volkshochschule, Musikschule, Digitalisierung, Anpassungsstrategien, Online-Lernen, hybride Formate und zukünftige Herausforderungen.
- Quote paper
- Yannik Eberhard (Author), 2021, Management in Krisenzeiten. Auswirkungen der Corona-Krise auf eine Volkshochschule und Musikschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154680