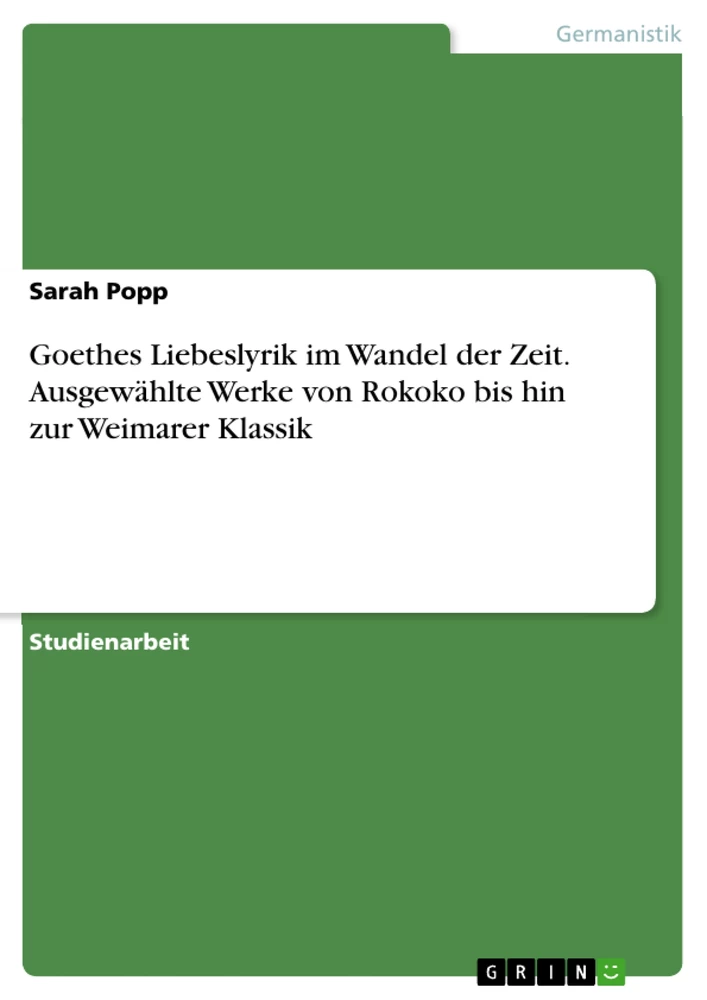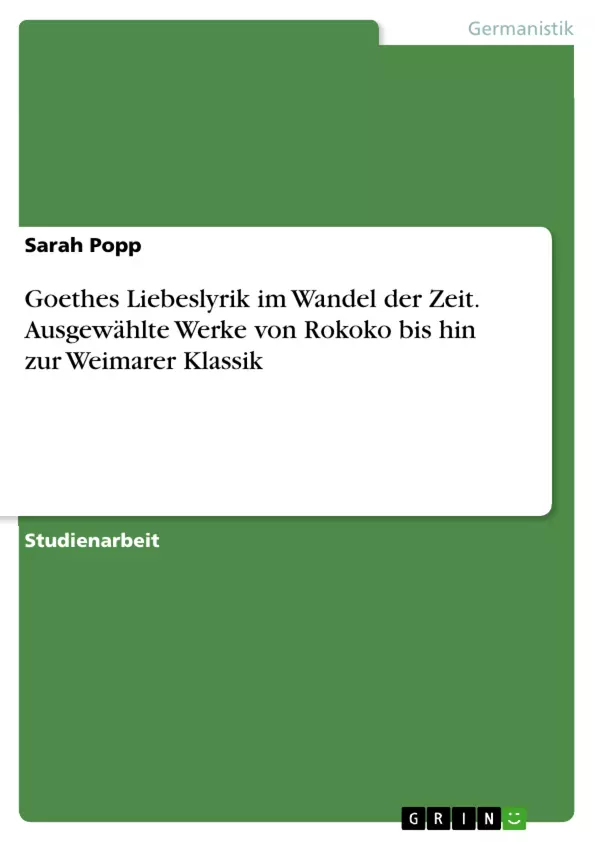Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Wandel des Liebesmotivs in Goethes Lyrik, an Hand von drei ausgewählten Beispielen. Hierbei werden die Bezüge zu Goethes privatem Liebesglück und die häufige Gleichsetzung von Autorenleben und lyrischem Ich, kritisch beleuchtet und hinterfragt. Zusätzlich werden die drei literarischen Epochen näher betrachtet, in welchen die Lyrik entstand. So spiegelt sich das Liebessujet in Goethes frühen Rokoko Gedichten noch anders ganz wider, als in seinen römischen Elegien, welche zur Zeit der Weimarer Klassik entstanden sind. Wie hat sich das Liebesmotiv in Goethes Lyrik im Laufe der Zeit entwickelt? Sind diese Veränderungen an biografische Ereignisse in Goethes Leben gebunden oder ausschließlich Folge des Literarischen Zeitgeist? Welche stilistischen Mittel verwendet Goethe, um die Liebessemantik im Gedicht noch hervorzuheben? Sind „Die Römischen Elegien“ tatsächlich ein biografisches Abbild von Goethes Italienerfahrung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Goethes Liebeslyrik - künstlerische Freiheit oder Zeugnis der eigenen Erfahrung?
- Goethe und die Liebe
- Goethe - 1 Dichter, 3 Epochen
- Das Liebessujet in Goethes Lyrik im Wandel der Zeit
- An den Schlaf
- Das Maifest
- Die Römische Elegien
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Liebesmotivs in Goethes Lyrik anhand dreier ausgewählter Werke: „An den Schlaf", „Das Maifest" und „Die Römischen Elegien". Dabei werden die Beziehungen zwischen Goethes privatem Liebesleben und dem lyrischen Ich kritisch beleuchtet und die drei literarischen Epochen, in denen die Gedichte entstanden sind, genauer betrachtet. Ziel ist es, den Wandel des Liebesmotivs in Goethes Lyrik aufzuzeigen und zu analysieren, ob diese Veränderungen an biografische Ereignisse in Goethes Leben gebunden oder Folge des literarischen Zeitgeists sind.
- Die Entwicklung des Liebesmotivs in Goethes Lyrik
- Der Einfluss von Goethes privatem Liebesleben auf seine Lyrik
- Die Bedeutung der drei literarischen Epochen für Goethes Liebeslyrik
- Stilistische Mittel, die Goethe zur Hervorhebung der Liebessemantik in seinen Gedichten verwendet
- Die Frage nach der Biografizität der „Römischen Elegien“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz der Liebeslyrik für die Analyse von Goethes Leben und Werk dar. Es wird erläutert, dass die Liebeslyrik nicht nur die Bewältigung von Gefühlserfahrungen widerspiegelt, sondern auch eine Transformation des Besonderen ins Allgemeine ermöglicht.
Das zweite Kapitel untersucht Goethes Liebeslyrik im Kontext seiner Lebensgeschichte und beleuchtet die komplexen Beziehungen des Dichters zu seinen Frauenbekanntschaften, insbesondere zu Anna Amalia, Charlotte von Stein und Anna Katharina Schönkopf. Es wird dargestellt, wie diese Frauen Goethes Lyrik beeinflusst haben und wie die jeweiligen Gedichte in das biografische Umfeld des Autors eingebettet sind.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse des Liebesmotivs in Goethes Lyrik im Wandel der Zeit. Es werden die drei ausgewählten Gedichte „An den Schlaf", „Das Maifest" und „Die Römischen Elegien" hinsichtlich ihrer Themen, ihrer Entstehungszeit und ihrer Beziehung zu Goethes Lebensgeschichte analysiert. Dabei wird gezeigt, wie sich das Liebesmotiv in Goethes Lyrik von der Rokoko- bis zur Klassik-Epoche entwickelt und wie diese Entwicklung mit Goethes persönlichen Lebenserfahrungen sowie den literarischen Strömungen der Zeit zusammenhängt.
Schlüsselwörter
Goethes Liebeslyrik, Rokoko, Sturm und Drang, Weimarer Klassik, „An den Schlaf", „Das Maifest", „Die Römischen Elegien", Anna Amalia, Charlotte von Stein, Anna Katharina Schönkopf, Friederike Brion, Christiane Vulpius, biografische Ereignisse, literarischer Zeitgeist, Liebessemantik, Stilmittel.
- Citar trabajo
- Sarah Popp (Autor), 2019, Goethes Liebeslyrik im Wandel der Zeit. Ausgewählte Werke von Rokoko bis hin zur Weimarer Klassik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154910