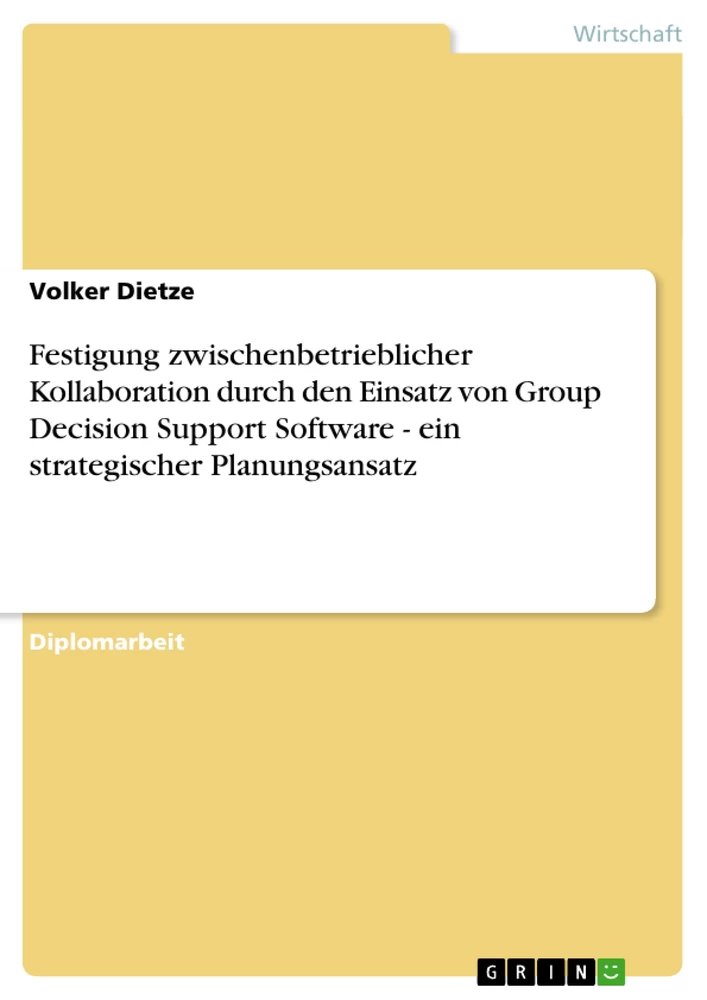Der Fokus der Arbeit liegt darauf, die Probleme von Kooperationen, die ein mögliches Scheitern erklären können, zu analysieren und mögliche Lösungswege
aufzuzeigen. In Situationen, in denen Kooperation für sämtliche Teilnehmer von Nutzen wäre und sich trotzdem nicht einstellt, kann das Scheitern im Nichterkennen von Nutzenpotential oder in Unsicherheiten über das Verhalten der anderen Partner begründet liegen. Für das Erkennen von Nutzenpotentialen spielt neben der Verarbeitung von Informationen auch die Wissensvermittlung zwischen den Beteiligten eine zentrale Rolle. Nach dem Erkennen einer Kooperationschance ist die Interaktion der Partner somit von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund beschäftigt sich diese Arbeit im Kern mit der Koordination zwischen den einzelnen Entscheidungsträgern. [...] Angestrebt wird eine prozessuale Verbesserung des Informationsflusses hinsichtlich eines strukturierteren Planungsprozesses. Hierzu erfolgt die Entwicklung eines informationstechnologischen Systems zur Unterstützung der Planung strategischer
zwischenbetrieblicher Kooperationen, speziell ihrer Sonderform der Kollaboration. Dieses System soll der Kollaboration als Unterstützung der Komplexitätsbewältigung bereitgestellt werden, um somit ein Auffinden besserer Strategien zu gewährleisten. Bessere Strategien führen zu einem höheren Gesamtnutzen und somit zu einer Festigung der Kollaboration gegenüber externen Einflüssen. Zusätzlich soll eine Stabilisierung durch die Implementierung von Gerechtigkeitsnormen für die Nutzenverteilung geboten werden. Die Bewältigung der Zielsetzung erfolgt über die Erarbeitung eines theoretischen
Bezugsrahmens, der eine Ableitung konkreter Hilfestellungen ermöglichen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung der Themenstellung
- Einleitung
- Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- Einführung in den Themenkomplex
- Informationen und ihre Umwelt
- Bedeutung von Informationen
- Probleme als Systeme
- Komplexität von Problemen
- Entscheidungsprobleme und ihre Struktur
- Strukturierung durch Modellierung
- Definitionen von Kooperation und Kollaboration
- Motivation zur Kooperation
- Der Mensch als Nutzenmaximierer
- Kriterien fairer Nutzenzuteilung
- Synergiepotential und seine Erschließung durch Koordination
- Synergieeffekte
- Arten von Synergieeffekten
- Planung des Synergiepotentials
- Koordination in der Kooperation
- Spektrum der Koordination
- Direkte Koordination
- Indirekte Koordination
- Koordinationswahl bei asymmetrischen Informationen
- Koordination durch Verhandlungen
- Kooperationsnutzen und Nutzenverteilung
- Kooperationsbewertung
- Nutzenverteilung und ihre Problematik
- Zeitpunkt der Nutzenverteilung
- Koordination durch Verhandlungen
- Integrative versus distributive Verhandlungen
- Integrative Verhandlungen als Kollaborationsform
- Unterstützung integrativer Verhandlung durch einen Mediator
- Theoretische Instrumente zur Stützung von Verhandlungen
- Zwischenfazit
- Spieltheorie
- Kooperation in der Spieltheorie
- Bestimmung des Gesamtnutzens aus dem individuellen Verhalten im Gefangenendilemma
- Struktur des Gefangenendilemmas
- Zeitaspekt und Strategiewahl
- Ermöglichung von Kooperation durch Vertrauen
- Möglichkeit der Vergeltung defektiven Verhaltens
- Axiomatische Verteilung des bekannten Nutzens in kooperativen Spielen
- Struktur eines Koalitionsspiels
- Der Kern
- Shapley-Wert
- Erkennen und Durchsetzen von Synergien durch Informationsaustausch: Ein Modell
- Formale Struktur und Implikationen
- Erweiterung des Modells durch die Einbeziehung gegenseitigen Lernens
- Beispiel eines möglichen Verhandlungsverlaufs
- Interpretation des Modells
- Zwischenfazit
- Entscheiden in realen Situationen
- Iindividuelles Entscheidungsfeld
- Phasen betrieblicher Entscheidungsprozesse
- Konstruktion des Entscheidungsmodells
- Handlungsalternativen
- Modellierung der Wirkungen und der Präferenzen
- Modellierung der Umwelt
- Lösung des Modells
- Methoden zur Zielerreichung
- Optimierungsverfahren in Abhängigkeit der Problemklasse
- Evolutionäre Algorithmen
- Evaluation der Lösung
- Ausblick
- Individuelles Entscheiden im Verhandlungsprozess
- Kollaborative Verhandlungen als gemeinsame Entscheidung
- Zusammensetzung der Verhandlung aus Einzelentscheidungen
- Ansatzpunkte der Verhandlungsunterstützung
- Zwischenfazit
- Entscheidungsunterstützungssysteme
- Grundform von Decision Support Systems (DSS)
- Definition und Eigenschaften von DSS
- Klassifikation von DSS
- Grundform des Group Decision Support Systems (GDSS)
- Entscheidungen in der Gruppe
- Definition und Eigenschaften von GDSS
- Entwicklungsstufen von GDSS
- Räumliche und zeitliche Verteilung von Entscheidungsprozessen
- Negotiation Support Systems (NSS)
- Definition und Eigenschaften
- Grundsätze der Verhandlung
- Ansatzpunkt zur Unterstützung im Verhandlungsprozess
- Ein NSS und seine Eignung im Zielkontext am Beispiel ICANS
- Verhandlungsunterstützung durch ICANS
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Festigung zwischenbetrieblicher, collaborativer Beziehungen durch den Einsatz von Group Decision Support Systems (GDSS). Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen strategischen Planungsansatz für die Nutzung von GDSS in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zu entwickeln. Dabei werden die Herausforderungen und Chancen der Kooperation zwischen Unternehmen im Kontext von Informationsasymmetrien und komplexen Entscheidungsproblemen untersucht.
- Synergieeffekte und deren Erschließung durch Koordination
- Kooperationsformen und -phasen
- Verhandlungsstrategien und -unterstützung
- Entscheidungsprozesse in der Gruppe
- Einsatz von GDSS zur Unterstützung von Verhandlungen und Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Themenstellung ein und erläutert die Zielsetzung und den Gang der Untersuchung. Es werden die wichtigsten Begriffe und Konzepte definiert, die im weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung von Informationen in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. Es werden die Herausforderungen und Chancen der Kooperation im Kontext von Informationsasymmetrien und komplexen Entscheidungsproblemen beleuchtet. Die Motivation zur Kooperation wird anhand des Modells des Nutzenmaximierers und der Kriterien fairer Nutzenzuteilung erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Synergiepotential und seiner Erschließung durch Koordination. Es werden verschiedene Arten von Synergieeffekten vorgestellt und die Bedeutung der Koordination in der Kooperation hervorgehoben. Die Arbeit analysiert verschiedene Koordinationsformen und deren Eignung in Abhängigkeit von der Situation. Darüber hinaus werden die Herausforderungen der Nutzenverteilung und die Bedeutung von Verhandlungen im Kontext der Kooperation diskutiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Spieltheorie und deren Anwendung auf die Kooperation zwischen Unternehmen. Es werden verschiedene Spielmodelle vorgestellt, die die Herausforderungen der Kooperation im Kontext von Informationsasymmetrien und komplexen Entscheidungsproblemen verdeutlichen. Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten der Vergeltung defektiven Verhaltens und die Bedeutung von Vertrauen in der Kooperation.
Das fünfte Kapitel behandelt das Thema des Entscheidens in realen Situationen. Es werden die Phasen betrieblicher Entscheidungsprozesse und die Konstruktion von Entscheidungsmodellen erläutert. Die Arbeit analysiert verschiedene Methoden zur Zielerreichung und die Bedeutung von Optimierungsverfahren in Abhängigkeit der Problemklasse. Darüber hinaus werden die Herausforderungen des individuellen Entscheidens im Verhandlungsprozess und die Möglichkeiten der Verhandlungsunterstützung diskutiert.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit Entscheidungsunterstützungssystemen (DSS) und deren Einsatz in der Kooperation zwischen Unternehmen. Es werden die Grundformen von DSS und GDSS vorgestellt und deren Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten erläutert. Die Arbeit analysiert die Entwicklungsstufen von GDSS und die Bedeutung von Negotiation Support Systems (NSS) in der Verhandlungsunterstützung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Festigung zwischenbetrieblicher Beziehungen, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, die Nutzung von Group Decision Support Systems (GDSS), die strategische Planung, die Koordination, die Verhandlungsführung, die Spieltheorie, die Entscheidungsprozesse und die Informationsasymmetrie. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Kooperation zwischen Unternehmen im Kontext von komplexen Entscheidungsproblemen und Informationsasymmetrien. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung eines strategischen Planungsansatzes für die Nutzung von GDSS in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Group Decision Support System (GDSS)?
Ein GDSS ist ein interaktives, computerbasiertes System, das Gruppen von Entscheidungsträgern dabei unterstützt, unstrukturierte Probleme gemeinsam zu lösen.
Wie fördert GDSS die zwischenbetriebliche Kollaboration?
Es verbessert den Informationsfluss, hilft bei der Bewältigung von Komplexität und ermöglicht strukturiertere Verhandlungsprozesse zwischen Partnern.
Welche Rolle spielt die Spieltheorie bei Kooperationen?
Sie hilft zu verstehen, warum Kooperationen scheitern (z. B. Gefangenendilemma) und wie durch Vertrauen und Verteilungsregeln (z. B. Shapley-Wert) Synergien gesichert werden können.
Was sind Synergieeffekte in einer Kollaboration?
Synergieeffekte sind Vorteile, die durch die Zusammenarbeit entstehen und über die Summe der Einzelleistungen hinausgehen ("1+1=3").
Was ist ein Negotiation Support System (NSS)?
Ein NSS ist eine spezielle Form des GDSS, das speziell darauf ausgerichtet ist, Parteien in Verhandlungssituationen bei der Findung eines Konsenses zu unterstützen.
- Citation du texte
- Volker Dietze (Auteur), 2003, Festigung zwischenbetrieblicher Kollaboration durch den Einsatz von Group Decision Support Software - ein strategischer Planungsansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115501