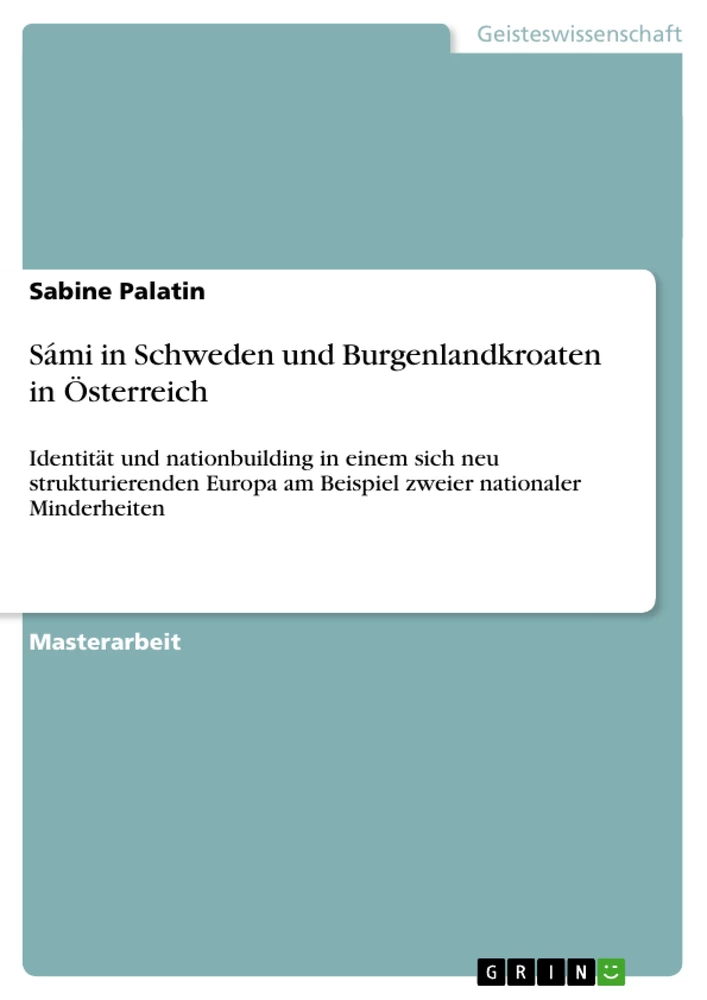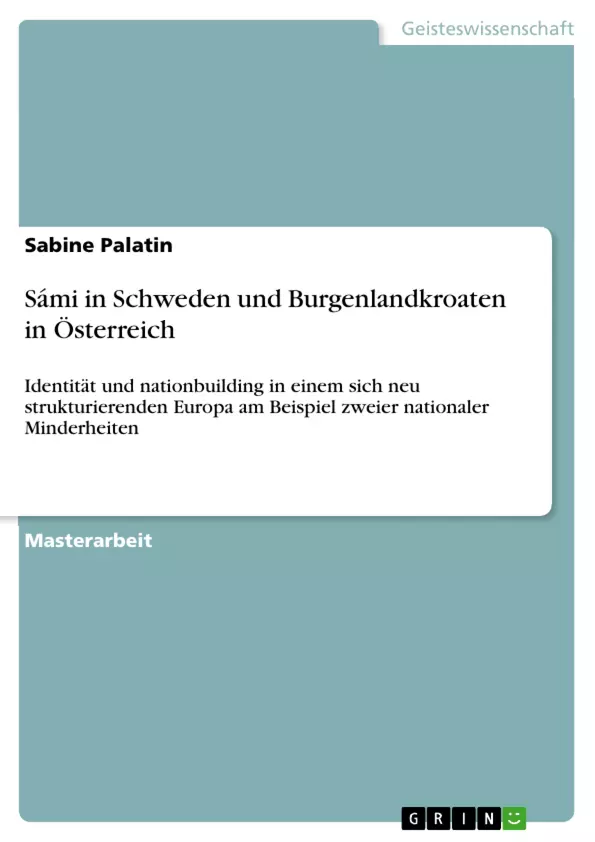Diese Arbeit behandelt verschiedene Identitätsbilder und die Konstruktion einer kollektiven ethnischen oder möglicherweise auch nationalen Identität bei den Sámi in Schweden und den Burgenlandkroaten in Österreich. Mittels Fachliteratur, Zeitungsausschnitten und persönlichen Gesprächen werden dabei vor allem unterschiedliche politische, soziale und kulturelle Entwicklungen gegen Ende des 19. und im Laufe des 20. Jahrhundert untersucht. Zu diesem Zweck habe ich beispielsweise mit dem Vorsitzenden des Kroatischen Kulturvereins gesprochen und mehreren Podiumsdiskussionen im Burgenlandkroatischen Zentrum in Wien beigewohnt. Zudem konnte ich während eines einmonatigen Forschungsaufenthaltes in Umeå auch das samische Informationszentrum in Östersund besuchen und an einem mehrtägigen Plenum des samischen Parlamentes in Stockholm teilnehmen. Anhand dieser Untersuchungen sollen vor allem die Muster und Mechanismen gezeigt werden, mittels derer die eigene Identität, aber auch die Identität anderer geformt werden kann, wobei hier vor allem die Beziehung zwischen Staat und Minderheiten im Vordergrund stehen. Schlussendlich wird auch die moderne Symbolsprache der beiden Minderheiten berücksichtigt und aufgezeigt, inwiefern hier von nationbuilding gesprochen werden kann und welche Bedeutung diese Minderheiten innerhalb eines sich neu strukturierenden Europas haben. Aus verschiedenen Gründen habe ich mich gerade für diese beiden Minoritäten entschieden. Einerseits habe ich zu den burgenländischen Kroaten durch meine Herkunft einen persönlichen Bezug, da meine Familie aus einem kroatischsprachigen Gebiet im mittleren Burgenland stammt. In Berührung mit der samischen Kultur kam ich dann vor allem durch meinen Erasmus Aufenthalt in Umeå und einen Besuch in Kiruna. Nach dem Verfassen einer kurzen Arbeit zur schulischen Situationen der beiden Minderheiten für einen Landeskunde Kurs, beschloss ich schließlich, die Thematik weiter auszubauen.
Anzumerken wäre abschließend, dass Berufs- und Tätigkeitsbezeichnungen, wie
beispielsweise „Sportler“ in einem geschlechtsneutralen Sinn verwendet werden. Zudem wurden die Übersetzungen der kroatischen Zitate, sofern nicht anders vermerkt, vom Verfasser vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Theoretische Grundlagen
- 1.1. Der Begriff „Nation“ und die Entstehung nationalistischer Strömungen
- 1.2. Die Nation als Konstrukt oder „imagined community“
- 1.2.1. Abgrenzung gegenüber anderen Identitäten
- 1.2.2. Verschiedene Formen des nationbuilding
- 1.3. Die Rolle der Sprache und anderer Symbole für kollektive Identitätsbildung bei Nationen und Minderheiten
- 1.4. Grundlagen für das Verhältnis zwischen Nationalstaat und Minderheit
- 1.4.1. Minderheiten - ein Definitionsproblem?
- 1.4.2. „The power to define“ – Kategorisierungen von Minorität und Majorität
- 1.4.3. Raum für Minderheiten im Rahmen internationaler Zusammenarbeit
- 2. Nationbuilding bei den Sámi in Schweden
- 2.1. Der Staat und die Sámi - Überblick über die Geschichte der Minderheit
- 2.2. „The power to define“ - Der schwedische Staat definiert samische Identität
- 2.2.1. Das Rentier als Symbol für Identität?
- 2.2.2. Spaltungen innerhalb des samischen Volkes und „echte“ samische Identität
- 2.2.3. „same“ vs. „lapp“
- 2.3. Vereinstätigkeit und politische Mobilisierung - ein neues Selbstbild entsteht
- 2.4. Die Konstruktion von Sápmi
- 2.4.1. Staatliche Grenzziehungen
- 2.4.2. Konstruktion nationaler samischer Identität
- 2.5. Institutionalisierung von Symbolen
- 2.5.1. Flagge, Feiertage und Hymne
- 2.5.2. Karten
- 2.5.3. Sprache
- 2.5.4. Kulturelle Symbole
- 2.6. Transnationale und internationale Zusammenarbeit
- 2.7. Minderheit oder Urvolk?
- 2.8. Zusammenfassung und mögliche Zukunftsaussichten
- 3. Nationbuilding bei den Burgenlandkroaten in Österreich
- 3.1. Der Staat und die Burgenlandkroaten - Überblick über die Geschichte der Minderheit
- 3.2. „The power to define“ - Österreichs stille Minderheit?
- 3.3. Vereinstätigkeit und politische Mobilisierung
- 3.3.1. Spaltung der Volksgruppe durch die österreichische Parteienlandschaft
- 3.3.2. Die Rolle der katholischen Kirche
- 3.4. Institutionalisierung von Symbolen
- 3.4.1. Hymne
- 3.4.2. Karten und Ortstafeln
- 3.4.3. Sprache
- 3.4.4. Kulturelle Symbole
- 3.5. Transnationale Zusammenarbeit
- 3.6. Überblick über das nationbuilding in der Mutternation Kroatien und über deren Beziehungen zu den Burgenlandkroaten
- 3.7. Zusammenfassung und mögliche Zukunftsaussichten
- 4. Vergleich
- 4.1. Staat und Minderheit
- 4.2. Organisationswesen
- 4.3. Anwendung und Bedeutung von Symbolen
- 4.4. Nationbuilding
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Prozess des Nationbuilding in einem sich neu strukturierenden Europa anhand zweier nationaler Minderheiten: der Sámi in Schweden und der Burgenlandkroaten in Österreich. Ziel ist es, die Strategien und Herausforderungen der Identitätsbildung und -behauptung dieser Gruppen im Kontext ihrer jeweiligen Nationalstaaten zu analysieren und zu vergleichen.
- Identitätsbildung von Minderheiten in Europa
- Nationbuilding-Prozesse im Vergleich
- Die Rolle des Staates in der Definition von Minderheitenidentitäten
- Bedeutung von Symbolen und Sprache für die kollektive Identität
- Transnationale und internationale Zusammenarbeit von Minderheiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Nationbuilding bei den Sámi und den Burgenlandkroaten. Es definiert den Begriff "Nation" und beleuchtet die Entstehung nationalistischer Strömungen. Weiterhin wird das Konzept der "imagined community" erörtert und die Rolle von Sprache und Symbolen für die kollektive Identitätsbildung untersucht. Schließlich werden verschiedene Ansätze zum Verhältnis zwischen Nationalstaat und Minderheit diskutiert, inklusive der Problematik der Definition von Minderheiten und dem Einfluss internationaler Zusammenarbeit.
2. Nationbuilding bei den Sámi in Schweden: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Nationbuilding-Prozess der Sámi in Schweden. Es analysiert die historische Beziehung zwischen dem schwedischen Staat und der samischen Minderheit, beleuchtet die staatliche Einflussnahme auf die Definition samischer Identität (z.B. die Rolle des Rentiers als Symbol) und die internen Spaltungen innerhalb der samischen Bevölkerung. Die Rolle von Vereinen, politische Mobilisierung und die Konstruktion von Sápmi als kultureller Raum werden ebenfalls detailliert untersucht, zusammen mit der Institutionalisierung samischer Symbole (Flagge, Sprache, kulturelle Symbole) und der transnationalen Zusammenarbeit.
3. Nationbuilding bei den Burgenlandkroaten in Österreich: Analog zu Kapitel 2, fokussiert dieses Kapitel auf die Burgenlandkroaten in Österreich. Die historische Beziehung zum österreichischen Staat, die staatliche Einflussnahme auf die Definition kroatischer Identität (oder deren Fehlen), und die Rolle von Vereinen und politischer Mobilisierung werden analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Spaltung innerhalb der Volksgruppe durch die österreichische Parteienlandschaft und der Rolle der katholischen Kirche gewidmet. Die Institutionalisierung von Symbolen und die transnationale Zusammenarbeit werden ebenfalls untersucht, im Kontext des Nationbuilding in Kroatien und dessen Beziehungen zu den Burgenlandkroaten.
4. Vergleich: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analysen der Sámi und der Burgenlandkroaten verglichen. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Verhältnis zwischen Staat und Minderheit, im Organisationswesen, in der Anwendung und Bedeutung von Symbolen, und im Gesamtprozess des Nationbuilding.
Schlüsselwörter
Nationbuilding, nationale Minderheiten, Sámi, Burgenlandkroaten, Schweden, Österreich, Identität, kollektive Identität, imagined community, Symbole, Sprache, Staat, Minderheitenpolitik, transnationale Zusammenarbeit, Identitätskonstruktion.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Nationbuilding bei den Sámi und den Burgenlandkroaten
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht den Prozess des Nationbuilding bei zwei nationalen Minderheiten: den Sámi in Schweden und den Burgenlandkroaten in Österreich. Sie analysiert die Strategien und Herausforderungen der Identitätsbildung und -behauptung dieser Gruppen im Kontext ihrer jeweiligen Nationalstaaten und vergleicht diese.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Identitätsbildung von Minderheiten in Europa, Nationbuilding-Prozesse im Vergleich, die Rolle des Staates bei der Definition von Minderheitenidentitäten, die Bedeutung von Symbolen und Sprache für die kollektive Identität sowie die transnationale und internationale Zusammenarbeit von Minderheiten. Im Detail werden die historischen Beziehungen der Minderheiten zu ihren jeweiligen Staaten, die Rolle von Vereinen und politischer Mobilisierung, die Institutionalisierung von Symbolen und die internen Spaltungen innerhalb der Gruppen untersucht.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Begriff "Nation", die Entstehung nationalistischer Strömungen, das Konzept der "imagined community" und die Rolle von Sprache und Symbolen für die kollektive Identitätsbildung. Es werden verschiedene Ansätze zum Verhältnis zwischen Nationalstaat und Minderheit diskutiert, inklusive der Problematik der Definition von Minderheiten und dem Einfluss internationaler Zusammenarbeit.
Wie wird der Nationbuilding-Prozess der Sámi in Schweden analysiert?
Die Analyse des Nationbuilding-Prozesses der Sámi umfasst die historische Beziehung zwischen dem schwedischen Staat und der samischen Minderheit, die staatliche Einflussnahme auf die Definition samischer Identität (z.B. die Rolle des Rentiers als Symbol), interne Spaltungen innerhalb der samischen Bevölkerung, die Rolle von Vereinen und politischer Mobilisierung, die Konstruktion von Sápmi als kultureller Raum, die Institutionalisierung samischer Symbole (Flagge, Sprache, kulturelle Symbole) und die transnationale Zusammenarbeit.
Wie wird der Nationbuilding-Prozess der Burgenlandkroaten in Österreich analysiert?
Die Analyse der Burgenlandkroaten konzentriert sich auf die historische Beziehung zum österreichischen Staat, die staatliche Einflussnahme auf die Definition kroatischer Identität (oder deren Fehlen), die Rolle von Vereinen und politischer Mobilisierung, die Spaltung innerhalb der Volksgruppe durch die österreichische Parteienlandschaft, die Rolle der katholischen Kirche, die Institutionalisierung von Symbolen, die transnationale Zusammenarbeit und den Kontext des Nationbuilding in Kroatien und dessen Beziehungen zu den Burgenlandkroaten.
Wie werden die Ergebnisse der Analysen verglichen?
Die Ergebnisse der Analysen der Sámi und der Burgenlandkroaten werden anhand von Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Verhältnis zwischen Staat und Minderheit, im Organisationswesen, in der Anwendung und Bedeutung von Symbolen und im Gesamtprozess des Nationbuilding verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nationbuilding, nationale Minderheiten, Sámi, Burgenlandkroaten, Schweden, Österreich, Identität, kollektive Identität, imagined community, Symbole, Sprache, Staat, Minderheitenpolitik, transnationale Zusammenarbeit, Identitätskonstruktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Kapitel mit theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zum Nationbuilding der Sámi in Schweden, ein Kapitel zum Nationbuilding der Burgenlandkroaten in Österreich, ein Vergleichskapitel und einen Ausblick. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterkapitel, die die oben genannten Themenbereiche abdecken.
- Quote paper
- Sabine Palatin (Author), 2008, Sámi in Schweden und Burgenlandkroaten in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115521