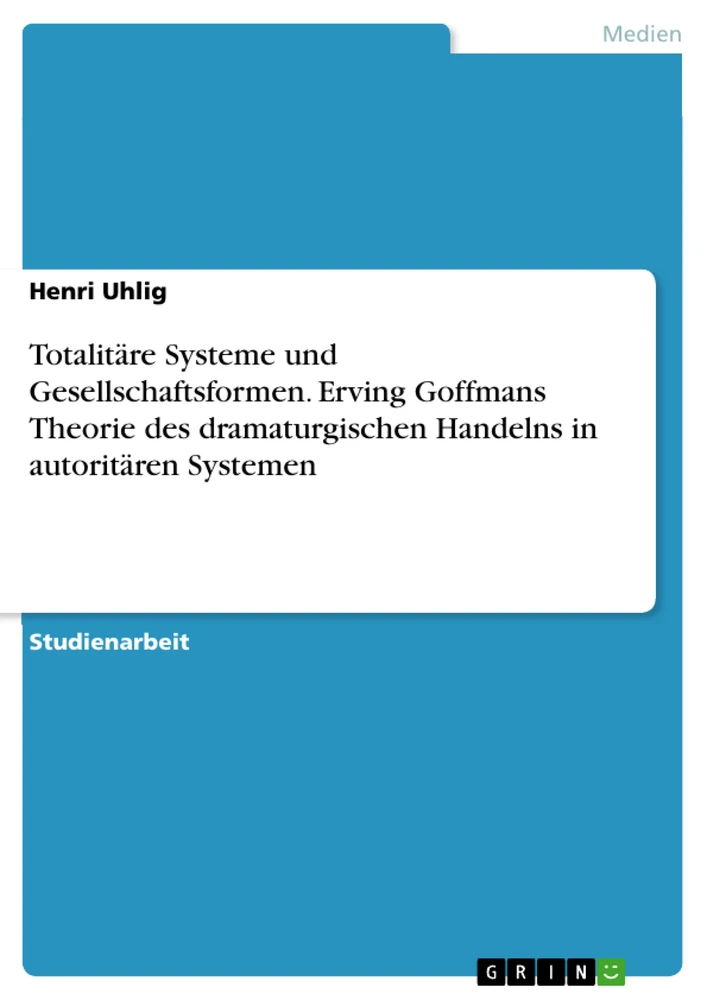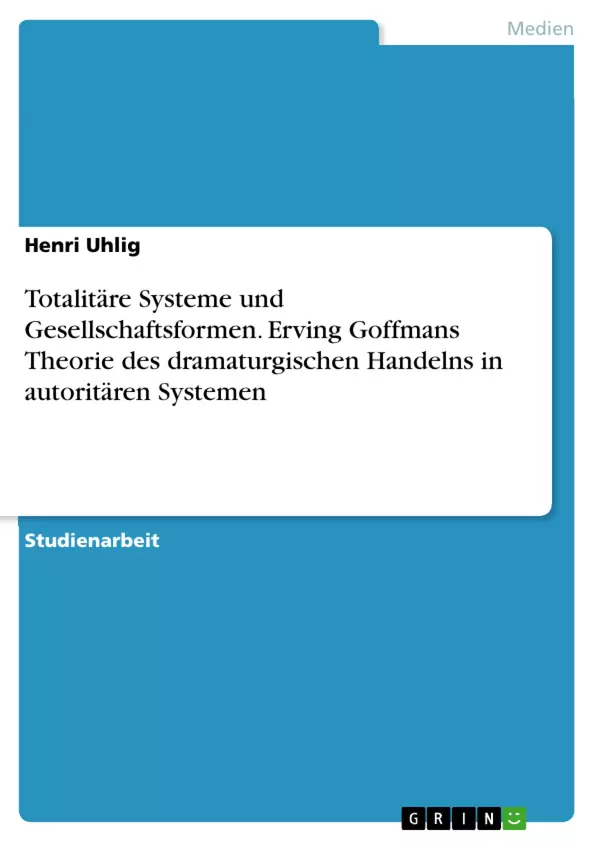Wie verhält sich das soziale Handeln, also das beständige Einnehmen von Rollen, Rollenwechseln und Rollendistanz in "totalen Institutionen", welche dem Insasse und dem Gefängniswärter ein von der Außenwelt völlig verschiedenes ortsbestimmtes Verhalten abverlangen? Im Gefängnis können die Insassen nicht selbst darüber bestimmen, ob sie auf der Vorderbühne performen oder ob sie sich Zwecks Vorbereitung der Rolle auf der Hinterbühne bewegen. Im Anbetracht der permanenten Überwachung beginnt die aufgelegte Fassade des Insassen zu bröckeln, weil die Trennungslinie zwischen Vorder- und Hinterbühne verwischt. Kann der einzelne Insasse seine "Selbst"- Identität vor den totalitären Eingriffen im Gefängnisalltag wahren und gelingt es diesem sein "Normalitätsschauspiel" bei Besuch aufrechterhalten, indem dieser der endgültigen Stigmatisierung innerhalb von totalitären Institutionen durch eine "sekundäre Anpassung" entgeht? Gelingt es den Insassen innerhalb einer abgeschlossenen und reglementierten totalen Institution bei der Verrichtung von gemeinsamen Tätigkeiten als geschlossenes Ensemble aufzutreten und der Überwachung durch die Wärter, als auch dem Zwang der totalitären Institution zur Verrichtung von Diensten zu trotzen, indem keine destruktiven Informationen an die Wärter gelangen, welche die Situationsbestimmung der gemeinsamen Darstellung diskreditiert?
In dieser Arbeit soll zunächst der Theateralltag des einzelnen Individuum, aber auch des Individuums im Ensemble dargestellt werden. Des Weiteren geht es darum zu klären, warum das soziale Handeln in unterschiedlichen sozialen Situationen nach der beständige Einnahme von Rollen, Rollenwechseln und einer Rollendistanz verlangt. Hierbei soll eine nähere Untersuchung des Stanford-Prison-Projekts unter der Anwendung der Theorie des dramaturgischen Handelns für Antworten auf die oben gestellten Zwischenfragen sorgen. Am Schluss dieser Arbeit soll eine kurze Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alltagstheater - Die Gesellschaft als Bühne
- „Totale Institutionen“ - Umformung des Selbst
- Individuum in der totalitären Institution - Primäre und sekundäre Anpassung
- Fallbeispiel - Stanford-Prison-Experiment
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Konzept des „dramaturgischen Handelns“ von Erving Goffman, das die soziale Interaktion als Theateraufführung begreift. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Alltagslebens und der Rolle, die die „Selbstpräsentation“ in verschiedenen sozialen Kontexten spielt. Insbesondere wird der Einfluss totalitärer Institutionen auf die Selbstdarstellung und die Herausforderungen des individuellen Handelns in solchen Umgebungen beleuchtet.
- Die Bedeutung der Selbstdarstellung im Alltag und die Nutzung von „Vorder- und Hinterbühne“
- Die Veränderung von Selbstbild und -präsentation in totalitären Institutionen
- Die Herausforderungen der sozialen Interaktion und das Einnehmen von Rollen in solchen Kontexten
- Die Analyse des Stanford-Prison-Experiments als Fallbeispiel für die Auswirkungen totalitärer Kontrolle auf das Individuum
- Das Konzept der primären und sekundären Anpassung als Mechanismen zur Bewältigung der Anforderungen totalitärer Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Erving Goffmans Theorie des „dramaturgischen Handelns“ vor und erklärt, wie er die Gesellschaft als Theaterbühne betrachtet, auf der Individuen verschiedene Rollen spielen, um sich in sozialen Situationen zu präsentieren. Die Arbeit widmet sich der Frage, wie sich das soziale Handeln in totalitären Institutionen, wie Gefängnissen, von der „normalen“ Selbstdarstellung im Alltag unterscheidet.
Alltagstheater - Die Gesellschaft als Bühne
In diesem Kapitel wird Goffmans Theorie des „dramaturgischen Handelns“ vertieft. Es wird erläutert, wie das Individuum in der Gesellschaft verschiedene Rollen einnimmt und diese durch seine Selbstdarstellung, sein Verhalten und seine Erscheinung präsentiert. Goffman unterscheidet zwischen „Vorder- und Hinterbühne“ und erklärt, wie die Inszenierung der sozialen Rolle in unterschiedlichen Situationen variiert.
„Totale Institutionen“ - Umformung des Selbst
Dieses Kapitel untersucht den Einfluss totalitärer Institutionen auf das Individuum. Goffman argumentiert, dass diese Einrichtungen die Trennung von Vorder- und Hinterbühne auflösen und so die Selbstdarstellung des Einzelnen stark beeinträchtigen. Es werden die Mechanismen der „primären und sekundären Anpassung“ vorgestellt, die das Individuum entwickelt, um mit den Anforderungen der totalitären Institution zurechtzukommen. Das Stanford-Prison-Experiment wird als Beispiel herangezogen, um die Auswirkungen totalitärer Kontrolle auf die Selbstdarstellung und das soziale Verhalten zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen aus der Soziologie wie Selbstdarstellung, „dramaturgisches Handeln“, totale Institutionen, soziale Interaktion, Rollenübernahme, Anpassung, Stanford-Prison-Experiment, und „Normalitätsschauspiel“. Sie untersucht, wie diese Konzepte im Kontext des Alltagslebens und in besonderen sozialen Situationen wie totalitären Einrichtungen zum Tragen kommen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Erving Goffman unter „dramaturgischem Handeln“?
Goffman begreift soziale Interaktion als Theateraufführung, bei der Individuen Rollen einnehmen, um sich in verschiedenen sozialen Kontexten zu präsentieren.
Was ist der Unterschied zwischen „Vorderbühne“ und „Hinterbühne“?
Die Vorderbühne ist der Ort der öffentlichen Selbstdarstellung, während die Hinterbühne der Vorbereitung dient und ein Ablegen der Rolle ermöglicht.
Was sind „totale Institutionen“?
Totale Institutionen sind abgeschlossene Einrichtungen wie Gefängnisse, die den Alltag streng reglementieren und die Trennung zwischen Vorder- und Hinterbühne oft auflösen.
Welche Rolle spielt das Stanford-Prison-Experiment in dieser Analyse?
Es dient als Fallbeispiel, um die Auswirkungen totalitärer Kontrolle auf die Selbstdarstellung und die Umformung des „Selbst“ zu veranschaulichen.
Was bedeuten primäre und sekundäre Anpassung?
Dies sind Mechanismen, mit denen Individuen versuchen, ihre Identität innerhalb der restriktiven Anforderungen einer totalen Institution zu wahren.
- Quote paper
- M.A. Political Sience Henri Uhlig (Author), 2019, Totalitäre Systeme und Gesellschaftsformen. Erving Goffmans Theorie des dramaturgischen Handelns in autoritären Systemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156413