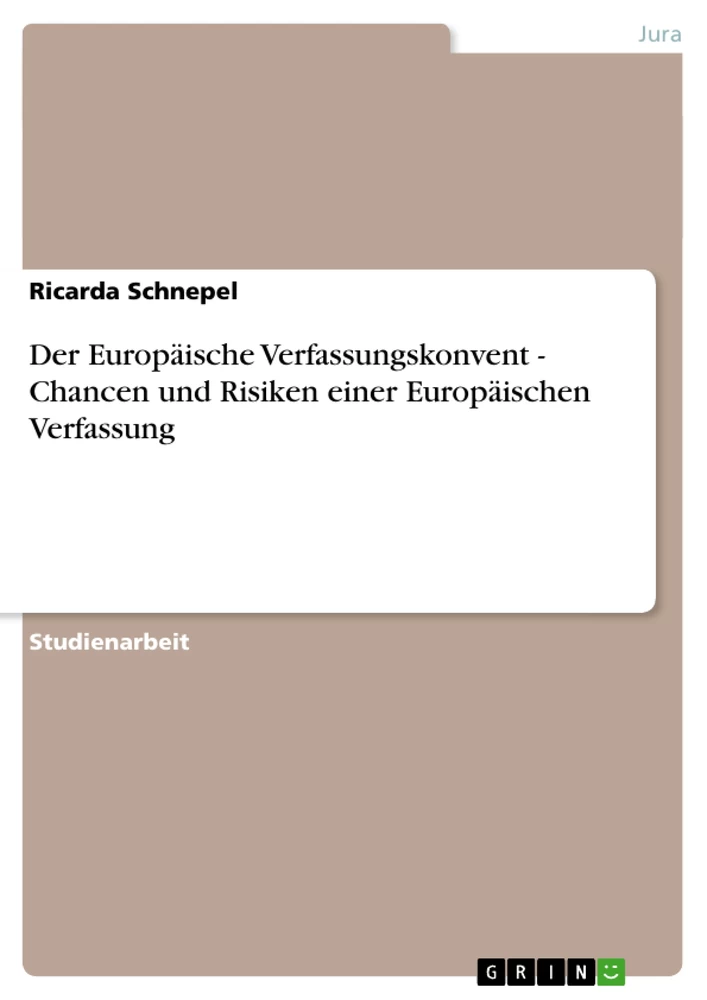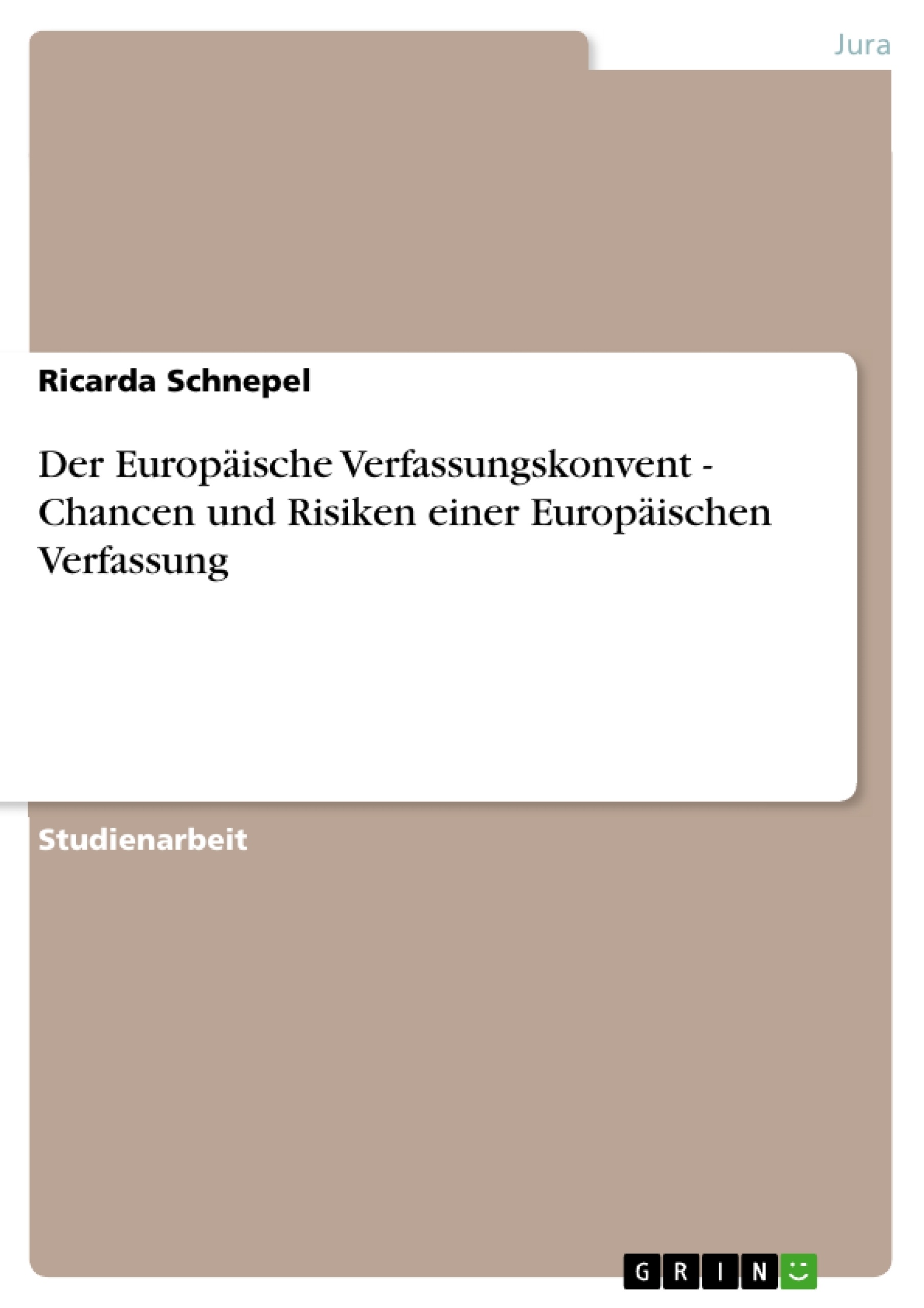Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges sollten in Europa durch die Verflechtung der vitalen Interessen der europäischen Staaten und durch die Abgabe nationalstaatlicher Hoheitsrechte an europäische Institutionen wirtschaftliche Krisen, Kriegsgefahr und Hegemonialstreben einzelner Mächte verhindert werden. Eine weitere wichtige Zielsetzung bestand in der Sicherung des Gemeinwohls durch starke kontinuierliche europäische Institutionen. Die vertraglichen Grundlagen für die innereuropäische Kooperation wurden später erheblich erweitert und vertieft, insbesondere im Bereich der Währungs- und Geldpolitik. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen tritt derzeit immer deutlicher die Frage in den Vordergrund, welches Selbstverständnis, welche Rechtsform und Ausgestaltung und welche Art vertraglicher Grundlagen diese Kooperationsform letztendlich annehmen soll. Es besteht weitgehend Einigkeit in juristischer und politischer Literatur, dass die darüber hinaus bestehenden innereuropäischen und außenpolitischen Herausforderungen auf Basis der aktuellen Verträge nicht bewältigt werden können und dass die auf die Verträge von Amsterdam und Nizza gerichteten Hoffnungen in wesentlichen Punkten nicht erfüllt worden sind. Die sich daraus ergebenden „left-overs“ von Nizza sollen auf einer Regierungskonferenz 2004 behandelt werden, die durch einen Europäischen Verfassungskonvent, eingesetzt durch den Europäischen Rat von Laeken mit Be- schluss vom 14./15.12.2001, vorbereitet wird.
Die Europäische Verfassungsdebatte ist vielschichtig. Das Thema der vorliegenden Arbeit legt den Fokus auf juristische Fragestellungen. Nach einer Klärung des Begriffes „Verfassung“ hin zu einer vom Staatsbegriff unabhängigen Verfassungsdefinition, werden die wichtigsten Strömungen der aktuellen Verfassungsdebatte dargestellt. Es wird untersucht, welche Verfassungskriterien an eine „Europäische Verfassung“ angelegt werden müssten, ob Europa bereits eine Verfassung hat und ob bzw. welche Verfassungsdefizite bestehen. Die Vorschläge des Europäischen Verfassungskonvents werden in den Kontext der aktuellen Debatte eingeordnet. Es wird analysiert, ob sie geeignet sind, die Defizite zu beheben bzw. ob sich Risiken dahingehend ergeben, dass andere Verfassungsmerkmale durch die Umsetzung dieser Vorschläge geschädigt werden könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung und Vorgehensweise
- Verfasstheit, Verfassungsfähigkeit und Verfassungsnotwendigkeit im Rahmen der Europäischen Union
- Allgemeine Definition und Inhalt einer nationalen Verfassung
- Die rechtliche Natur der Europäischen Union
- Juristische Betrachtung: Sind EU und EG materiell verfassungsfähig i.e.S.? Bilden die Grundlagenverträge der EU und der EG eine materielle Verfassung i.e.S.?
- Der juristische Verfassungsbegriff im Rahmen der vorliegenden Arbeit
- Verfassungskriterien
- Erfüllung der Kriterien durch die „Europäische Verfassung“ der Verfassungsgemeinschaft?
- Die politische Diskussion Braucht Europa eine Verfassung?
- Die Vorschläge des Europäischen Konvents - Chancen und Risiken einer Verbesserung der „Europäischen Verfassung“
- Die Arbeit des Europäischen Verfassungskonvents
- Eine Vollverfassung auf Europäischer Ebene?
- Abbau der Defizite durch die Konventsvorschläge?
- Vereinfachung der Verträge in einer Verfassungsurkunde
- Status der Menschenrechte und Grundfreiheiten
- Die europäische Identität und die Wahrung der nationalen Identitäten
- Gewaltenteilung zwischen EU/EG und ihren Mitgliedstaaten
- Zusätzliche Risiken durch die Umsetzung der Konventsvorschläge?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Europäischen Verfassungskonvent und analysiert dessen Chancen und Risiken für die Entwicklung einer „Europäischen Verfassung“. Ziel ist es, die juristische und politische Debatte um die Verfassungsfähigkeit und die Notwendigkeit einer Verfassung für die Europäische Union zu beleuchten.
- Die rechtliche Natur der Europäischen Union
- Die Verfassungsfähigkeit der Europäischen Union
- Die Vorschläge des Europäischen Konvents und ihre Auswirkungen auf die „Europäische Verfassung“
- Die Chancen und Risiken einer europäischen Verfassung
- Die Bedeutung der nationalen Identitäten im Kontext einer europäischen Verfassung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Fragestellung und Vorgehensweise der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der europäischen Integration hervorgehoben und die Methodik der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel wird die rechtliche Natur der Europäischen Union untersucht. Es werden die allgemeinen Definitionen und Inhalte einer nationalen Verfassung sowie die juristischen Kriterien für die Verfassungsfähigkeit einer supranationalen Organisation erörtert. Das dritte Kapitel analysiert die Vorschläge des Europäischen Konvents und ihre Bedeutung für die Entwicklung einer „Europäischen Verfassung“. Es werden die Chancen und Risiken der Konventsvorschläge im Hinblick auf die Vereinfachung der Verträge, den Status der Menschenrechte, die Wahrung der nationalen Identitäten und die Gewaltenteilung zwischen EU/EG und ihren Mitgliedstaaten untersucht.
Schlüsselwörter
Europäischer Verfassungskonvent, Europäische Verfassung, Verfassungsfähigkeit, Europäische Union, nationale Identitäten, Gewaltenteilung, Menschenrechte, Grundfreiheiten, Konventsvorschläge, Chancen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Europäischen Verfassungskonvents?
Der Konvent sollte eine Verfassungsurkunde erarbeiten, um die komplexen EU-Verträge zu vereinfachen und die Union handlungsfähiger zu machen.
Hat die EU bereits eine materielle Verfassung?
Juristisch wird debattiert, ob die bestehenden Grundlagenverträge bereits die Funktion einer materiellen Verfassung erfüllen, auch ohne formellen Verfassungstitel.
Welche Risiken birgt eine europäische Verfassung?
Ein Risiko besteht in der möglichen Schwächung der nationalen Identitäten der Mitgliedstaaten und Unklarheiten bei der Gewaltenteilung.
Welche Chancen bietet der Verfassungsentwurf?
Chancen liegen in einer besseren Wahrung der Menschenrechte, einer klareren Struktur und einer stärkeren demokratischen Identität der EU.
Warum reichten die Verträge von Nizza und Amsterdam nicht aus?
Diese Verträge ließen wesentliche Fragen offen („left-overs“), die für eine effiziente Erweiterung und Vertiefung der EU notwendig waren.
- Arbeit zitieren
- Ricarda Schnepel (Autor:in), 2003, Der Europäische Verfassungskonvent - Chancen und Risiken einer Europäischen Verfassung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11564