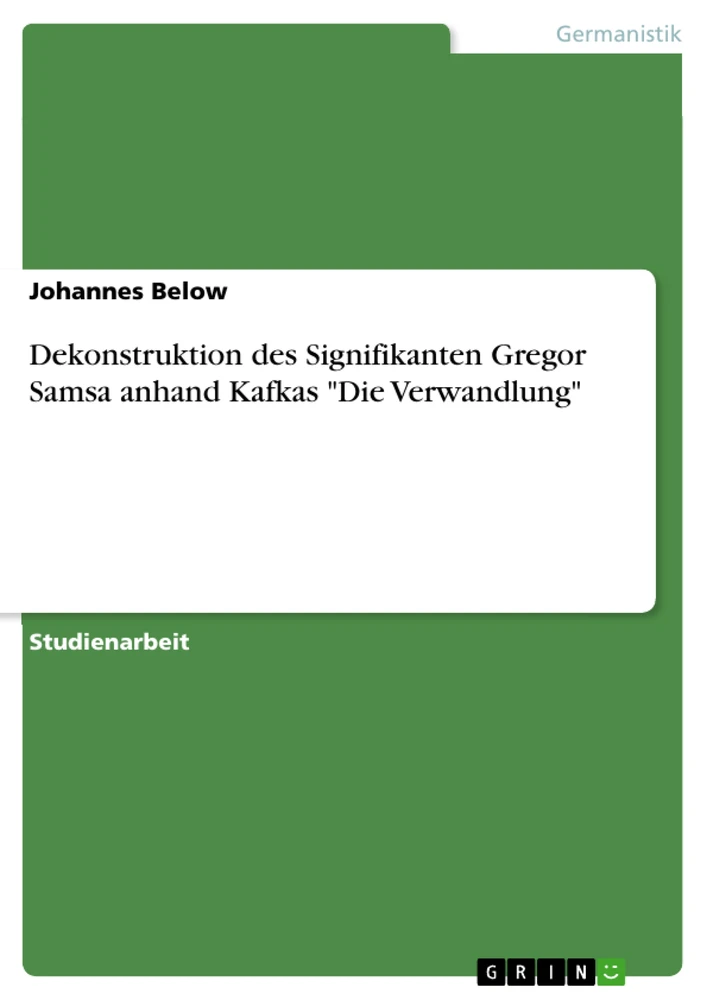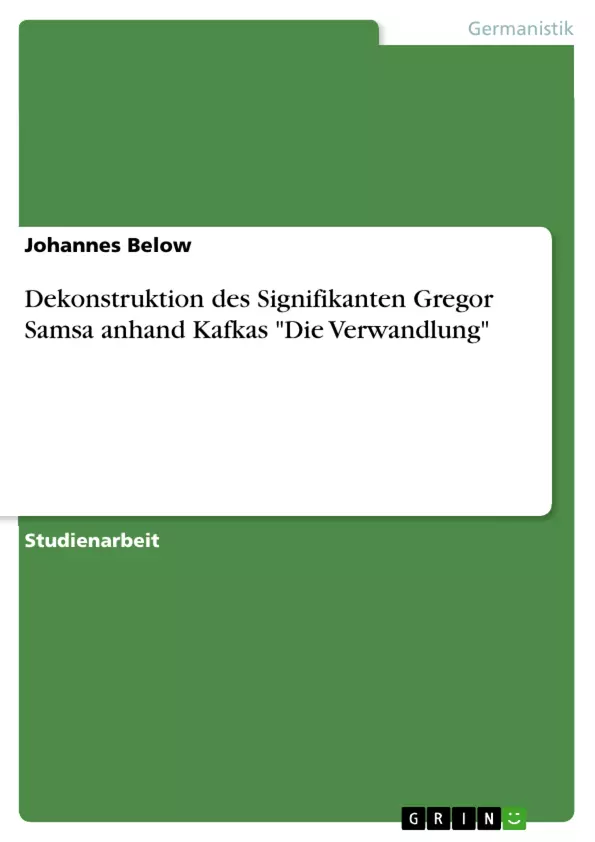Gregor Samsa ist ein Handlungsreisender, der sich eines Morgens im Körper eines Insektes wiederfindet. Oder? In dieser Hausarbeit wird der Beweis angetreten, dass Gregor weder Handlungsreisender (Mensch) noch Insekt ist, sondern vielmehr ein Zeichen, dessen Zeicheninhalt sich erst von Umgang mit Gregor her verstehen lässt.
Das methodologische Rüstzeug stammt von Jaques Derrida, in dessen Konzeption des Zeichens zu Beginn kurz eingeführt wird. Die Hausarbeit liefert eine Dekonstruktion des Signifikanten Gregor Samsa und zeigt auf, dass simple Oppositionen wie Mensch–Tier längst nicht ausreichen "Die Verwandlung" adäquat zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vom Subjekt zum Signifikanten
- 2. Das Bild als Spiegel: Opposition Mensch – Tier
- 3. Drei Uniformen: Opposition Innen – Außen
- 4. Gregor unter Signifikant: Opposition Gregor - ()
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Identität Gregor Samsas in Kafkas „Die Verwandlung“. Im Mittelpunkt steht die kritische Hinterfragung der Behauptung, Gregor sei ein „Mensch im Insektenkörper“. Dabei wird die klassische Unterscheidung zwischen Inhalt und Form, Subjekt und Objekt bzw. Signifikat und Signifikant in Frage gestellt.
- Die Unmöglichkeit der eindeutigen Identifizierung Gregors als Mensch oder Tier.
- Die Analyse von Signifikationsprozessen in Kafkas „Die Verwandlung“ und ihre Bedeutung für die Identitätsfrage.
- Die Dekonstruktion anthropologischer Grundannahmen durch Kafkas Text.
- Die Rolle des Signifikanten und Signifikats in der sprachlichen und metaphysischen Konstruktion von Identität.
- Die Relevanz der sprachkritischen Wende und der Zeichentheorie für das Verständnis von Identität.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vom Subjekt zum Signifikanten
Dieses Kapitel beleuchtet die Ambivalenz des Subjektbegriffs in der Sprache und in der Metaphysik. Es wird die These vertreten, dass das metaphysische Subjekt letztlich ein Derivat des sprachlichen Subjekts ist. Dabei spielt die sprachkritische Wende eine entscheidende Rolle, die den Fokus auf die Analyse von Sprache und Zeichen lenkt. Derridas Dekonstruktion des Signifikats wird eingeführt, wobei die Bedeutung des Signifikanten für die Konstruktion von Bedeutung im Vordergrund steht.
2. Das Bild als Spiegel: Opposition Mensch – Tier
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Gregor Samsa als Mensch oder Tier anzusehen ist. Es analysiert die optische Wahrnehmung Gregors als Insektenkörper und stellt diese in Beziehung zu traditionellen Vorstellungen von Mensch und Tier. Der Fokus liegt dabei auf der Dekonstruktion der dualistischen Dichotomie Mensch-Tier.
3. Drei Uniformen: Opposition Innen – Außen
Dieses Kapitel untersucht die Opposition zwischen Innen- und Außenwelt im Zusammenhang mit Gregors Verwandlung. Es werden verschiedene Aspekte der Veränderung Gregors betrachtet, wie z.B. seine Isolation, seine körperliche Veränderung und seine Wahrnehmung der Welt. Der Fokus liegt dabei auf der Auflösung der Grenzen zwischen Innen und Außen.
4. Gregor unter Signifikant: Opposition Gregor - ()
Dieses Kapitel beleuchtet die Frage nach der Identität Gregors anhand der Analyse von Signifikationsprozessen in „Die Verwandlung“. Dabei werden die sprachlichen und symbolischen Mechanismen untersucht, die Gregors Selbstverständnis beeinflussen. Es wird die These vertreten, dass Gregors Identität nicht als fixiert, sondern als in ständigem Wandel begriffen werden muss.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Sprache, Zeichen, Signifikant, Signifikat, Subjekt, Identität, Verwandlung, Anthropologie, Dekonstruktion, sprachkritische Wende und Kafkas „Die Verwandlung“. Es werden insbesondere die Konzepte der Arbitrarität des Zeichens, der Differenzialität von Bedeutung und die Kritik am metaphysischen Subjekt behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Ist Gregor Samsa in Kafkas "Die Verwandlung" Mensch oder Tier?
Die Arbeit argumentiert, dass Gregor weder eindeutig Mensch noch Tier ist, sondern als ein "Signifikant" (Zeichen) betrachtet werden muss, dessen Identität sich erst durch den Umgang mit ihm erschließt.
Welche methodische Grundlage nutzt die Hausarbeit?
Die Analyse stützt sich auf die Zeichentheorie und das Konzept der Dekonstruktion von Jacques Derrida.
Was bedeutet die Dekonstruktion der Opposition Mensch-Tier?
Es geht darum aufzuzeigen, dass einfache dualistische Gegensätze nicht ausreichen, um die komplexe Identität Gregors und die sprachkritische Dimension des Textes adäquat zu verstehen.
Welche Rolle spielen die "drei Uniformen" in der Analyse?
Die Uniformen werden im Zusammenhang mit der Opposition zwischen Innen und Außen untersucht, um die Auflösung der Grenzen von Gregors Identität zu verdeutlichen.
Wie wird das Subjekt in der Arbeit neu definiert?
Das metaphysische Subjekt wird kritisch hinterfragt und als ein Derivat des sprachlichen Subjekts bzw. als Signifikant innerhalb eines Zeichensystems dargestellt.
- Quote paper
- Johannes Below (Author), 2021, Dekonstruktion des Signifikanten Gregor Samsa anhand Kafkas "Die Verwandlung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156729