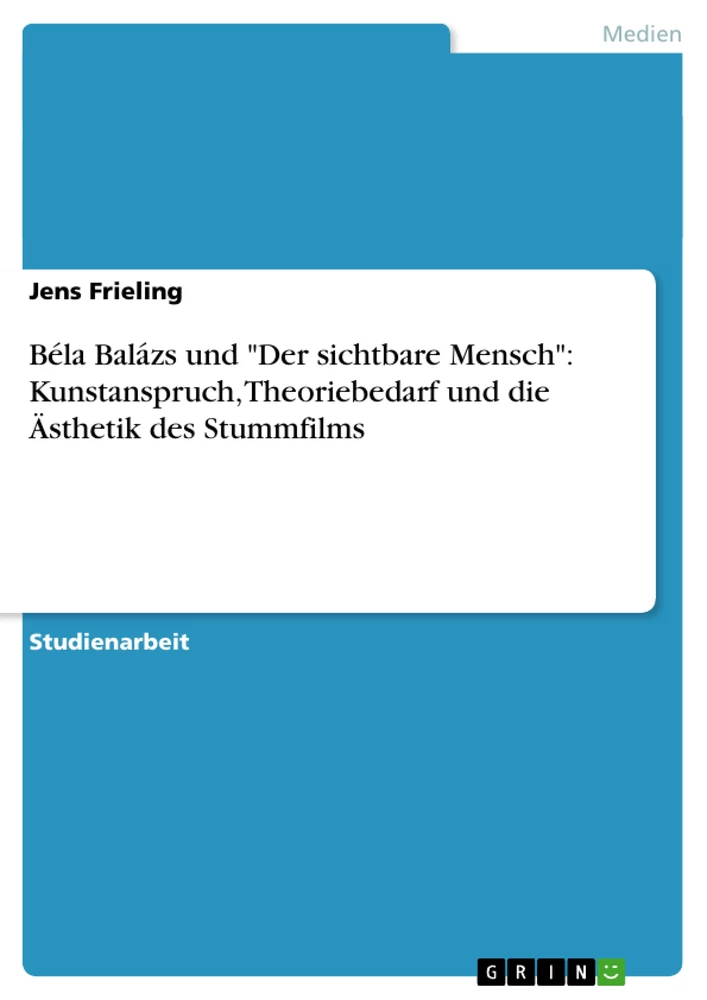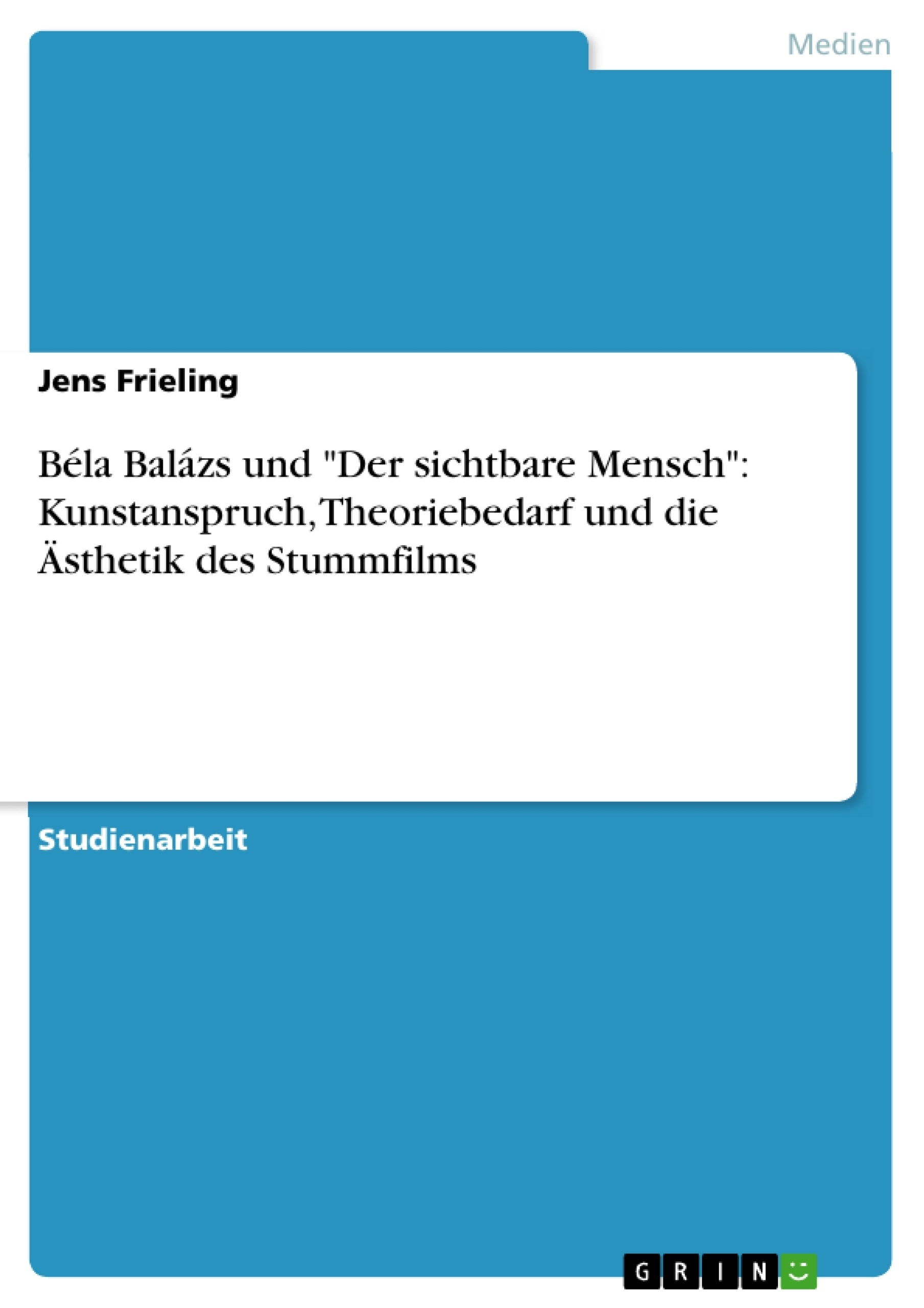„Ihr müsst erst etwas von guter Filmkunst verstehen, um sie dann zu bekommen, ihr müsst
erst lernen, ihre Schönheit zu sehen, auf das sie überhaupt entstehen kann.“1
Dieses Zitat trägt die Handschrift Béla Balázs’. Es zeichnen sich mit dieser an Bedingungen
geknüpften Forderung – sowohl an das Kinopublikum als auch „an die gelehrten Hüter der
Ästhetik“ - die Konturen einer Initiative ab, in der Balázs bereits 1924 eine fundamentale Bewusstwerdung
des theoretischen und formästhetischen Potentials des Films einfordert: „Meine
erste Filmtheorie [...] war die heftige Proklamation einer neuen Kunst.“2 resümiert Balázs
später rückblickend.
Doch die Konfrontation mit Béla Balázs ist nicht allein eine Begegnung mit dem Begründer
der programmatischen, filmtheoretischen Konzeption des 20. Jahrhunderts „Der
sichtbare Mensch“, es ist auch eine Begegnung mit dem Dramatiker, dem Dichter, dem Märchenautor
und dem Novellist Béla Balázs. Er versuchte sich mit Dramen, Gedichten, Romanen,
Feuilletons und schließlich Filmdrehbüchern. Dennoch bleibt die Auseinandersetzung
mit diesen exponierten, literarischen Talenten in dieser Arbeit lediglich auf solche Bereiche
beschränkt, die Rückschlüsse erlauben auf das geistige Fundament seiner persönlichen Disposition
zur Materie der Filmtheorie. Dies wird insbesondere an der lyrischen Sprachlegung
Balázs bzw. an stilistischen Besonderheiten aufzuzeigen sein, mit Hilfe derer Balázs die Bereiche
offen zu legen versucht, die für ihn das Wesen der Filmkunst umreißen.
Als ein erster wichtiger Navigationspunkt dieser Arbeit steht dabei die Vorrede in drei
Ansprachen voran, deren Analyse die ersten Kapitel dieser Arbeit einnehmen wird. Interessant
ist hier bereits, dass Balázs nicht nur den Status eines Kunstwerkes für den Stummfilm
beansprucht, sondern darüber hinaus mit Vehemenz seine Überzeugung von der Notwendigkeit
und Produktivität der Theorie artikuliert.
Die folgenden Kapitel veranschaulichen und reflektieren die filmästhetischen Anwendungsstrategien
für den Stummfilm, die Balázs in den „Skizzen zur Dramaturgie des Films“
dezidiert erörtert. In diesem Kontext werden auf der einen Seite filmische Mittel in ihrer Integrität
bzw. ihrer ästhetischen Gewichtung im Film, wie etwa die Großaufnahme, berücksichtigt.
Auf der anderen Seite werden diese technischen Bedingungen mit darstellerischen
Stilmitteln wie z.B. der „sichtbaren Gebärde“ aufgewogen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Béla Balázs – Biographischer Werdegang bis 1924, und Disposition zur Filmtheorie
- 2. Der Film in,,Der sichtbare Mensch“ – Kunstanspruch, Theoriebedarf und gegenwärtige Gültigkeit, stilistischer Zugang
- 2.1 Eine neue Kunst fordert einen selbstständigen Kunstanspruch
- 2.2 Die Filmtheorie
- 2.2.1 Die Proklamation der Filmtheorie
- 2.2.2 Zur gegenwärtigen Gültigkeit dieser filmtheoretischen Konzeption
- 2.3 Sprachfarbe, Tonalität und stilistischer Zugang Balázs' – argumentative Technik
- 3.,,Der sichtbare Mensch": Die Ästhetik des Stummfilms, Anwendungsstrategien, Dramaturgische Skizzen
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Visuelle Originalität im Stummfilm - Spezifiken
- 3.2.1 Gebärdensprache, Sprachgebärde, Ausdrucksbewegung
- 3.2.2 Der Begriff der Physiognomie
- 3.3 Großaufnahme, Bildwirkung.
- Schlussbetrachtung.
- Literaturhinweise
- Erklärung über die selbstständige Anfertigung dieser Hausarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Béla Balázs' Werk „Der sichtbare Mensch“ und analysiert dessen Bedeutung für die Entwicklung der Filmtheorie im 20. Jahrhundert. Die Arbeit untersucht Balázs' biographischen Werdegang und seine Disposition zur Filmtheorie, analysiert den Kunstanspruch und die Notwendigkeit einer Filmtheorie, sowie die ästhetischen Besonderheiten des Stummfilms, die Balázs in seinen „Skizzen zur Dramaturgie des Films“ erörtert.
- Die Bedeutung des Stummfilms als eigenständige Kunstform
- Die Notwendigkeit einer Filmtheorie
- Die ästhetischen Besonderheiten des Stummfilms
- Die Rolle der „sichtbaren Gebärde“ im Stummfilm
- Die Bedeutung der Großaufnahme für die Bildwirkung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt Béla Balázs' Werk „Der sichtbare Mensch“ in den Kontext seiner Zeit. Balázs' biographischer Werdegang wird beleuchtet, um seine Disposition zur Filmtheorie zu verstehen. Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor, dass Balázs' Werk eine fundamentale Bewusstwerdung des theoretischen und formästhetischen Potentials des Films einfordert.
Kapitel 1 beleuchtet Balázs' biographischen Werdegang bis 1924 und untersucht die Einflüsse, die seine Disposition zur Filmtheorie geprägt haben. Die Arbeit analysiert Balázs' frühe literarische Werke und seine politische Aktivität im Kontext der ungarischen Räterevolution. Es wird untersucht, wie diese Erfahrungen Balázs' Sicht auf den Film beeinflusst haben.
Kapitel 2 analysiert Balázs' Werk „Der sichtbare Mensch“ im Hinblick auf den Kunstanspruch des Films, die Notwendigkeit einer Filmtheorie und die ästhetischen Besonderheiten des Stummfilms. Die Arbeit untersucht Balázs' Argumentation für die Eigenständigkeit des Films als Kunstform und seine Kritik an der traditionellen Kunstwissenschaft. Es werden Balázs' filmtheoretische Konzepte und deren gegenwärtige Gültigkeit diskutiert.
Kapitel 3 befasst sich mit Balázs' „Skizzen zur Dramaturgie des Films“ und analysiert seine filmästhetischen Anwendungsstrategien für den Stummfilm. Die Arbeit untersucht die Rolle der „sichtbaren Gebärde“ im Stummfilm, die Bedeutung der Großaufnahme für die Bildwirkung und die spezifischen Möglichkeiten der visuellen Originalität im Stummfilm.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Béla Balázs, „Der sichtbare Mensch“, Stummfilm, Filmtheorie, Kunstanspruch, Ästhetik, Gebärdensprache, Großaufnahme, Dramaturgie, Filmgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernbotschaft von Béla Balázs' "Der sichtbare Mensch"?
Balázs fordert 1924 einen eigenständigen Kunstanspruch für den Film und betont die Notwendigkeit einer fundierten Filmtheorie.
Was versteht Balázs unter der "sichtbaren Gebärde"?
Es beschreibt die Ausdruckskraft der Mimik und Gestik im Stummfilm, die eine neue Form der visuellen Sprache ("Gebärdensprache") schafft.
Warum ist die Großaufnahme für Balázs so wichtig?
Die Großaufnahme ermöglicht es, die "Physiognomie" der Dinge und Gesichter zu zeigen, was für ihn das Wesen der Filmkunst ausmacht.
Wie hängen Balázs' literarische Talente mit seiner Filmtheorie zusammen?
Seine Erfahrung als Dichter und Dramatiker prägte seine lyrische Sprache und seinen stilistischen Zugang zur Analyse des Films.
Gilt Balázs' Theorie heute noch?
Die Arbeit untersucht die gegenwärtige Gültigkeit seiner Konzepte und deren Bedeutung für die moderne Filmwissenschaft.
- Citation du texte
- Jens Frieling (Auteur), 2004, Béla Balázs und "Der sichtbare Mensch": Kunstanspruch, Theoriebedarf und die Ästhetik des Stummfilms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115715