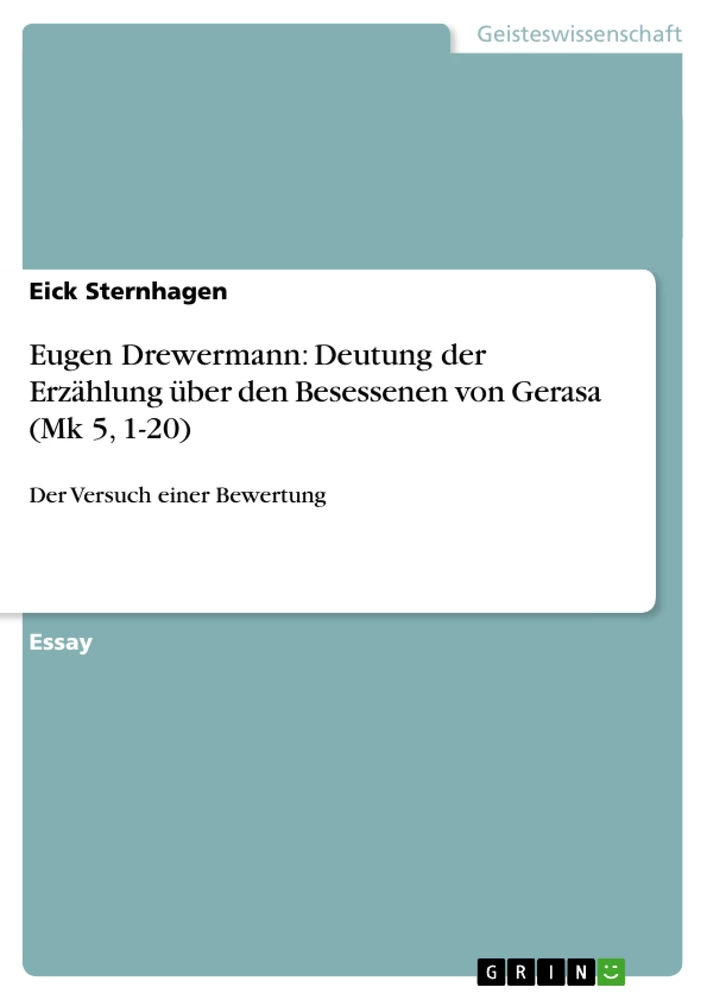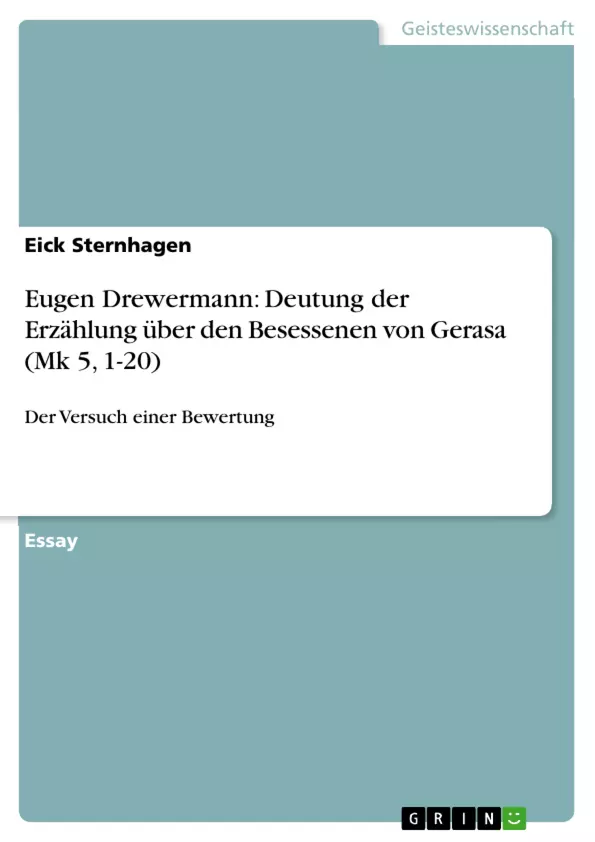Einleitung: Drewermanns Ausgangsposition
Drewermann versucht u. a., die Erzählung über den „Besessenen von Gerasa“2 in seinem Buch ‘Tiefenpsychologie und Exegese’3 tiefenpsychologisch zu deuten. Die daraus resultierenden Unebenheiten in Drewermanns Argumentationsstruktur können durch eine exemplarische Analyse seiner Auslegung am Beispiel der oben bezeichneten Erzählung aufgedeckt werden. Grundlagen für tiefenpsychologische Überlegungen finden sich in Drewermanns Buch ‘Glauben in Freiheit’4. Sein Anliegen besteht darin, dass er seinen Glauben unabhängig von den Richtlinien der etablierten (katholischen) Kirche leben will und dass er das Religiöse als solches für sich und andere definiert. Drewermann will sich frei machen von dem Diktat eines dogmatischen Überbaus und der damit einhergehenden Gesetzlichkeit.
Dazu schafft er den allgemeinen Rahmen. Im Prinzip schließt er an die Symbolschau Paul Tillichs an.5 Dabei geht er über das „Bedingte des Unbedingten“ bei Tillich hinaus6, indem er über die geläufige Textforschung hinaus die biblische Symbolik aus ihrem historischen Kontext heraus nicht nur in die Bedeutung für dieGegenwart hebt, sondern auch im Rahmen psychologischer Deutung zeigen will, dass Ängste ein zeitloses durch die Kulturen und Glaubensbezeugungen geisterndes Phänomen sind.
2 Vgl. Mt, 5,1-20.
3 Vgl. EUGEN DREWERMANN: Tiefenpsychologie und Exegese. Band II: Die Wahrheit der Werke und der Worte. Wunder, Weissagung, Apokalypse, Geschichte, Gleichnis. 5. Auflage. Olten / Freiburg1989 Vgl., S. 247-277.
4 EUGEN DREWERMANN: Glauben in Freiheit oder Tiefenpsychologie und Dogmatik, Band 1: Dogma, Symbolismus, Solothurn – Düsseldorf 1993.
5 Vgl. PAUL TILLICH, Symbol und Wirklichkeit, Göttingen 1986, S. 3-11.
6 Vgl. Derselbe, Recht und Bedeutung religiöser Symbole, in: PAUL TILLICH, Gesammelte Werke V: Die Frage nach dem Unbedingten, Stuttgart2 1978, S. 237-244. Tillich vertritt die Auffassung, dass das biblische Wort in seinem historischen und kulturellen Kontext in seiner Symbolkraft erkannt werden müsse. Diese Auffassung beschränkt die Auffassung von der buchstäblichen Auffassung des biblischen Wortes, des Unbedingten. Zur Problematik siehe J. RINGLEBEN, Symbol und göttliches Sein, in: G. HUMMEL (Hg.), Gott und Sein. Das Problem der Ontologie in der philosophischen Theologie Paul Tillichs. Beiträge des II. Internationalen Paul-Tillich-Symposions in Frankfurt 1988, Berlin/New York 1989, S. 165-181, hier S. 166, 181.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Drewermanns Ausgangsposition
- 2. Die Grundlage der Deutung, die Quelle: Markus 5,1-20: Heilung eines besessenen Geraseners (Mt 8,28-34; Lk 8,26-39)
- 2.1. Die Sünde und das Böse
- 2.2. Epilepsie statt Dämonen
- 2.3. Der Besessene von Gerasa und Borderline
- 3. Drewermann nimmt die Erzählung über Jona hinzu
- 3.1. Das Buch Jona, Kapitel 1-4,11
- 3.2. Jona und der Gerasener: ein Vergleich
- 4. Die fehlende Diagnose
- 5. Die Antwort auf Drewermanns Tiefenpsychologie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Eugen Drewermanns tiefenpsychologische Deutung der Markus-Erzählung vom Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20). Ziel ist es, die Argumentationsstruktur von Drewermanns Interpretation zu untersuchen und kritisch zu beleuchten. Dabei wird auch der Bezug zu Jonabuch und die Frage nach einer medizinischen Diagnose mit einbezogen.
- Drewermanns tiefenpsychologischer Ansatz zur Bibelauslegung
- Kritische Analyse der Argumentationsstruktur von Drewermann
- Vergleich der Erzählung von Gerasa mit der Jona-Geschichte
- Die Rolle von Angst und dem Unbewussten in Drewermanns Interpretation
- Die Frage nach einer alternativen, medizinischen Diagnose
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Drewermanns Ausgangsposition: Diese Einleitung stellt Eugen Drewermanns tiefenpsychologischen Ansatz zur Bibelauslegung vor. Sie beschreibt sein Bestreben, den Glauben unabhängig von kirchlichen Dogmen zu leben und die biblische Symbolik im Kontext der menschlichen Psyche zu interpretieren. Drewermann lehnt sich an Paul Tillich an, geht aber über dessen Konzepte hinaus, indem er die zeitlose und kulturübergreifende Bedeutung von Ängsten und Archetypen betont. Die Einleitung skizziert Drewermanns Kritik an der katholischen Kirche und seinen Versuch, die Wurzeln der Religion im menschlichen Unbewussten zu finden.
2. Die Grundlage der Deutung, die Quelle: Markus 5,1-20: Heilung eines besessenen Geraseners (Mt 8,28-34; Lk 8,26-39): Dieses Kapitel präsentiert den biblischen Text (Markus 5,1-20) als Grundlage für Drewermanns Analyse. Es beschreibt den Besessenen von Gerasa und seine Heilung durch Jesus. Der Text dient als Ausgangspunkt für die darauffolgende tiefenpsychologische Interpretation. Die verschiedenen Aspekte der Erzählung, wie die Beschreibung des Besessenen, die Begegnung mit Jesus und die Handlung mit den Schweinen werden detailliert erläutert.
3. Drewermann nimmt die Erzählung über Jona hinzu: Dieses Kapitel untersucht Drewermanns Einbeziehung der Jona-Erzählung in seine Interpretation. Es wird ein Vergleich zwischen dem Besessenen von Gerasa und Jona gezogen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrem Verhalten und ihren Schicksalen aufzuzeigen. Die Parallelen zwischen den beiden Geschichten werden herausgestellt und in den Kontext von Drewermanns tiefenpsychologischen Ansatz eingeordnet.
4. Die fehlende Diagnose: In diesem Kapitel wird die Frage nach einer medizinischen Diagnose für den Besessenen von Gerasa diskutiert. Es wird kritisch hinterfragt, ob Drewermanns rein tiefenpsychologische Deutung die Möglichkeit einer anderen Erklärung, z.B. einer Krankheit, berücksichtigt. Die Diskussion um die historische und kulturelle Kontextualisierung der Erzählung wird angesprochen und alternative Interpretationsansätze werden angedeutet.
5. Die Antwort auf Drewermanns Tiefenpsychologie: Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit Drewermanns Argumentation auseinander und untersucht die Stärken und Schwächen seiner tiefenpsychologischen Interpretation der Erzählung. Es bewertet, inwiefern die tiefenpsychologischen Konzepte in Bezug auf die biblische Erzählung adäquat sind und ob sie alternative Interpretationen ausschließen.
Schlüsselwörter
Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie, Exegese, Markus-Evangelium, Besessener von Gerasa, Jona, Bibelinterpretation, Symbolismus, Angst, Unbewusstes, Psychologie, Religion, Glaube, Kirche, Dogmatismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Eugen Drewermanns Tiefenpsychologischer Deutung der Markus-Erzählung vom Besessenen von Gerasa
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch Eugen Drewermanns tiefenpsychologische Interpretation der Markus-Erzählung vom Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20). Sie untersucht seine Argumentationsstruktur und beleuchtet sie kritisch, indem sie auch den Bezug zum Jonabuch und die Frage nach einer medizinischen Diagnose mit einbezieht.
Welche Aspekte von Drewermanns Interpretation werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf Drewermanns tiefenpsychologischen Ansatz zur Bibelauslegung, die kritische Auseinandersetzung mit seiner Argumentationsstruktur, den Vergleich der Gerasa-Erzählung mit der Jona-Geschichte, die Rolle von Angst und Unbewusstem in seiner Interpretation und die Frage nach einer alternativen, medizinischen Diagnose.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Drewermanns Ausgangsposition beschreibt, ein Kapitel zur Analyse der Markus-Erzählung, ein Kapitel zum Vergleich mit der Jona-Geschichte, ein Kapitel zur fehlenden medizinischen Diagnose, ein Kapitel zur kritischen Auseinandersetzung mit Drewermanns Tiefenpsychologie und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Rolle spielt die Jona-Erzählung in Drewermanns Interpretation?
Drewermann bezieht die Jona-Erzählung in seine Interpretation mit ein, um Parallelen zwischen dem Besessenen von Gerasa und Jona aufzuzeigen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrem Verhalten und Schicksal im Kontext seiner tiefenpsychologischen Theorie zu beleuchten.
Wird die Möglichkeit einer medizinischen Diagnose berücksichtigt?
Die Arbeit diskutiert kritisch die Frage nach einer medizinischen Diagnose für den Besessenen von Gerasa und hinterfragt, ob Drewermanns rein tiefenpsychologische Deutung alternative Erklärungen, wie z.B. eine Krankheit, ausreichend berücksichtigt. Alternative Interpretationsansätze werden angedeutet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie, Exegese, Markus-Evangelium, Besessener von Gerasa, Jona, Bibelinterpretation, Symbolismus, Angst, Unbewusstes, Psychologie, Religion, Glaube, Kirche, Dogmatismus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Drewermanns Argumentationsstruktur zu untersuchen und kritisch zu beleuchten, um ein umfassendes Verständnis seiner tiefenpsychologischen Deutung der Markus-Erzählung zu ermöglichen und alternative Perspektiven zu eröffnen.
Welche Quellen werden in der Analyse verwendet?
Die Hauptquelle ist die Markus-Erzählung vom Besessenen von Gerasa (Mk 5,1-20), ergänzt durch die Jona-Geschichte und Drewermanns Interpretationen dieser Texte. Die Arbeit bezieht sich auf Drewermanns tiefenpsychologischen Ansatz und dessen Kontextualisierung innerhalb der theologischen und psychologischen Literatur.
- Quote paper
- Dr. Eick Sternhagen (Author), 2008, Eugen Drewermann: Deutung der Erzählung über den Besessenen von Gerasa (Mk 5, 1-20), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115785