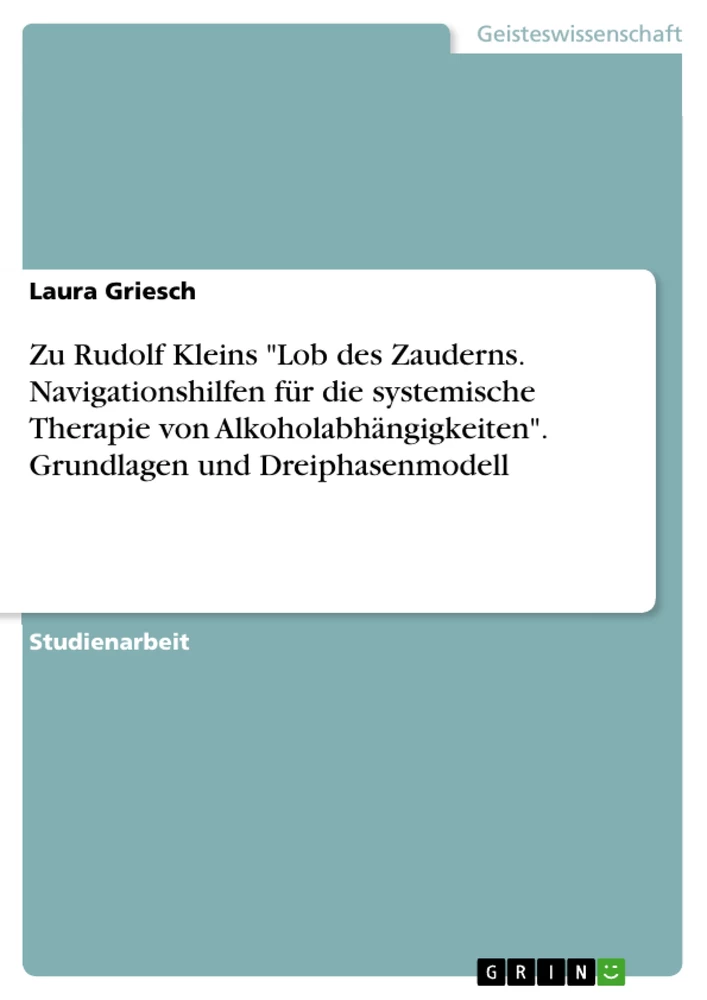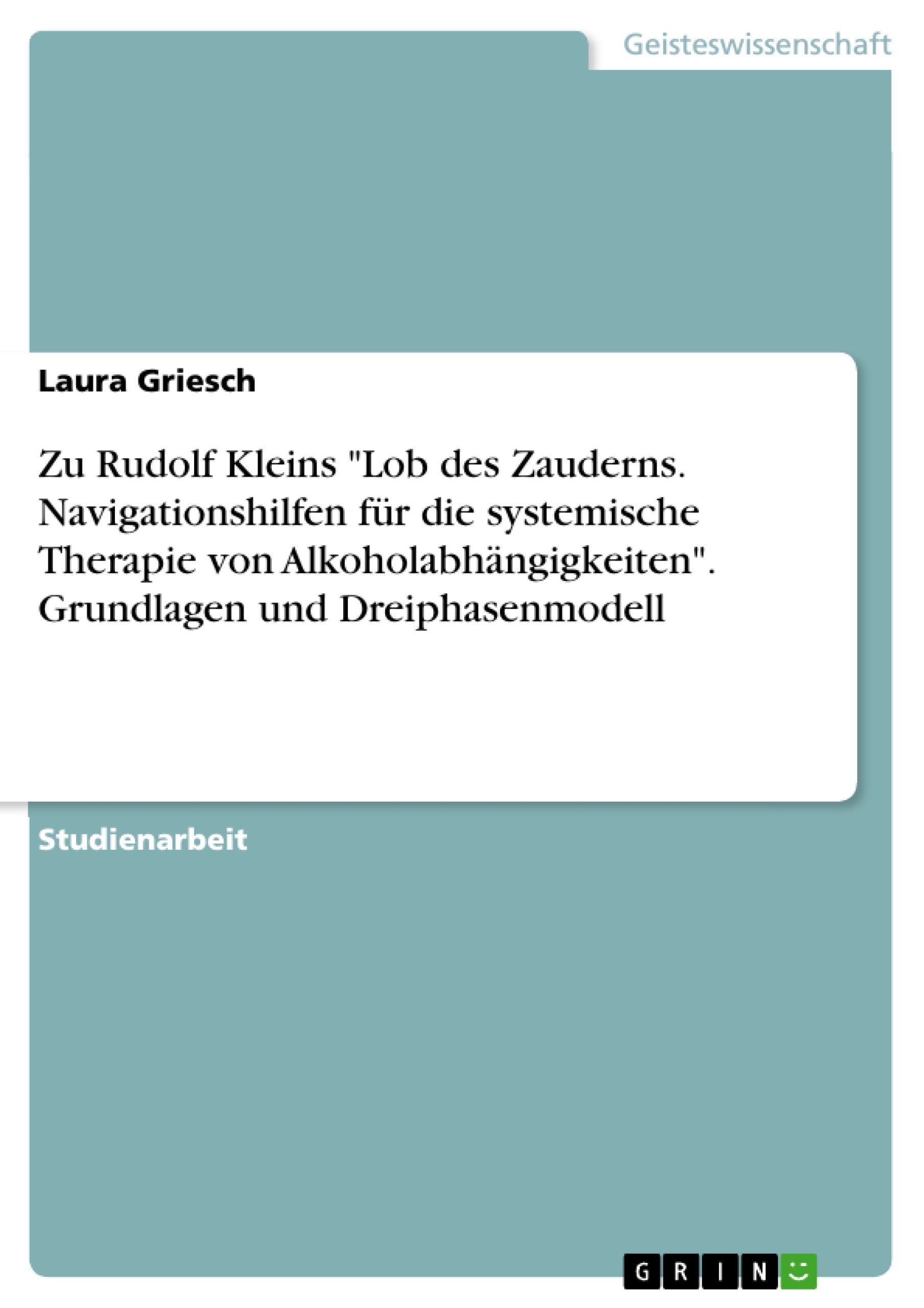Wie können alkoholabhängig trinkenden Menschen unterstützt werden, die aus dem klassischen System des traditionell- medizinischen Suchtmodells herausfallen? Wie können sie im therapeutischen Alltag begleitet werden und wie individuelle Zielsetzungen stärker berücksichtigt werden? Wie können Gewohnheiten, eingespurte Muster verändert werden, die als schlecht bewertet werden? Von sich oder jemanden anderen? Und mit welcher Haltung kann alkoholabhängig trinkenden Menschen begegnet werden, die aus dem “herkömmlichen” System herausfallen? Klein liefert mit seinem gut nachvollziehbaren Therapiemodell eine praktische Navigationshilfe für die Arbeit mit alkoholabhängig trinkenden Menschen und kreiert ein Menschenbild, welches den Menschen hinter dem Symptom zeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Teil I: Lob des Zauderns: Grundlagen
- Traditionell-medizinische Suchtmodell
- Systemtheoretische und Systemtherapeutische Sichtweise
- Von Problemen und Problemsystemen
- Autonome Systeme
- Autonome Systeme und Alkoholabhängigkeit
- Ritualtheoretische Annahmen
- Lebenseinbrüche und Traumata
- Phasenübergänge
- Teil II: Lob des Zauderns: Dreiphasenmodell (DPM)
- Dreiphasenmodell
- 1. Phase: Selbstregulation des Trinkens
- 2. Phase: Individuelle Geschichte
- 3. Phase: Zukünftige Entwürfe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Werk von Rudolf Klein zielt darauf ab, ein alternatives Therapiemodell für alkoholabhängige Menschen zu präsentieren, das über das traditionelle Suchtmodell hinausgeht und die individuellen Ziele und Lebensumstände der Betroffenen stärker berücksichtigt. Es bietet eine praktische Navigationshilfe für Therapeuten und zeigt ein humanes Menschenbild, welches den Menschen hinter dem Symptom in den Mittelpunkt stellt.
- Kritik am traditionellen Suchtmodell und dessen Grenzen
- Systemtheoretische und systemtherapeutische Ansätze in der Behandlung von Alkoholabhängigkeit
- Das Dreiphasenmodell als praktische Methode zur Therapiebegleitung
- Die Bedeutung von individuellen Zielen und Selbstregulation
- Der Umgang mit Lebenseinbrüchen und Traumata im Kontext von Alkoholabhängigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort skizziert die Problematik alkoholabhängiger Menschen, die nicht in das klassische Suchtmodell passen, und hebt die Bedeutung individueller Zielsetzungen und veränderter Gewohnheiten hervor. Es beschreibt Kleins Therapiemodell als praktische Navigationshilfe und betont die Berücksichtigung des Menschen hinter dem Symptom.
Einleitung: Die Einleitung unterstreicht die vielschichtigen Folgen von Alkoholabhängigkeit (biologisch, psychologisch, sozial, ökonomisch) und das damit verbundene Schuld- und Schamgefühl. Sie betont Alkoholabhängigkeit als potenziellen Beginn eines bedeutsamen Wandels und die damit verbundenen Emotionen (Unsicherheit, Angst, Traurigkeit). Zentrale Fragen werden aufgeworfen: Was ersetzt das Suchtmittel? Wer war man vorher? Wer möchte man sein? Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Trinkverhalten und den Beziehungen wird hervorgehoben.
Teil I: Lob des Zauderns: Grundlagen: Dieser Teil des Buches legt die theoretischen Grundlagen für Kleins Therapieansatz dar. Es beginnt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem traditionellen medizinischen Suchtmodell, das den Fokus auf Abstinenz legt und den Betroffenen oft pathologisiert. Klein argumentiert, dass dieses Modell die individuelle Perspektive vernachlässigt und zu Scham und Schuldgefühlen im Falle von Rückfällen führt. Anschließend werden systemtheoretische und systemtherapeutische Perspektiven eingeführt, die die individuellen Ziele und die Systemdynamiken der Betroffenen stärker berücksichtigen. Die Kapitel befassen sich mit der Definition von Problemen und Problemsystemen, der Autonomie individueller Systeme und deren Reaktion auf Reize, sowie der Integration von Alkoholabhängigkeit in diese Systeme. Die Rolle von Ritualen und der Umgang mit Lebenseinbrüchen und Traumata im Kontext von Alkoholabhängigkeit werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Suchtmodell, Systemtherapie, Dreiphasenmodell, Selbstregulation, individuelle Ziele, Lebenseinbrüche, Traumata, Phasenübergänge, Ritualtheorie, Autonome Systeme.
Häufig gestellte Fragen zu "Lob des Zauderns": Ein alternatives Therapiemodell für Alkoholabhängigkeit
Was ist das Hauptthema des Buches "Lob des Zauderns"?
Das Buch präsentiert ein alternatives Therapiemodell für Alkoholabhängigkeit, das über das traditionelle Suchtmodell hinausgeht und die individuellen Ziele und Lebensumstände der Betroffenen stärker berücksichtigt. Es kritisiert das traditionelle Suchtmodell und bietet eine systemtheoretische und systemtherapeutische Perspektive auf die Behandlung von Alkoholabhängigkeit.
Welche Kritik übt das Buch am traditionellen Suchtmodell?
Das Buch kritisiert den Fokus des traditionellen Suchtmodells auf Abstinenz und die damit verbundene Pathologisierung der Betroffenen. Es argumentiert, dass dieses Modell die individuelle Perspektive vernachlässigt und zu Scham und Schuldgefühlen im Falle von Rückfällen führt.
Was ist das Dreiphasenmodell (DPM)?
Das Dreiphasenmodell ist ein praktisches Therapiemodell, das im Buch vorgestellt wird. Es besteht aus drei Phasen: 1. Selbstregulation des Trinkens, 2. Individuelle Geschichte und 3. Zukünftige Entwürfe. Es dient als praktische Methode zur Therapiebegleitung und berücksichtigt die individuellen Ziele und den Lebenskontext des Betroffenen.
Welche Rolle spielen systemtheoretische und systemtherapeutische Ansätze?
Systemtheoretische und systemtherapeutische Ansätze werden als Grundlage für das alternative Therapiemodell verwendet. Sie berücksichtigen die individuellen Ziele und die Systemdynamiken der Betroffenen, statt sich nur auf das isolierte Problem der Alkoholabhängigkeit zu konzentrieren.
Welche Bedeutung haben individuelle Ziele und Selbstregulation im Therapieansatz?
Individuelle Ziele und Selbstregulation spielen eine zentrale Rolle. Das Buch betont die Wichtigkeit, die individuellen Wünsche und Lebensumstände des Betroffenen in den Therapieprozess zu integrieren und die Selbstwirksamkeit zu fördern, anstatt nur auf Abstinenz zu fokussieren.
Wie werden Lebenseinbrüche und Traumata im Kontext von Alkoholabhängigkeit behandelt?
Das Buch beleuchtet die Rolle von Lebenseinbrüchen und Traumata im Zusammenhang mit Alkoholabhängigkeit und integriert deren Bearbeitung in den Therapieansatz. Es wird betont, dass diese Faktoren einen wichtigen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben.
Welche weiteren Themen werden im Buch behandelt?
Zusätzlich zu den oben genannten Themen werden auch die Rolle von Ritualen, Phasenübergänge, die Definition von Problemen und Problemsystemen sowie die Autonomie individueller Systeme im Kontext der Alkoholabhängigkeit behandelt. Das Buch bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten der Alkoholabhängigkeit und deren Behandlung.
Für wen ist dieses Buch gedacht?
Das Buch richtet sich an Therapeuten und alle, die sich mit der Behandlung von Alkoholabhängigkeit auseinandersetzen. Es bietet eine praktische Navigationshilfe und ein humanes Menschenbild, welches den Menschen hinter dem Symptom in den Mittelpunkt stellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Buch relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Alkoholabhängigkeit, Suchtmodell, Systemtherapie, Dreiphasenmodell, Selbstregulation, individuelle Ziele, Lebenseinbrüche, Traumata, Phasenübergänge, Ritualtheorie, Autonome Systeme.
- Quote paper
- Laura Griesch (Author), 2018, Zu Rudolf Kleins "Lob des Zauderns. Navigationshilfen für die systemische Therapie von Alkoholabhängigkeiten". Grundlagen und Dreiphasenmodell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1157856