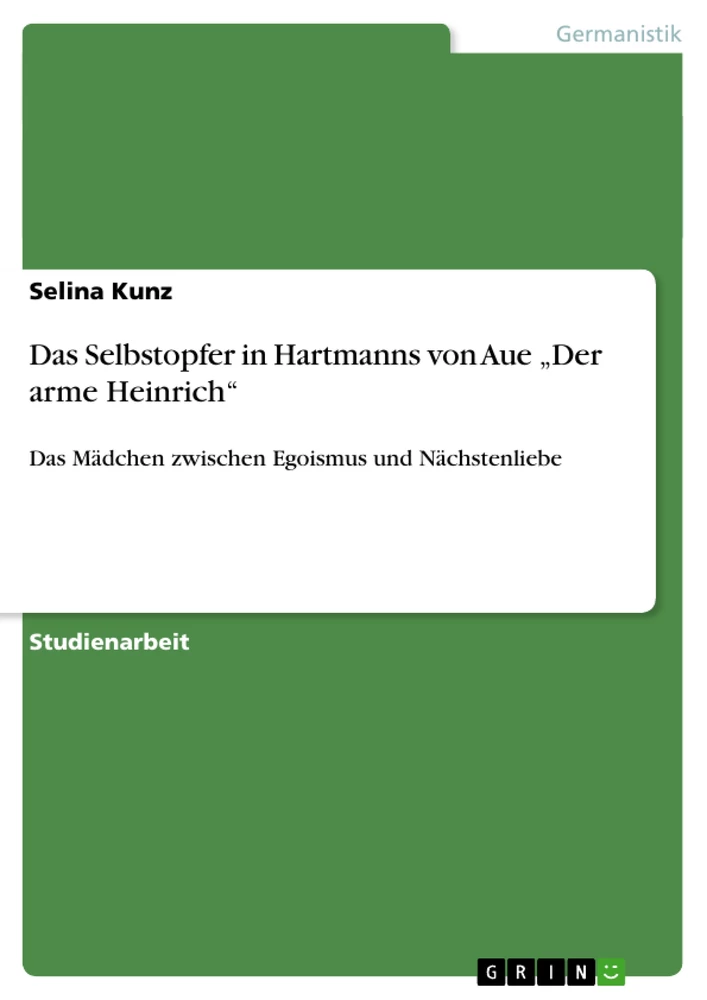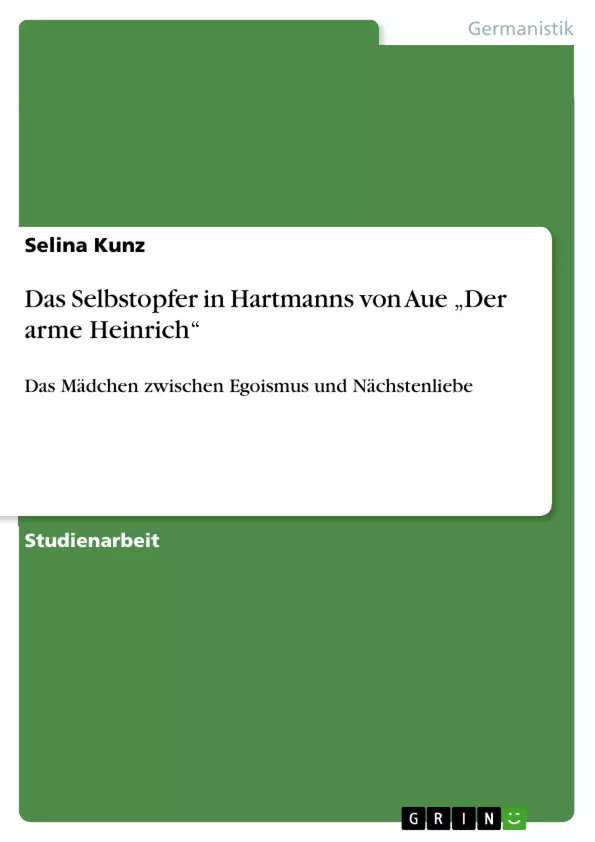In seiner Studie Hartmanns von Aue 'Armer Heinrich' und 'Gregorius' vertritt Christoph Cormeau die These, dass die meisten Interpreten des Werkes Der arme Heinrich das Bauernmädchen lediglich als ‚Beiwerk’ für die Geschichte Heinrichs einschätzen, ihre eigenständige Rolle jedoch nicht wahrnehmen oder sie für unwichtig halten. Dies mag zu einem großen Teil der Tatsache geschuldet sein, dass der Titel des Werkes klar den Ritter Heinrich fokussiert. Sieht man sich aber den Redeanteil des Mädchens innerhalb der Geschichte an, fällt schnell auf, dass dieser Charakter eine große Rolle einnimmt, er dominiert beispielsweise das sogenannte Lehrgespräch in der Mitte des Werkes völlig. Das Kind ist unverzichtbar für den Verlauf der Erzählung, ihre Handlungen sind für die Forschung und den geneigten Leser gleichermaßen von wesentlichem Interesse. Zentral für die Interpretation der Figur ist dabei ihre Beziehung zu Heinrich, da die Meierstochter „[...] trotz ständischer Differenzen als komplementäre Erscheinung zu Heinrich angelegt [ist]“ . Durch ihre Bereitschaft zum Selbstopfer und die zu Grunde liegende Motivation, wird die Rolle der Meierstochter zu einem viel diskutierten Thema innerhalb der mediävistischen Literaturwissenschaft.
Eine umfassende Interpretation der Rolle des Mädchens kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden, da eine solche Analyse viele weitere Teilaspekte, wie etwa ihre Beziehung zu Heinrich oder die Rolle innerhalb der Familie, einschließen müsste.
Die vorliegende Proseminararbeit möchte daher lediglich die Rolle der Meierstochter bezüglich ihrer Motivation zum Selbstopfer darlegen. Dabei soll im folgenden Kapitel zunächst die mittelalterliche Sicht auf das Selbstopfer kurz vorgestellt werden, um die Basis für ein Verständnis der Handlungen der Meierstochter zu schaffen. Den Hauptteil dieser Arbeit sollen dann eine Vorstellung und eine Analyse verschiedener denkbarer Motivationen des Mädchens bilden. Ziel soll es sein, zu erörtern, warum die Meierstochter bereit ist, für den Herren ihrer Familie zu sterben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das Selbstopfer im Mittelalter
- Die Motivation des Mädchens zum Selbstopfer
- Das altruistische Motiv
- Fremdbestimmung
- Egoismus
- Der geistige Wandel des Mädchens
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit analysiert die Motivation des Mädchens in Hartmanns von Aues "Der arme Heinrich" zum Selbstopfer. Der Schwerpunkt liegt auf der Erörterung der Frage, warum die Meierstochter bereit ist, für den Herren ihrer Familie zu sterben. Die Arbeit berücksichtigt verschiedene denkbare Motivationen des Mädchens, die von altruistischen bis hin zu egoistischen Motiven reichen.
- Die Rolle des Selbstopfers im Mittelalter
- Die Darstellung des Mädchens als komplementäre Figur zu Heinrich
- Die Motivation des Mädchens zum Selbstopfer
- Die Auswirkungen des Selbstopfers auf die Handlung
- Die Bedeutung des Mädchens als eigenständiger Charakter
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort beleuchtet die Bedeutung des Mädchens in Hartmanns "Der arme Heinrich" und stellt die These auf, dass das Mädchen eine zentrale Rolle in der Handlung einnimmt. Das Kapitel "Das Selbstopfer im Mittelalter" liefert einen kurzen Überblick über die mittelalterliche Sicht auf das Selbstopfer und die damit verbundenen religiösen und gesellschaftlichen Kontexte. Das Kapitel "Die Motivation des Mädchens zum Selbstopfer" untersucht verschiedene Motivationen des Mädchens, wie etwa Altruismus, Fremdbestimmung und Egoismus, und analysiert die verschiedenen Aspekte ihrer Persönlichkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Selbstopfer, Altruismus, Egoismus, christliche Nächstenliebe, mittelalterliche Gesellschaft, Literaturanalyse, "Der arme Heinrich", Hartmann von Aue, Figureninterpretation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Hartmanns von Aue "Der arme Heinrich"?
Um den Ritter Heinrich, der an Aussatz erkrankt und nur durch das Herzblut einer freiwillig opferbereiten Jungfrau geheilt werden kann.
Warum ist die Meierstochter bereit, sich zu opfern?
Die Arbeit untersucht verschiedene Motive wie Altruismus, religiöse Hingabe, aber auch mögliche egoistische Aspekte (Eintritt ins Paradies).
Wie wurde das Selbstopfer im Mittelalter gesehen?
Es stand im Kontext christlicher Nächstenliebe und religiöser Vorstellungen von Erlösung und Märtyrertum.
Ist das Mädchen nur eine Nebenfigur?
Nein, sie dominiert wichtige Teile der Erzählung (z.B. das Lehrgespräch) und ist für den Handlungsverlauf unverzichtbar.
Was bedeutet "komplementäre Erscheinung" im Werk?
Trotz ständischer Unterschiede sind Heinrich und das Mädchen als Figurenpaar angelegt, deren Entwicklungen eng miteinander verknüpft sind.
- Quote paper
- Selina Kunz (Author), 2008, Das Selbstopfer in Hartmanns von Aue „Der arme Heinrich“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115923