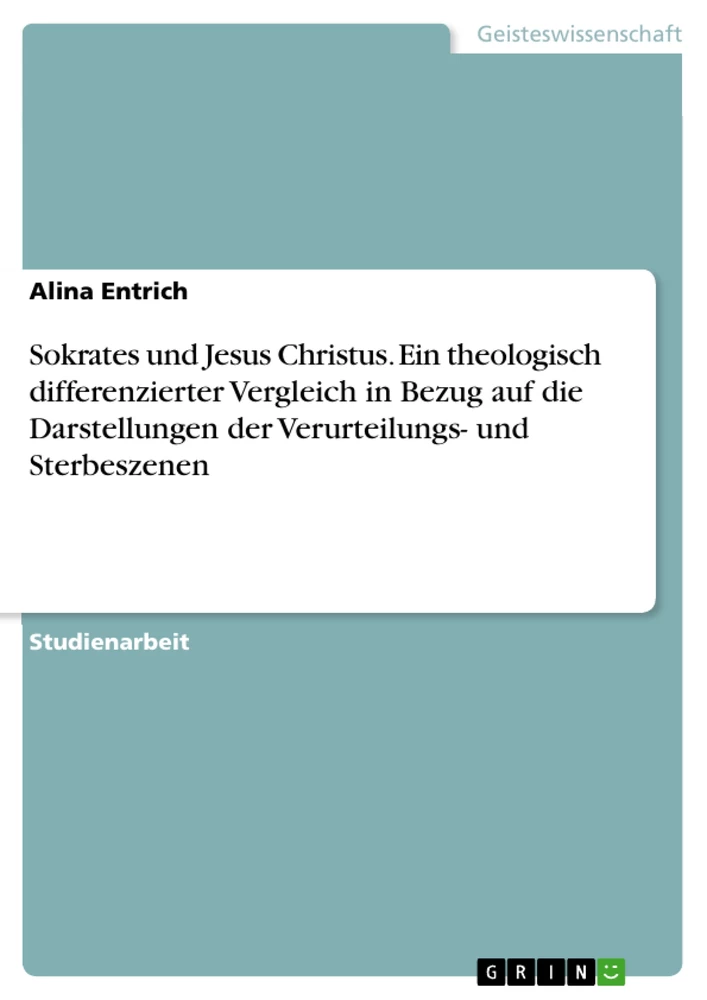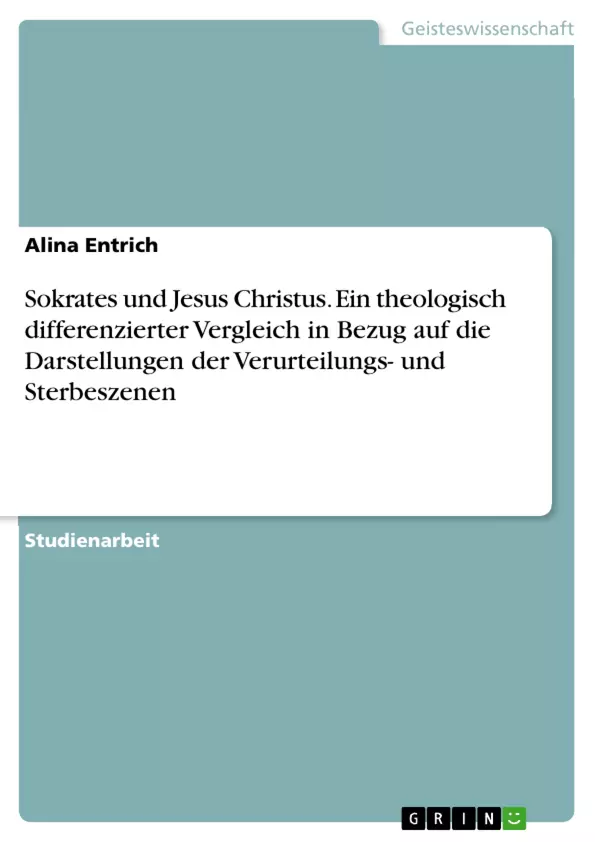Die Hausarbeit bildet einen ausführlichen Vergleich zwischen Sokrates und Jesus ab und stellt die Gemeinsamkeiten wie auch die Unterschiede in den Motiven der Anklagen, der Verurteilungsprozesse sowie das Sterben beider heraus.
Das Ziel dieser schriftlichen Ausarbeitung ist es, die auffällig gleich verlaufende Wirkungsgeschichte zu verdeutlichen und die Besonderheit ihrer Lebensphilosophie aufzuzeigen. Besonders zu erwähnen ist der zeitliche Abstand, welcher zwischen dem Wirken Sokrates und Jesu liegt.
Trotz des markanten Zeitunterschiedes und dem Leben in unter-schiedlichen Kulturen erfahren sie zuletzt dasselbe ungerechte Schicksal, da der Philosoph und der Menschensohn in ihrer Person sowie in ihren Worten zutiefst missverstanden und letztlich zu Tode verurteilt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sokrates
- 2.1 Die „Apologie des Sokrates“ und die Verurteilung vor Gericht
- 2.2 Platon über den Tod des Sokrates in „Phaidon“.
- 3 Jesus Christus.
- 3.1 Die Verurteilung des Sohn Gottes.
- 3.2 Kreuzigung und Tod Jesu im Markusevangelium …….....
- 4 Analogien
- 4.1 Die Motive der Anklagen
- 4.2 Die Verurteilungen.
- 5 Differenzen.
- 5.1 Sterben und Tod ..
- 5.2 Die Auferstehung Jesu Christi
- 6 Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bietet einen detaillierten Vergleich zwischen Sokrates und Jesus Christus, indem sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Motive der Anklagen, die Verurteilungsprozesse und das Sterben beider herausarbeitet. Das Ziel der Arbeit ist es, die auffällig gleich verlaufende Wirkungsgeschichte zu verdeutlichen und die Besonderheit ihrer Lebensphilosophie aufzuzeigen.
- Vergleich der Verurteilungs- und Sterbeszenen von Sokrates und Jesus Christus
- Analyse der Motive der Anklagen und Verurteilungen
- Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Sterben und Tod
- Betrachtung der zeitlichen und kulturellen Unterschiede
- Die Bedeutung der Geschehnisse für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel 2 behandelt den Prozess der Verurteilung und den Tod des griechischen Philosophen Sokrates. Im Fokus steht die platonische Schrift „Apologie des Sokrates“, welche den Vorwurf der Asebie und der Jugendverführung durch Sokrates beleuchtet. Weiterhin wird das Werk „Phaidon“ Platons vorgestellt, welches Einblicke in das Seelenleben und die Religiosität des Philosophen bietet.
Das Kapitel 3 schildert die Geschehnisse rund um Jesus Christus, darunter seine Verurteilung vor dem Synedrium, dem Präfekt Pontius Pilatus und vor dem Volk. Die gewaltsame Kreuzigung und der letzte Aufschrei Jesu werden aus dem Markusevangelium dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Vergleiches zwischen Sokrates und Jesus Christus, der Analyse ihrer Verurteilungen und der Untersuchung ihrer Lebensphilosophie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Asebie, Jugendverführung, Gotteslästerung, Verurteilungsprozess, Sterben, Tod, Auferstehung, Analogien, Differenzen, Wirkungsgeschichte, Lebensphilosophie.
- Citar trabajo
- Alina Entrich (Autor), 2021, Sokrates und Jesus Christus. Ein theologisch differenzierter Vergleich in Bezug auf die Darstellungen der Verurteilungs- und Sterbeszenen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159236