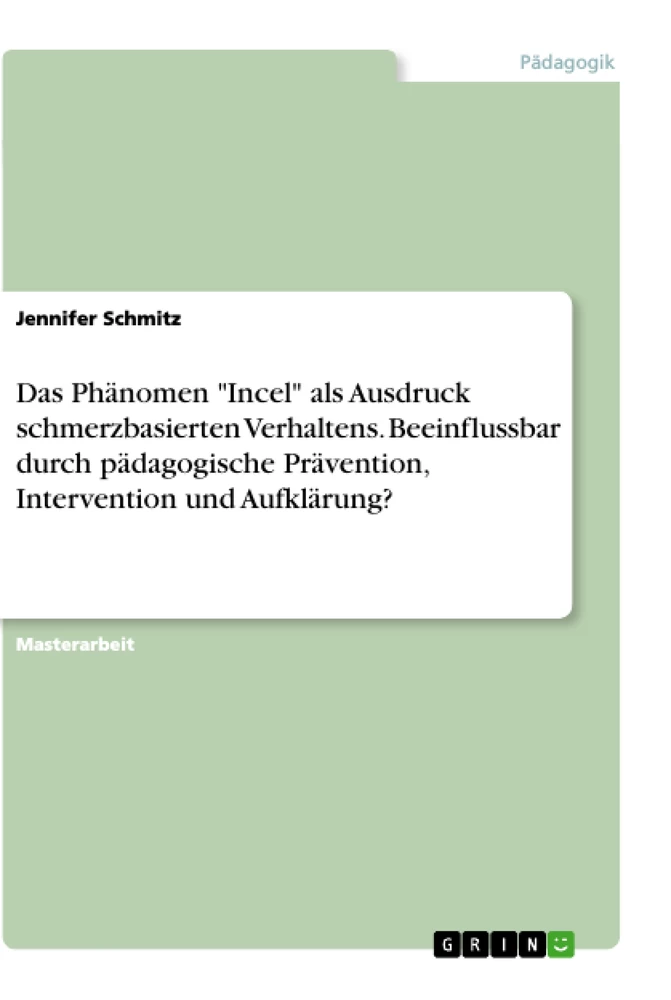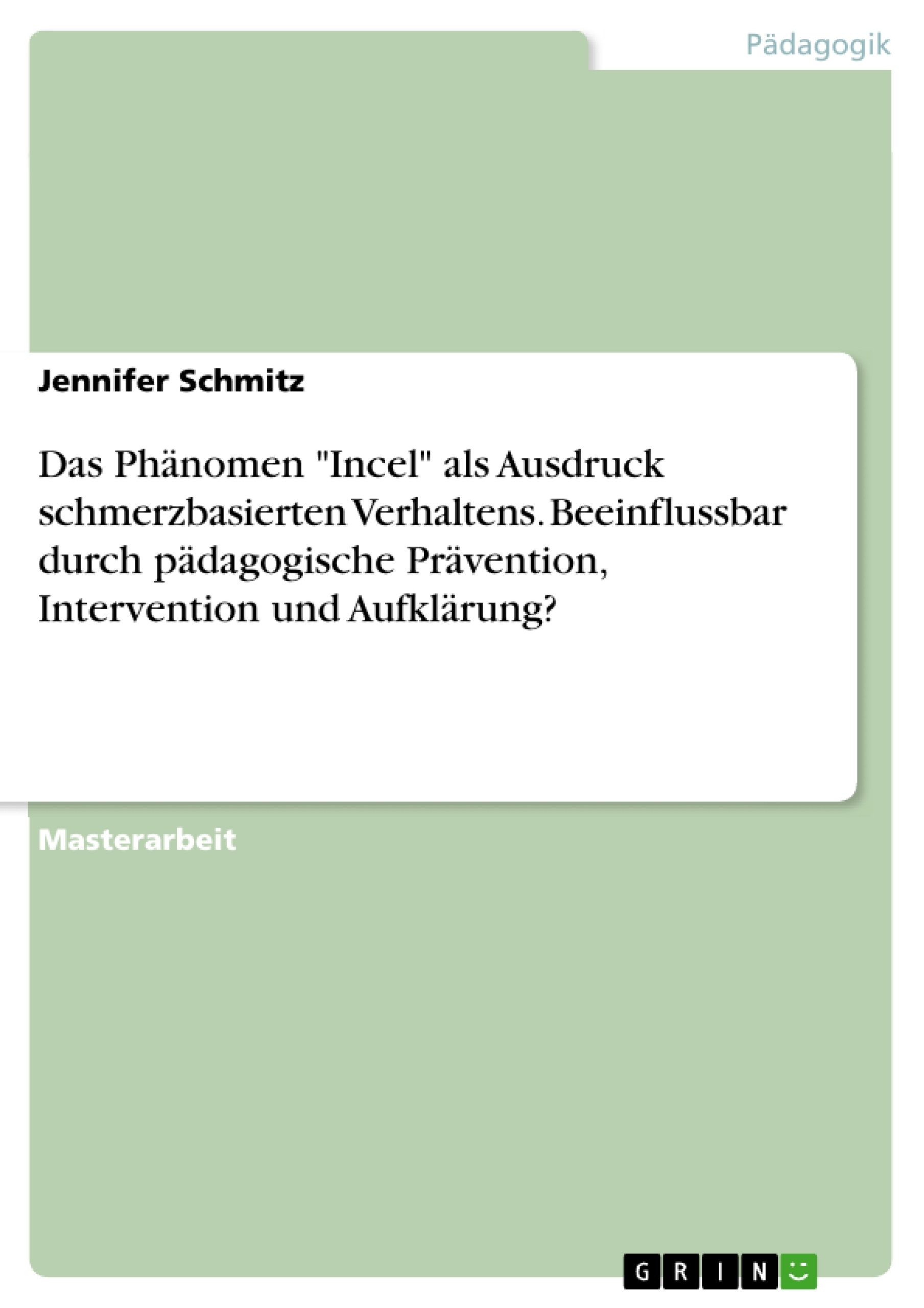Das Forschungsvorhaben dieser Arbeit zielt darauf ab, individuelle Beweggründe und Problemlagen von "Incels" nachzuvollziehen, um aus diesen Rückschlüsse für die pädagogische Praxis abzuleiten. Dazu sollen Beiträge und Kommentare eines "Incel"-Forums genauer untersucht werden.
Aufgrund des hohen Anstiegs an Einsamkeitsbekundungen auch im Kinder- und Jugendbereich sollten sich auch pädagogische Institutionen vermehrt mit dem Thema Einsamkeit und Isolation auseinandersetzen. Ein Phänomen, das sich durch die Abwesenheit von bedeutsamen Beziehungen definieren lässt, ist das der "Incels".
"Incels" sind in den letzten Jahren vermehrt durch ihre auffälligen Verhaltensweisen ins Gespräch geraten, da sie online misogyne Inhalte teilen, Frauen und Minderheiten diskriminieren und teilweise zu Gewalttaten gegen diese aufrufen. Des Weiteren bekundeten bereits einige Attentäter in den USA und in Deutschland ihre Verbindung zur Incelosphäre.
Obwohl das Thema eine gesellschaftliche Relevanz aufweist, wurde bisher nur wenig auf diesem Gebiet geforscht. Die meisten Publikationen zum Thema "Incels" sind auf öffentliche und private Medien zurückzuführen, die gezeigte Verhaltensweisen zwar stark kritisieren, die Entstehung dieser Verhaltensweisen jedoch nur unzureichend beleuchten und nachvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ziele
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Kontextualisierung des Incel-Phänomens
- 2.1.1 Entstehung und Merkmale der Incel-Community
- 2.1.2 Dissozialität
- 2.1.3 Unfreiwilliges Zölibat
- 2.1.4 Blackpill-Ideologie
- 2.1.5 Ambivalenz-Konflikt
- 2.1.6 Digitale Welten
- 2.1.7 Identitätspolitiken
- 2.1.8 Zwischenfazit und Überleitung zur Pädagogik
- 2.2 Das Konzept des schmerzbasierten Verhaltens
- 2.2.1 Definition und Entstehung von Schmerz
- 2.2.2 Sozialer Schmerz und seine Auswirkungen
- 2.2.3 Schmerzbasierte Verhaltensweisen
- 2.1 Kontextualisierung des Incel-Phänomens
- 3. Methodische Umsetzung
- 3.1 Grundlegende Überlegungen zur Methodik dieser Arbeit
- 3.2 Die qualitative Inhaltsanalyse
- 3.3 Definition der Analyseeinheiten
- 3.4 Bildung der Kategorienschemata
- 3.5 Auswertung
- 3.5.1 Subjektivität im Forschungsprozess
- 3.5.2 Allgemeine Befunde
- 3.5.3 Ergebnisse der Ursprungsposts
- 3.5.4 Ergebnisse der Kommentare
- 4. Einordnung und Reflexion
- 4.1 Beantwortung der Forschungsfragen
- 4.2 Reflexion der Ergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Incel-Phänomen und dessen mögliche Verbindung zu schmerzbasierten Verhaltensweisen. Ziel ist es, herauszufinden, ob das beobachtete Verhalten von Incels auf soziale Schmerzerfahrungen zurückgeführt werden kann und daraus Implikationen für die pädagogische Praxis abzuleiten. Die Arbeit betrachtet Parallelen zwischen Incels und Kindern/Jugendlichen im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung.
- Zusammenhang zwischen Incel-Verhalten und sozialen Schmerzerfahrungen
- Analyse von multifaktoriellen Ursachen für Problemlagen innerhalb der Incel-Community
- Ableitung pädagogischer Präventions- und Interventionsmöglichkeiten
- Relevanz der Ergebnisse für die sonderpädagogische Praxis
- Anwendung qualitativer Inhaltsanalyse zur Datenauswertung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau. Es hebt die Relevanz des Themas im Kontext steigender Einsamkeitsgefühle und der Herausforderungen für die Pädagogik hervor.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieser Abschnitt liefert den theoretischen Rahmen für die Untersuchung. Er kontextualisiert das Incel-Phänomen, beleuchtet seine Entstehung, Merkmale (wie Dissozialität, unfreiwilliges Zölibat, Blackpill-Ideologie und Ambivalenzkonflikte), den Einfluss digitaler Welten und Identitätspolitiken. Schließlich wird das Konzept des schmerzbasierten Verhaltens definiert und dessen Relevanz für die Incel-Thematik herausgearbeitet. Der Abschnitt legt die Grundlage für die spätere Analyse, indem er die relevanten theoretischen Konzepte und Zusammenhänge erläutert.
3. Methodische Umsetzung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es erläutert die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz, die Definition der Analyseeinheiten und die Bildung der Kategorienschemata. Der Abschnitt geht detailliert auf die Auswertung der Daten aus dem Online-Forum r/IncelExit ein, einschließlich der Berücksichtigung von Subjektivität im Forschungsprozess. Die Beschreibung der Methodik ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Bewertung der Ergebnisse.
4. Einordnung und Reflexion: Hier werden die Ergebnisse der Analyse eingeordnet und reflektiert. Die Forschungsfragen werden beantwortet und die gewonnenen Erkenntnisse werden im Kontext der bisherigen Forschung diskutiert. Es wird eine kritische Reflexion der Methodik und der Ergebnisse vorgenommen, um die Grenzen und den Erkenntnisgewinn der Studie zu beleuchten. Die Reflexion dient der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und ihrer Interpretation.
Schlüsselwörter
Incel-Phänomen, sozialer Schmerz, schmerzbasiertes Verhalten, pädagogische Prävention, pädagogische Intervention, qualitative Inhaltsanalyse, Online-Community, Dissozialität, unfreiwilliges Zölibat, digitale Welten, Identitätspolitik, Sonderpädagogik, emotionale und soziale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Incel-Phänomen und schmerzbasierte Verhaltensweisen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht das Incel-Phänomen und dessen mögliche Verbindung zu schmerzbasierten Verhaltensweisen. Im Fokus steht die Frage, ob das Verhalten von Incels auf soziale Schmerzerfahrungen zurückzuführen ist und welche Implikationen sich daraus für die pädagogische Praxis ableiten lassen. Vergleichende Aspekte zu Kindern/Jugendlichen im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung werden ebenfalls betrachtet.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, den Zusammenhang zwischen Incel-Verhalten und sozialen Schmerzerfahrungen zu erforschen, multifaktorielle Ursachen für Problemlagen innerhalb der Incel-Community zu analysieren und daraus pädagogische Präventions- und Interventionsmöglichkeiten abzuleiten. Die Relevanz der Ergebnisse für die sonderpädagogische Praxis wird ebenfalls untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Incel-Verhalten und sozialen Schmerzerfahrungen, der Analyse multifaktorieller Ursachen in der Incel-Community, der Ableitung pädagogischer Präventions- und Interventionsmöglichkeiten, der Relevanz der Ergebnisse für die sonderpädagogische Praxis und der Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse zur Datenauswertung.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz zur Auswertung von Daten aus dem Online-Forum r/IncelExit. Die Methodik umfasst die Definition von Analyseeinheiten, die Bildung von Kategorienschemata und die detaillierte Beschreibung des Auswertungsprozesses, einschließlich der Berücksichtigung von Subjektivität im Forschungsprozess.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Zielsetzung und Aufbau), Theoretischer Hintergrund (Kontextualisierung des Incel-Phänomens und des Konzepts schmerzbasierten Verhaltens), Methodische Umsetzung (Beschreibung der qualitativen Inhaltsanalyse), Einordnung und Reflexion (Beantwortung der Forschungsfragen und kritische Reflexion der Ergebnisse) und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Incel-Phänomen, sozialer Schmerz, schmerzbasiertes Verhalten, pädagogische Prävention, pädagogische Intervention, qualitative Inhaltsanalyse, Online-Community, Dissozialität, unfreiwilliges Zölibat, digitale Welten, Identitätspolitik, Sonderpädagogik, emotionale und soziale Entwicklung.
Welche theoretischen Konzepte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Incel-Phänomen mit seinen Merkmalen (Dissozialität, unfreiwilliges Zölibat, Blackpill-Ideologie, Ambivalenzkonflikte), den Einfluss digitaler Welten und Identitätspolitiken. Weiterhin wird das Konzept des schmerzbasierten Verhaltens definiert und dessen Relevanz für die Incel-Thematik herausgearbeitet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden im Kapitel "Einordnung und Reflexion" präsentiert und im Kontext der bisherigen Forschung diskutiert. Die Forschungsfragen werden beantwortet und eine kritische Reflexion der Methodik und der Ergebnisse erfolgt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Sonderpädagogen, Sozialwissenschaftler und alle, die sich mit dem Incel-Phänomen, sozialen Problemen, Online-Communities und der Prävention von Gewalt auseinandersetzen.
Wo finde ich die vollständigen Ergebnisse?
Die vollständigen Ergebnisse der Masterarbeit sind in der vollständigen Arbeit enthalten (nicht in diesem FAQ).
- Arbeit zitieren
- Jennifer Schmitz (Autor:in), 2021, Das Phänomen "Incel" als Ausdruck schmerzbasierten Verhaltens. Beeinflussbar durch pädagogische Prävention, Intervention und Aufklärung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159296