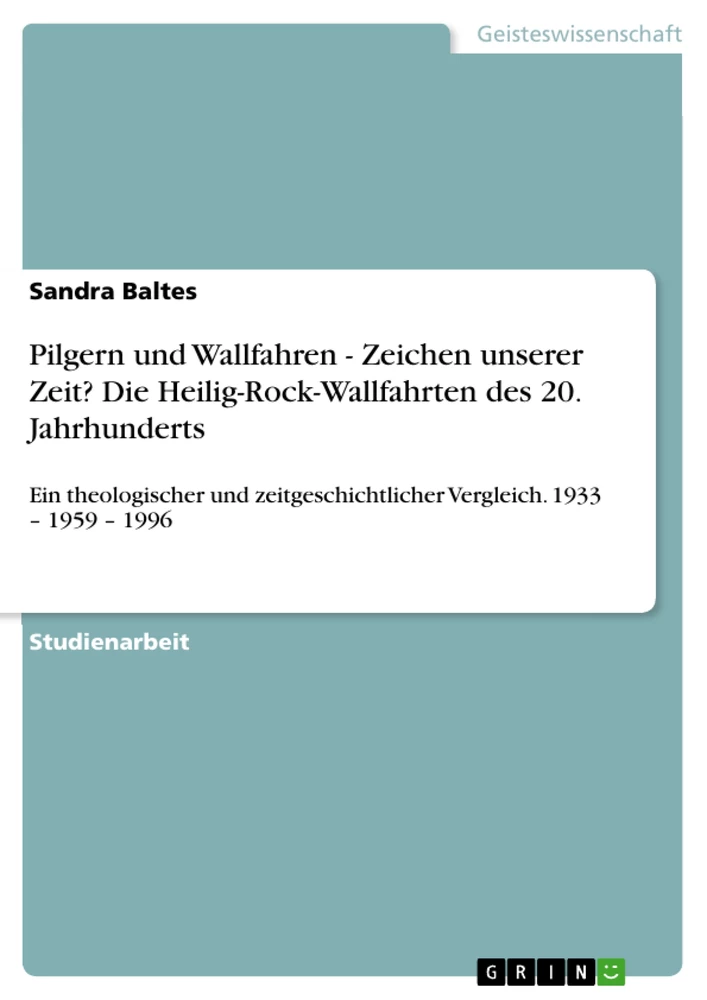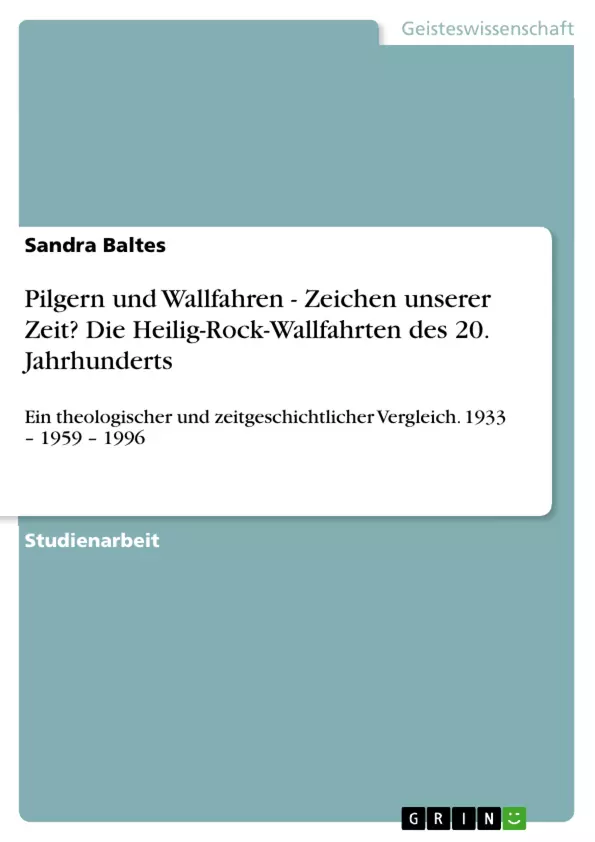Menschen pilgern seit Jahrhunderten gar Jahrtausenden, sie machen sich auf den Weg und durchbrechen damit ihren Alltag. Im Jahr 2012 wird dieses Thema auch für unser Bistum Trier wieder aktuell, wenn Menschen in die Bistumsstadt kommen, um die Heilig-Rock-Wallfahrt zu feiern. Dieser aktuelle Anlass war auch für mich unter anderem ein Beweggrund, an dem Seminar „Pilgern und Wallfahren – Zeichen unserer Zeit?“ teilzunehmen.
Abgesehen von der Vorbereitung auf die Bistumswallfahrt war im Vorfeld des Seminars allgemein meine Motivation ausschlaggebend, mehr über das Thema im Generellen zu erfahren. Dies sollte vor allen Dingen aus einer pastoraltheologischen Perspektive geschehen, über meine eigenen, bisher gemachten Erfahrungen hinausgehen und auch Erkenntnisse anderer Wissenschaften wie beispielsweise der Soziologie einbeziehen. Pilgerreisen und Wallfahrten sind heutzutage nicht mehr rein auf den kirchlichen Bereich zentriert, auch die Tourismusbranche hat sich dieses Feld zu Eigen gemacht. Hier stellte sich mir die Frage, welche Ziele dabei verfolgt werden und wo die Gemeinsamkeiten und vor allem auch die Unterschiede liegen.
Sicherlich sind Pilger- und Wallfahrten immer auch Formen des gelebten Glaubens, auch im Hinblick auf die Heilig-Rock-Wallfahrt 2012. Fraglich ist jedoch, ob sie auch eine Form von Spiritualität darstellen oder mehr und mehr zu religiösen Events verkommen. Im Rahmen des Seminars war es mir ein Anliegen durch den gegenseitigen Erfahrungsaustausch verschiedene Formen von Wallfahrten und Pilgerreisen kennenzulernen, vor allem auch hinsichtlich bestimmter Kriterien, die uns aufzeigen, welche Form für wen ansprechend ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 | ERWARTUNGSHORIZONT UND ERGEBNISREFLEXION.
- 1|1 Erwartungshorizont.........
- 1 | 2 Ergebnisreflexion ...........
- 2| PRAKTISCHER TEIL..
- 2|1 Dokumentation der Sitzungsvorbereitung und —durchführung
- 2|2 Dokumentation des Praxiskontaktes.
- 3 | INHALTLICHER BEITRAG.........
- 3|1 Titel.
- 3|2 Inhaltsverzeichnis .......
- 3|3 Ausgearbeiteter Referatstext..
- 3|3|1 Hinführung
- 3|3|2 Die Heilig-Rock-Wallfahrten des 20. Jahrhunderts
- 3|3|2|1 Heilig-Rock-Wallfahrt 1933 - „braune Schatten verdunkeln den Dom\"
- 3|3|2|2 Heilig-Rock-Wallfahrt 1959 – „ein hochgestimmtes Christusfest“ ...
- 3|3|2|3 Heilig-Rock-Wallfahrt 1996 - „mit Christus auf dem Weg ins dritte Jahrtausend”
- 3|4 Einordnung in die Gesamtthematik des Seminars ………………………..
- Entwicklung der Heilig-Rock-Wallfahrten im 20. Jahrhundert
- Theologische und zeitgeschichtliche Hintergründe der Wallfahrten
- Veränderungen in Liturgie, Organisation und Ökumene
- Bedeutung der Wallfahrten im Kontext des Pilgerbooms
- Das Verhältnis von Spiritualität und religiösen Events im Kontext von Wallfahrten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Heilig-Rock-Wallfahrten im 20. Jahrhundert, um die Entwicklungen dieser religiösen Tradition im Kontext der jeweiligen Zeitgeschichte zu beleuchten und einen theologischen Vergleich zwischen den Wallfahrten von 1933, 1959 und 1996 zu ermöglichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Seminararbeit befasst sich mit dem Erwartungshorizont und der Ergebnisreflexion des Seminars „Pilgern und Wallfahren – Zeichen unserer Zeit?“. Der Autor schildert seine persönliche Motivation, an dem Seminar teilzunehmen und die Bedeutung des Themas in seiner Zeit als Priesteranwärter im Bistum Trier. Im zweiten Teil geht es um die Dokumentation der Sitzungsvorbereitung und -durchführung sowie des Praxiskontaktes. Der dritte Teil beinhaltet den inhaltlichen Beitrag des Autors und konzentriert sich auf die Ausarbeitung seines Referates „Die Heilig-Rock-Wallfahrten im 20. Jahrhundert. Ein theologischer und zeitgeschichtlicher Vergleich. 1933 – 1959 – 1996”. In diesem Referat werden die verschiedenen Ausgestaltungen der Heilig-Rock-Wallfahrten vor dem jeweiligen zeitgeschichtlichen Hintergrund beleuchtet und dargestellt.
Schlüsselwörter
Heilig-Rock-Wallfahrt, Pilgern, Wallfahren, Zeitgeschichte, Theologie, Vergleich, Liturgie, Organisation, Ökumene, Pilgerboom, Spiritualität, religiöse Events, Bistum Trier, 20. Jahrhundert, 1933, 1959, 1996.
Häufig gestellte Fragen
Welche Heilig-Rock-Wallfahrten werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit untersucht und vergleicht die Heilig-Rock-Wallfahrten der Jahre 1933, 1959 und 1996 im Bistum Trier.
Was war die Besonderheit der Wallfahrt im Jahr 1933?
Die Wallfahrt von 1933 stand unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Machtergreifung, was in der Arbeit als „braune Schatten verdunkeln den Dom“ thematisiert wird.
Welche Rolle spielt die Tourismusbranche beim modernen Pilgern?
Pilgerreisen sind heute nicht mehr rein kirchlich zentriert; die Tourismusbranche nutzt das Thema ebenfalls, was die Frage nach der Grenze zwischen Spiritualität und religiösem Event aufwirft.
Was ist der Unterschied zwischen Pilgern und einem religiösen Event?
Die Arbeit hinterfragt, ob moderne Wallfahrten noch echte Spiritualität vermitteln oder zunehmend zu kommerzialisierten Großveranstaltungen ohne tiefen religiösen Kern werden.
Welche wissenschaftlichen Perspektiven bezieht der Autor ein?
Neben der pastoraltheologischen Perspektive werden auch Erkenntnisse aus der Soziologie und der Zeitgeschichte berücksichtigt.
- Citar trabajo
- Sandra Baltes (Autor), 2011, Pilgern und Wallfahren - Zeichen unserer Zeit? Die Heilig-Rock-Wallfahrten des 20. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159906