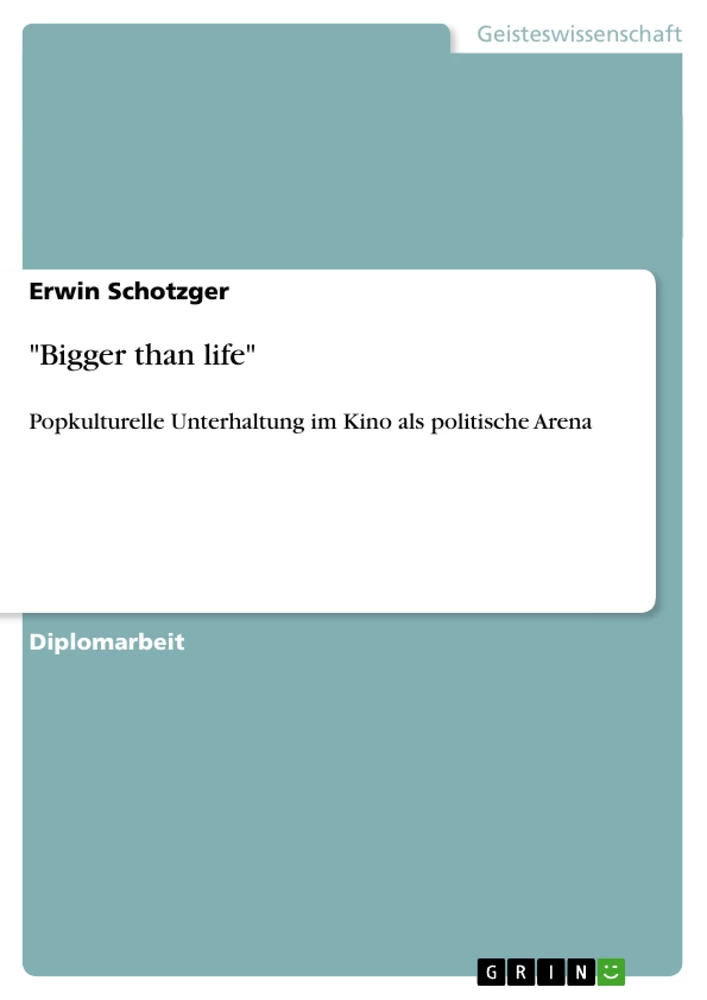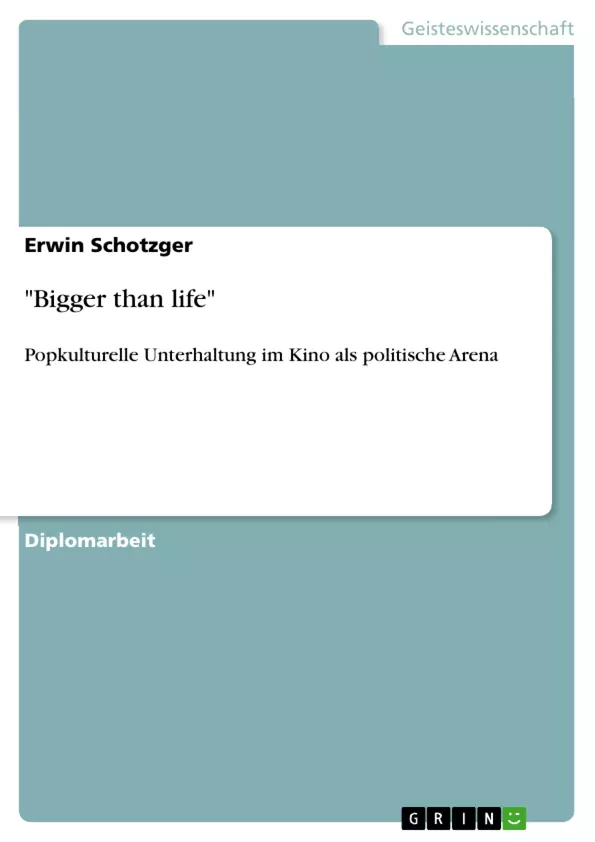Der Vergleich der Beatles mit Jesus Christus löste 1966 heftige Proteste in den USA aus. Die Beatles und ihr Sänger John Lennon sahen sich genötigt, eine Pressekonferenz in Chicago an den Anfang ihrer US-Tour zu stellen, um den aus dem Zusammenhang eines Interviews gerissenen Vergleich zu erklären und sich zu entschuldigen. Lennon sagte, er habe das Fernsehen gemeint bzw. die „Beatles“ wie sie von den Leuten gesehen werden. Er habe damit aus seiner eigenen Erfahrung sagen wollen, dass die „Beatles“ als Medienprodukt den Jugendlichen in England damals mehr bedeutet hätten als Jesus oder die Religion, so Lennon auf der Pressekonferenz. Seit dieser Aussage des Beatles-Sängers im Jahr 1966 ist – vor allem mit Blick auf die Populärkultur - vieles passiert. Lennon ist heute eine Ikone der Populärkultur, Rock- und Popmusik sind ebenso wenig verschwunden wie Religion und Christentum. Populärkultur ist heute jedoch allgegenwärtig. Die Beatles und andere „Popstars“ – wie sie heute genannt werden – waren 1966 wie auch das Fernsehen noch ein relativ neues Phänomen. Heute prägen das Fernsehen und Populärkultur (wovon Popmusik nur ein Teilbereich ist) den Lebensalltag in der Mediendemokratie. Medienprominenz vom Moderator über Schauspieler, Musiker, Politiker bis hin zu fiktiven Figuren besuchen uns täglich in unseren Wohnzimmern, kommunizieren mit uns via Radio, Internet oder Presse. Kritiker verweisen auf den zunehmend dominanten Unterhaltungscharakter der medial produzierten Öffentlichkeit („Unterhaltungsöffentlichkeit“). Dieser Trend zur Unterhaltung ist in den vergangenen Jahren zunehmend vor dem Hintergrund der Entpolitisierung diskutiert worden: der Entpolitisierung von Öffentlichkeit wie auch der Entpolitisierung von Politik selbst zur rein Effekt haschenden Show-Politik. Jugend und Unterhaltung waren in den vergangenen Jahren in der Diskussion um die zunehmende Politikverdrossenheit in modernen Mediengesellschaften meist der Sündenbock oder zumindest einer der üblichen Verdächtigen, wenn es darum ging, die Ursachen für diese Entwicklung zu ergründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfragen
- Thesen
- Zum Politikbegriff
- Traditioneller Politikbegriff
- Entgrenzter Politikbegriff
- Politik – Kultur – Politische Kultur
- Politik- und Demokratiemodelle
- Abschied von der Parteiendemokratie
- Wandlung der Parteiendemokratie
- Mediatisierung
- Beschleunigung
- Distanzierung bzw. Entfremdung
- Bildkultur
- Deliberative Demokratie?
- Das Modell der deliberativen Demokratie
- Kritik am deliberativen Demokratiemodell
- Ungleichheit und diskursive Macht
- Diskursbegriff
- Privilegierung der Vernunft als Grundlage politischer Entscheidung
- Exkurs: Fragwürdiger Gegensatz Vernunft/ Emotion
- Vernunft Gefühl
- Gefühle als Faktoren der Urteilsbildung
- Zwischenresümee
- Mediendemokratie
- Massenmediale Öffentlichkeit
- Inszenierungspotenzial als Zugangskriterium
- Komplexitätsreduktion
- Symbolisierung und Personalisierung
- Personalisierung
- Unterhaltungsöffentlichkeit
- Rezeption von Unterhaltung
- Identitätsbezug von Unterhaltung
- Fiktionale Unterhaltung und Realität
- Populärkultur und populäre Urteilskraft
- Populärkultur, Bedeutung und Widerstand
- Politik und Populärkultur
- Populäre Urteilskraft
- Popkulturelle Unterhaltung im Kino als politische Arena
- Fragestellung und Methode
- Politische Diskurse im Kino am Beispiel der Neoliberalismus-Debatte
- Zum Begriff Neoliberalismus
- Diskursiver Kontext
- Filmanalysen
- Fiktionaler Film
- Zum Film,,Fight Club"
- Inhalt
- Medienreaktionen
- Hintergrund und Entstehung
- Zum Film,,Die fetten Jahre sind vorbei"
- Inhalt
- Hintergrund und Entstehung
- Medienreaktionen
- Identität und der Wert des Menschen
- Fight Club: Ikea-Nestbautrieb und Selbsthilfegruppen
- Fight Club: Formel zum Wert des Menschen
- Fight Club: Sinnstiftung und Vereinfachung im Fight Club
- Die fetten Jahre: Private Revolten als Identitätsprojekte
- Die fetten Jahre: Erdrückende Ungleichheit
- Demontage neoliberaler Rhetorik und Metaphern
- Fight Club: Besprechungsszene
- Fight Club: Leere Versprechungen
- Die fetten Jahre sind vorbei: Semiotischer Gegenangriff
- Moralische Demontage des Systems
- Rebellion und Widerstand im Film als Indikator einer Politisierung
- Rebellion der Widersprüche
- Widerstand und Gewalt
- Dokumentarfilm
- Fahrenheit 9/11
- Inhalt
- Zur Person Michael Moore
- Medien und diskursiver Kontext
- Filmanalyse Fahrenheit 9/11
- Konstruktion einer kohärenten Geschichte
- Inszenierte Emotionalität
- Dramaturgie des Bildes
- Mediensozialisation und Verschwörungstheorien
- Michael Moore und die Folgen
- Politisches Interesse und Aktivität im Modus der Unterhaltung
- Befunde zu Fragestellung und Thesen
- Forschungsfrage 1: Kann Unterhaltung politische Informationen vermitteln?
- Forschungsfrage 2: Kann Unterhaltung politische Diskurse beeinflussen?
- Forschungsfrage 3: Findet eine Politisierung der Populärkultur statt, die Unterhaltung zunehmend zu einer politischen Arena macht?
- These 1: Neues Politikverständnis jenseits des politisch-administrativen Systems
- These 2: Politisierung der Populärkultur durch die Diskrepanz zwischen politisch verkündeter und alltäglicher Realität
- Resümee: Unterhaltung und Politik
- Literatur
- Verwendete Abkürzungen
- Bildernachweis
- Politisierung der Populärkultur
- Rolle der Unterhaltung im Kino als politische Arena
- Einfluss von Filmen auf politische Diskurse
- Mediatisierung von Politik und die Rolle der Unterhaltungsöffentlichkeit
- Vermittlung von politischen Informationen durch Unterhaltung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „Bigger than life“ untersucht die Rolle der popkulturellen Unterhaltung im Kino als politische Arena. Sie analysiert, wie fiktionale und dokumentarische Filme politische Diskurse beeinflussen und zu einer Politisierung der Populärkultur beitragen können. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie Unterhaltung politische Informationen vermitteln und politische Diskurse beeinflussen kann. Sie analysiert die mediale Inszenierung von Politik und die Rolle der Unterhaltungsöffentlichkeit in der politischen Meinungsbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfragen und Thesen der Arbeit vor. Sie skizziert den Forschungsstand und die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Politikbegriff und beleuchtet verschiedene Ansätze, die den Begriff des Politischen erweitern und den Einfluss von Kultur und Populärkultur auf politische Prozesse betonen. Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Politik- und Demokratiemodelle, insbesondere die Herausforderungen der Parteiendemokratie im Kontext der Mediatisierung und die Debatte um die deliberative Demokratie. Es wird die Rolle von Emotionen und Vernunft in der politischen Urteilsbildung diskutiert und die Bedeutung der Mediendemokratie für die politische Meinungsbildung beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Konzept der Populärkultur und ihrer Bedeutung für die politische Urteilskraft. Es wird die Frage diskutiert, ob und wie Populärkultur politische Diskurse beeinflussen kann und welche Rolle sie für die politische Meinungsbildung spielt. Das fünfte Kapitel analysiert die Rolle der popkulturellen Unterhaltung im Kino als politische Arena. Es werden verschiedene Filme, sowohl fiktionale als auch dokumentarische, untersucht, die sich mit politischen Themen auseinandersetzen und die Neoliberalismus-Debatte als Beispiel für die politische Relevanz von Unterhaltung im Kino beleuchten.
Das sechste Kapitel fasst die Befunde der Arbeit zusammen und beantwortet die Forschungsfragen. Es wird die Frage diskutiert, ob und wie Unterhaltung politische Informationen vermitteln und politische Diskurse beeinflussen kann. Das siebte Kapitel bietet ein Resümee der Arbeit und zieht Schlussfolgerungen für die Rolle der Unterhaltung in der politischen Arena. Die Arbeit schließt mit einem Literaturverzeichnis und einem Bildernachweis.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Populärkultur, Unterhaltung, Kino, Politik, Neoliberalismus, Mediatisierung, Demokratie, Deliberation, politische Urteilskraft, politische Diskurse, Filmanalyse, Mediendemokratie, politische Arena, politische Meinungsbildung.
- Citar trabajo
- Mag. phil. Erwin Schotzger (Autor), 2006, "Bigger than life", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115992