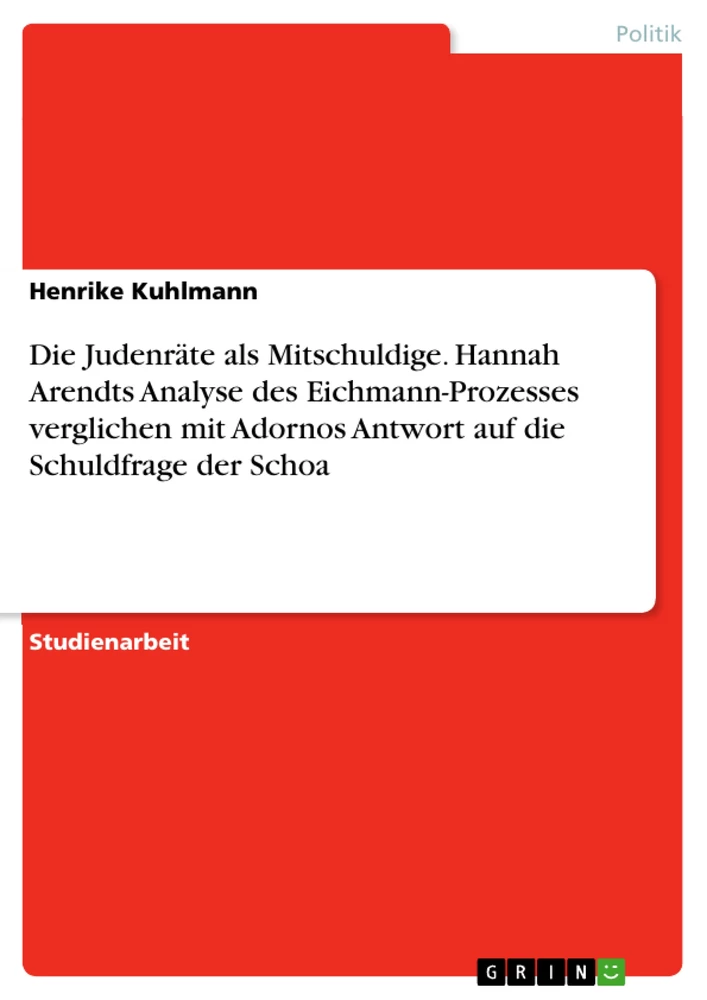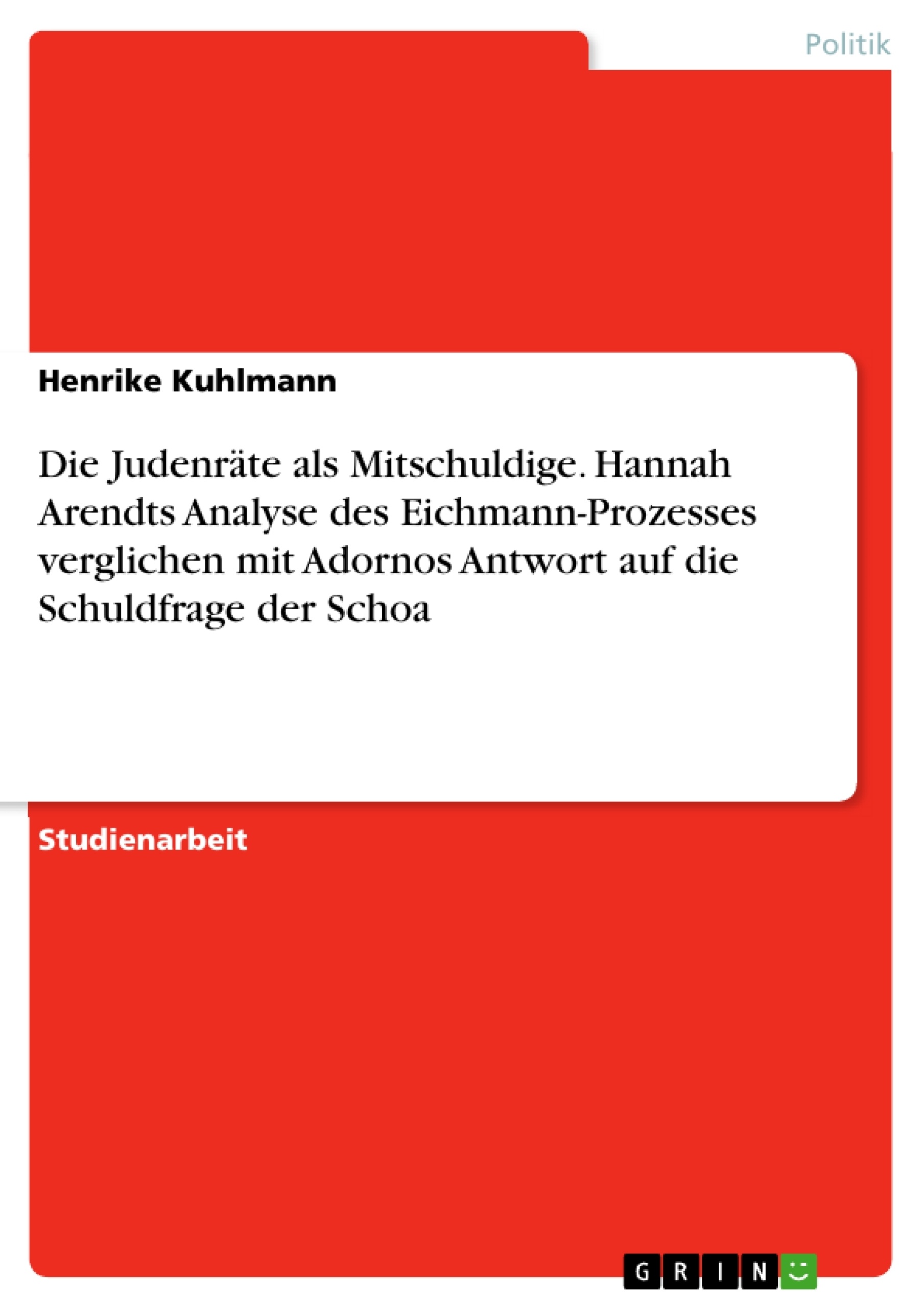Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Führung in Deutschland stellen sich Politiktheoretiker:innen bis heute die Frage, wie es zu dieser organisierten Massenvernichtung an den Jüd:innen, der Schoa, kommen konnte. Dabei steht auch die Frage im Raum, wer für diese grausamen Taten schuldig gesprochen werden kann. Eine öffentliche Diskussion über die Schuldfrage in Bezug auf die Verantwortung von Judenräten kam zum ersten Mal im Zuge des Gerichtsverfahrens gegen Adolf Eichmann 1961 in der Wissenschaft und der intellektuellen Welt auf.
Hannah Arendt eröffnete diese Debatte, indem sie in einem Bericht über den Prozess Adolf Eichmanns in Israel die oben genannte eröffnende Frage stellte. Sie beschäftigt die Schuldfrage derjenigen Jüd:innen, die vom nationalsozialistischen Regime (Abk. NS-Regime) Entscheidungsmacht übertragen bekommen haben. Auch der jüdische Philosoph Theodor W. Adorno findet einen klaren Standpunkt bezüglich der von Hannah Arendt gestellten Schuldfrage in seinem Essay "Erziehung nach Auschwitz". Obwohl die beiden Theoretiker:innen mit ihrer Auswanderung ins Exil in die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkrieges vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, fallen ihre persönlichen Antworten auf die Frage nach der Schuld an der Schoa sehr unterschiedlich aus.
In ihrem Bericht bespricht Hannah Arendt den Eichmann-Prozess und geht in erster Linie auf die Anklage des Nationalsozilisten Adolf Eichmann ein. Das Kapitel "Die Wannseekonferenz oder Pontius Pilatus", in dem Arendt auf die Schulfrage der Jüd:innen eingeht, steht in dieser Arbeit im Vordergrund. Vergleichend dazu bildet der Essay Erziehung nach Auschwitz von Adorno die Hauptliteratur dieser Arbeit. Eine wichtige Sekundärquelle ist das Buch "Gericht und Gedächtnis. Der deutschsprachige Holocaust der sechziger Jahre" von Mirjam Wenzel.
Es geht in dieser Hausarbeit nicht darum, eine Antwort auf die von Hannah Arendt gestellte Frage zu finden, sondern die Argumentation von Arendt zu erläutern und die gegensätzliche Theorie Adornos mit Arendts Aussagen in Bezug zu setzen, denn schließlich ergänzen sich beide Theorien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Theoretiker und die Theoretikerin
- Hannah Arendt - der Weg zur Berichterstatterin des Eichmannprozesses
- Beantwortung der Schuldfrage der Judenräte nach Hannah Arendt
- Adorno - Seine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus
- Die Beantwortung der Schuldfrage in Erziehung nach Auschwitz
- Hannah Arendt - der Weg zur Berichterstatterin des Eichmannprozesses
- Die berichtende Richterin und der gesellschaftliche Erzieher – ein Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die unterschiedlichen Perspektiven von Hannah Arendt und Theodor W. Adorno auf die Schuldfrage der Judenräte während der Schoa. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie beide Theoretiker:innen die Verantwortung von jüdischen Führungspersonen im Kontext des nationalsozialistischen Regimes verstehen.
- Die Schuldfrage der Judenräte im Eichmann-Prozess
- Hannah Arendts Analyse der "Banalität des Bösen"
- Adornos Kritik an der Schuldfrage und sein Konzept der Erziehung nach Auschwitz
- Der Vergleich der beiden Theorien im Kontext des Holocaust-Diskurses
- Die Bedeutung der beiden Ansätze für den Umgang mit der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentralen Fragen und Problemstellungen dar. Sie beleuchtet den historischen Kontext des Eichmann-Prozesses und die Debatte über die Schuldfrage, die im Zuge des Prozesses entstand. Die Einleitung stellt auch die beiden Hauptakteure der Arbeit, Hannah Arendt und Theodor W. Adorno, sowie ihre unterschiedlichen Ansätze zur Beantwortung der Schuldfrage vor.
Das zweite Kapitel widmet sich den Biografien von Hannah Arendt und Theodor W. Adorno. Es beleuchtet ihre Lebenswege, ihre Erfahrungen mit dem Antisemitismus und ihre Flucht ins Exil. Dieses Kapitel soll einen Einblick in die persönlichen und intellektuellen Hintergründe der beiden Theoretiker:innen geben und so zu einem besseren Verständnis ihrer jeweiligen Ansätze beitragen.
Kapitel drei analysiert Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess und ihre Analyse der Schuldfrage der Judenräte. Es beleuchtet Arendts zentrale Argumente und ihre Kritik an der "Banalität des Bösen". Der Fokus liegt auf dem Kapitel "Die Wannseekonferenz oder Pontius Pilatus", in dem Arendt die Verantwortung der Judenräte im Kontext der Schoa analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Theodor W. Adornos Essay "Erziehung nach Auschwitz". Es analysiert Adornos Kritik an der Schuldfrage und sein Konzept einer Erziehung zur Verhinderung von neuer Gewalt. Es geht dabei auch um Adornos Verständnis der gesellschaftlichen Verantwortung im Umgang mit der Vergangenheit und seiner Kritik an einer instrumentellen Vernunft, die zu Gewalt und Unterdrückung führen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen der Schuldfrage, der Shoa, des Eichmann-Prozesses, Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Antisemitismus, "Banalität des Bösen", Erziehung nach Auschwitz, Verantwortung, Gesellschaft, Geschichte, Erinnerungskultur und Holocaust-Diskurs.
- Citation du texte
- Henrike Kuhlmann (Auteur), 2021, Die Judenräte als Mitschuldige. Hannah Arendts Analyse des Eichmann-Prozesses verglichen mit Adornos Antwort auf die Schuldfrage der Schoa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160022