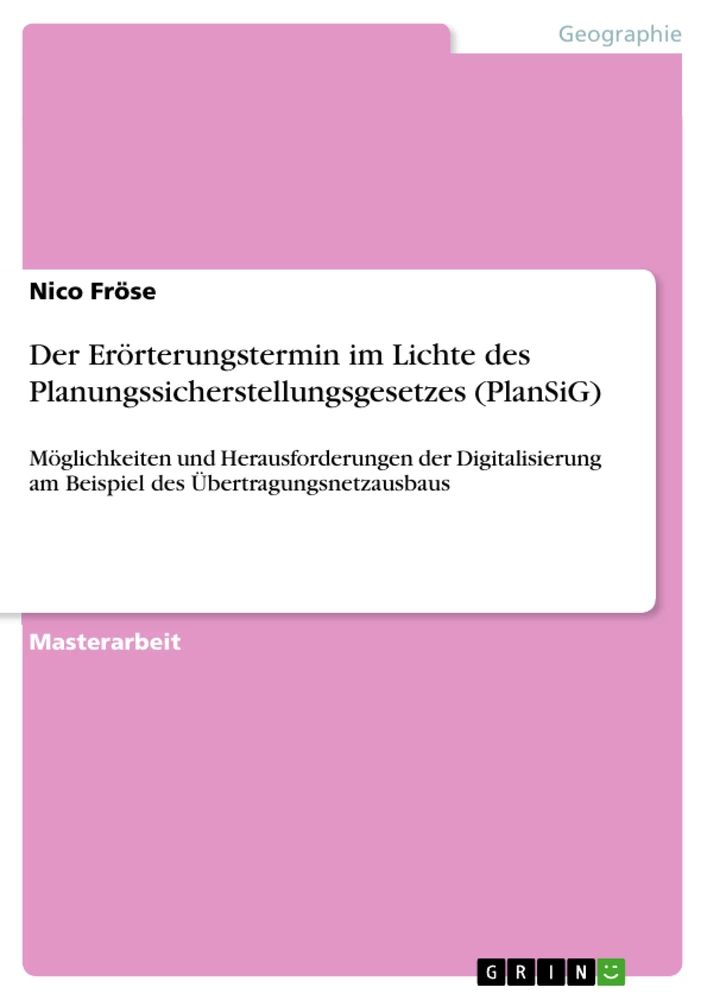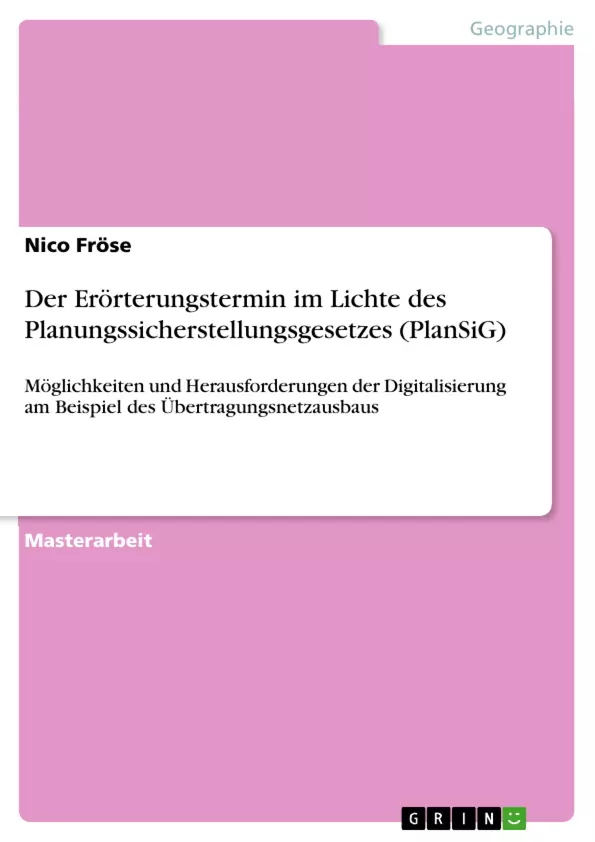Ein Anspruch der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur andauernden Debatte um das Format sowie die Sinnhaftigkeit des Formats Erörterungstermin unter besonderer Berücksichtigung aktueller, pandemiebedingter Entwicklungen in Recht und Verwaltungspraxis zu leisten. Dies erscheint besonders sinnvoll vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und den neuen Möglichkeiten der Digitalität in Planungs- und Genehmigungsverfahren auf Basis des in 2020 in Kraft getretenen Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG).
Zunächst werden wichtige Grundbegriffe in Bezug auf die (betroffene) Öffentlichkeit geklärt, ehe eine Erläuterung zum Zweck des Erörterungstermins in Planungs- und Genehmigungsverfahren erfolgt. Darüber hinaus ist die Klärung der Frage nach Rolle und Zielsetzung des Erörterungstermins nur vor dem Hintergrund der Einordnung in den formellen Ablauf des Genehmigungsverfahrens möglich. Besondere Berücksichtigung erfährt außerdem die Zielvorstellung des Gesetzgebers zur Aufgabe und zum Leistungsvermögen des Erörterungstermins mit Blick auf seine Funktionen hinsichtlich Transparenz und Befriedung und dem damit verbundenen gesetzgeberischen Leitbild.
Im Sinne des nötigen Praxisbezugs wurde als Beispiel der Übertragungsnetzausbau in Deutschland sowie das hierfür erforderliche Planungs- und Genehmigungsverfahren gewählt. Dieser stellt sich als gleichermaßen gesellschaftlich relevante wie umstrittene Vorhabenkategorie dar. Erörterungstermine geraten in den zugehörigen Genehmigungsverfahren regelmäßig an die Grenzen des praktisch Machbaren, sodass die Sinnhaftigkeit eines solchen Termins regelmäßig allgemein hinterfragt wird. Es ist daher ein Anliegen der vorliegenden Arbeit, die besondere Relevanz des Erörterungstermins in diesem Bereich herauszustellen.
Nach Klärung des theoretischen Zwecks sowie der gesetzlichen Anforderungen an den Erörterungstermin wird der klassische Erörterungstermin in Präsenzform einer Evaluation unterzogen, um eine differenzierte Aussage zum eventuellen Reformbedarf des Formats treffen zu können. Im Anschluss erfolgt schließlich eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Online-Konsultation gemäß § 5 PlanSiG. Insbesondere der Hintergrund des Gesetzes, der Anwendungsbereich in Bezug auf den Erörterungstermin, die Geeignetheit des Formats und nicht zuletzt auch die vielfache Kritik finden Berücksichtigung, ehe in einem abschließenden Fazit Aussagen zu den beschriebenen Forschungsfragen getroffenen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Fragestellungen
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2 Begriff und Hintergrund der Öffentlichkeitsbeteiligung
- 2.1 Öffentlichkeit
- 2.2 Betroffene Öffentlichkeit
- 2.3 Demokratietheoretischer Hintergrund
- 3 Der Erörterungstermin in Planung und Genehmigung
- 3.1 Zur Unterscheidung von Erörterungsterminen bei der Planfeststellung und im Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
- 3.2 Zweck des Erörterungstermins im Planungs- und Genehmigungsverfahren
- 3.3 Gesetzgeberisches Leitkonzept zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Übertragungsnetzausbau
- 4 Evaluation des Erörterungstermins in Präsenzform
- 4.1 Problembereiche
- 4.2 Zur Frage der Erforderlichkeit
- 4.3 Alternative Beteiligungsmodelle
- 4.4 Zwischenfazit
- 5 Der Erörterungstermin als Online-Konsultation nach dem Planungssicherstellungsgesetz
- 5.1 Hintergrund
- 5.2 Anwendungsbereich
- 5.3 Diskussion
- 5.4 Verlängerungsdebatte
- 5.5 Zwischenfazit
- 6 Fazit
- 6.1 Ausblick
- 6.2 Kritische Würdigung der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Erörterungstermin im Kontext des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) und der Herausforderungen der Digitalisierung, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau von Übertragungsnetzen. Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile des traditionellen Formats und bewertet die Einführung der Online-Konsultation als Alternative.
- Bewertung des Erörterungstermins als Beteiligungsformat
- Analyse der rechtlichen Grundlagen und des verfahrensrechtlichen Rahmens
- Untersuchung der Herausforderungen der Digitalisierung im Kontext von Planungs- und Genehmigungsverfahren
- Evaluierung der Online-Konsultation als Alternative zum traditionellen Erörterungstermin
- Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Erörterungstermins im Lichte des PlanSiG ein und skizziert die Forschungsfragen und die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die kontroverse Natur des Erörterungstermins und die durch die COVID-19-Pandemie erzwungene Digitalisierung von Planungsverfahren.
2 Begriff und Hintergrund der Öffentlichkeitsbeteiligung: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Öffentlichkeit und der betroffenen Öffentlichkeit im Kontext von Planungsverfahren. Es untersucht den demokratietheoretischen Hintergrund der Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Bedeutung für demokratische Prozesse. Die verschiedenen Verständnisse des Erörterungstermins als Anhörung, diskursive Erörterung oder demokratische Teilhabe werden hier thematisiert und bilden die Grundlage für die spätere Bewertung des Formats.
3 Der Erörterungstermin in Planung und Genehmigung: Dieses Kapitel beschreibt den Erörterungstermin im Detail, unterscheidet zwischen Planfeststellungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren und analysiert seinen Zweck im Planungs- und Genehmigungsverfahren. Der Fokus liegt auf dem gesetzgeberischen Leitkonzept zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Übertragungsnetzausbau. Es wird auf die verschiedenen rechtlichen und verfahrensrechtlichen Aspekte eingegangen, die für die Durchführung und die Bewertung des Erörterungstermins relevant sind.
4 Evaluation des Erörterungstermins in Präsenzform: Dieses Kapitel evaluiert kritisch den traditionellen Erörterungstermin in Präsenzform. Es identifiziert verschiedene Problembereiche, hinterfragt die Erforderlichkeit des Formats und stellt alternative Beteiligungsmodelle vor. Das Kapitel dient als Grundlage für den Vergleich mit der Online-Konsultation im darauffolgenden Kapitel und liefert eine umfassende Analyse der Stärken und Schwächen des konventionellen Verfahrens.
5 Der Erörterungstermin als Online-Konsultation nach dem Planungssicherstellungsgesetz: Dieses Kapitel analysiert die Einführung der Online-Konsultation als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und bewertet deren Eignung als Alternative zum traditionellen Erörterungstermin. Es beleuchtet den Hintergrund der Einführung, den Anwendungsbereich und diskutiert die Vor- und Nachteile dieses digitalen Beteiligungsformats. Die Verlängerungsdebatte um das PlanSiG wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Erörterungstermin, Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG), Öffentlichkeitsbeteiligung, Online-Konsultation, Digitalisierung, Planungs- und Genehmigungsverfahren, Übertragungsnetzausbau, Verfahrensrecht, Demokratietheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Evaluation des Erörterungstermins im Kontext des Planungssicherstellungsgesetzes
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Erörterungstermin im Kontext des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) und der Herausforderungen der Digitalisierung, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau von Übertragungsnetzen. Sie analysiert die Vor- und Nachteile des traditionellen Formats und bewertet die Einführung der Online-Konsultation als Alternative.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bewertung des Erörterungstermins als Beteiligungsformat, die Analyse der rechtlichen Grundlagen und des verfahrensrechtlichen Rahmens, die Untersuchung der Herausforderungen der Digitalisierung im Kontext von Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Evaluierung der Online-Konsultation als Alternative zum traditionellen Erörterungstermin und die Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriff und Hintergrund der Öffentlichkeitsbeteiligung, Der Erörterungstermin in Planung und Genehmigung, Evaluation des Erörterungstermins in Präsenzform, Der Erörterungstermin als Online-Konsultation nach dem Planungssicherstellungsgesetz und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Erörterungstermins und der Online-Konsultation.
Was wird in Kapitel 2 ("Begriff und Hintergrund der Öffentlichkeitsbeteiligung") behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Öffentlichkeit und der betroffenen Öffentlichkeit im Kontext von Planungsverfahren. Es untersucht den demokratietheoretischen Hintergrund der Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Bedeutung für demokratische Prozesse. Verschiedene Verständnisse des Erörterungstermins (Anhörung, diskursive Erörterung, demokratische Teilhabe) werden thematisiert.
Was ist der Fokus von Kapitel 3 ("Der Erörterungstermin in Planung und Genehmigung")?
Kapitel 3 beschreibt den Erörterungstermin detailliert, unterscheidet zwischen Planfeststellungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren und analysiert seinen Zweck im Planungs- und Genehmigungsverfahren. Der Fokus liegt auf dem gesetzgeberischen Leitkonzept zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Übertragungsnetzausbau.
Was wird in Kapitel 4 ("Evaluation des Erörterungstermins in Präsenzform") untersucht?
Kapitel 4 evaluiert kritisch den traditionellen Erörterungstermin in Präsenzform. Es identifiziert Problembereiche, hinterfragt die Erforderlichkeit des Formats und stellt alternative Beteiligungsmodelle vor. Es dient als Grundlage für den Vergleich mit der Online-Konsultation.
Worum geht es in Kapitel 5 ("Der Erörterungstermin als Online-Konsultation nach dem Planungssicherstellungsgesetz")?
Kapitel 5 analysiert die Einführung der Online-Konsultation als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und bewertet deren Eignung als Alternative zum traditionellen Erörterungstermin. Es beleuchtet den Hintergrund, den Anwendungsbereich und diskutiert Vor- und Nachteile dieses digitalen Beteiligungsformats. Die Verlängerungsdebatte um das PlanSiG wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen, gibt einen Ausblick und bietet eine kritische Würdigung der Arbeit. Es werden die Stärken und Schwächen der traditionellen und digitalen Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Kontext des PlanSiG bewertet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Erörterungstermin, Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG), Öffentlichkeitsbeteiligung, Online-Konsultation, Digitalisierung, Planungs- und Genehmigungsverfahren, Übertragungsnetzausbau, Verfahrensrecht, Demokratietheorie.
- Citation du texte
- Nico Fröse (Auteur), 2021, Der Erörterungstermin im Lichte des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160066