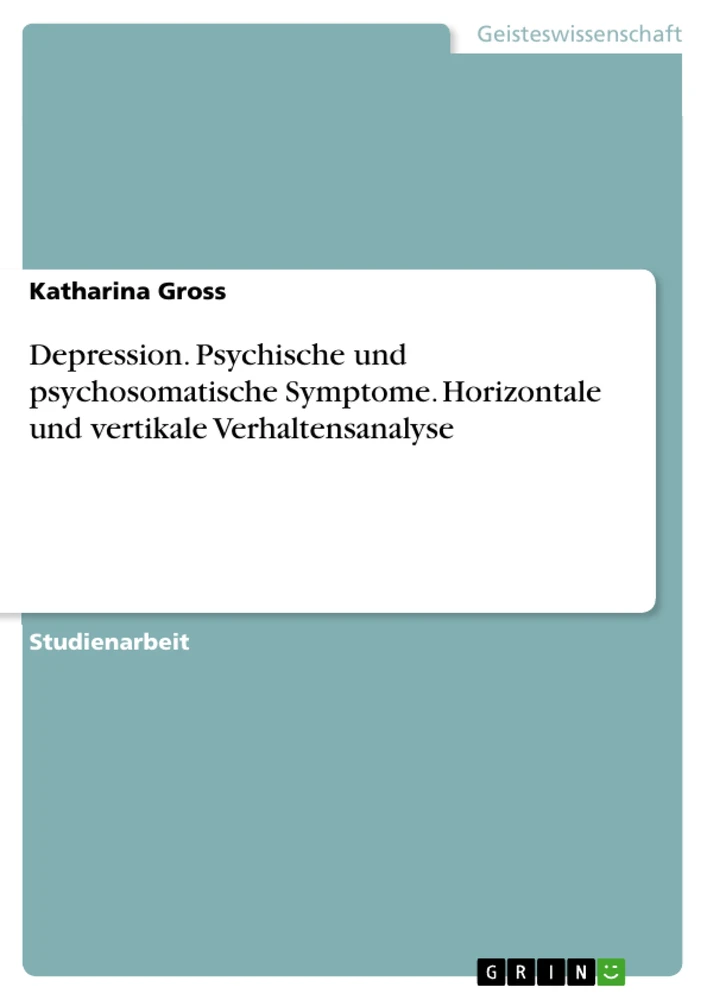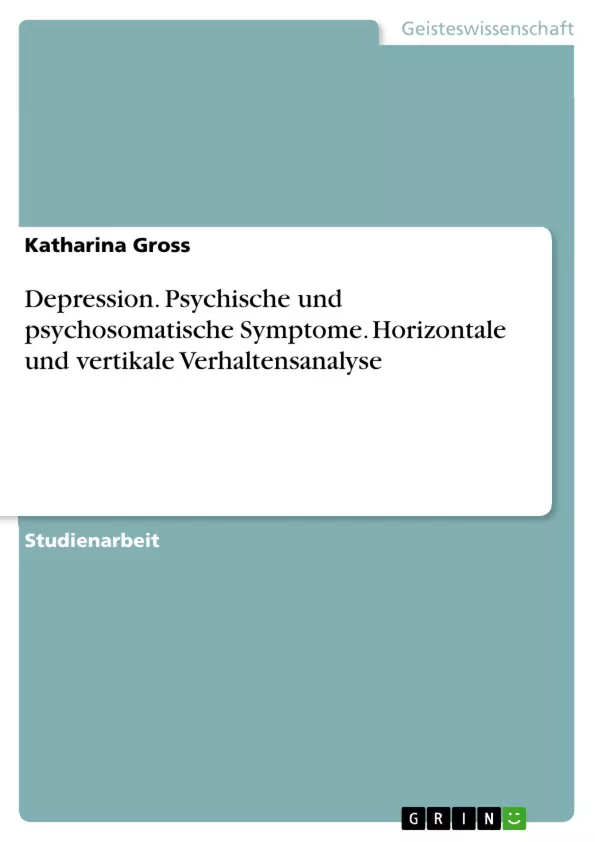Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich zunächst mit dem vielfältigen Erscheinungsbild der Krankheit. Dabei stehen psychische und psychosomatische Symptome im Vordergrund.
Im Anschluss daran geht es um die Prävalenz und den Geschlechterunterschied. Auffallend sind sowohl die statistischen Unterschiede als auch die symptomalen Differenzen zwischen Frauen und Männern: Während etwa jede vierte Frau im Lauf ihres Lebens betroffen ist, soll es bei den Männern lediglich jeder achte sein. Wichtige Erkenntnisse hierzu hat die Depressionsforschung in Bezug auf die geschlechtsspezifische Symptomatik festgestellt. Um welche es sich hierbei handelt und welche Konsequenzen sich daraus für die Diagnostik und Behandlung ableiten lassen, wird eingehend dargestellt. Den Abschluss des theoretischen Teils bildet die vielfältige Ätiologie.
Im Fokus des Anwendungsteils steht das Fallbeispiel eines depressiven Mannes, anhand dessen eine horizontale (Mikroanalyse) und eine vertikale (Makroanalyse) Verhaltensanalyse durchgeführt wird. Das Ziel besteht darin, auf Basis der theoretischen Kenntnisse eine realitätsnahe und fundierte Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung zu verfassen.
Im vierten Kapitel, dem Diskussionsteil, erfolgt zunächst eine kritische Reflexion der Fallstudie. Die anschließenden Empfehlungen zur Prävention gründen v. a. auf den Erkenntnissen des Fallbeispiels. Zuletzt erfolgt ein kritischer und zeitgemäßer Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische und empirische Grundlagen des depressiven Störungsbildes
- 2.1 Krankheitsbild der depressiven Störung
- 2.2 Prävalenz und Geschlechtsunterschiede
- 2.3 Ätiologische Konzepte
- 2.4 Zusammenfassung
- 3 Methodischer Teil: Fallbeispiel
- 3.1 Makroanalyse
- 3.2 Mikroanalyse nach dem SORC-Modell
- 3.3 Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung
- 4 Diskussion
- 4.1 Kritische Reflexion der Fallstudie
- 4.2 Empfehlungen zur Prävention
- 4.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, das komplexe Erscheinungsbild der Depression zu beleuchten, indem sie sowohl theoretische als auch empirische Erkenntnisse integriert. Sie analysiert das Krankheitsbild, untersucht die Prävalenz und Geschlechtsunterschiede sowie die vielfältigen Ursachen der Depression. Darüber hinaus wird anhand eines Fallbeispiels eine horizontale und vertikale Verhaltensanalyse durchgeführt, um eine realitätsnahe und fundierte Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung zu entwickeln.
- Krankheitsbild der Depression: Definition, Symptome, Diagnose und Komorbidität
- Prävalenz und Geschlechtsunterschiede: Statistische Unterschiede, geschlechtsspezifische Symptomatik und deren Einfluss auf die Diagnostik und Behandlung
- Ätiologie der Depression: Biologische, psychologische und soziale Faktoren, die zur Entstehung der Depression beitragen
- Fallbeispiel: Anwendung theoretischer Kenntnisse zur Analyse eines depressiven Mannes und Entwicklung einer Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung
- Diskussion und Ausblick: Kritische Reflexion der Fallstudie, Empfehlungen zur Prävention und zukunftsorientierte Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Depression als eine häufige psychische Erkrankung vor, die ein heterogenes Spektrum an emotionalen, motivationalen, kognitiven, physiologischen und verhaltensbezogenen Symptomen umfasst. Sie geht auf die Kardinalsymptome wie gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit und Interessenverlust ein und beleuchtet die hohe Lebenszeitprävalenz der Depression. Die Einleitung verdeutlicht den Fokus der Hausarbeit auf die psychischen und psychosomatischen Symptome sowie die Unterschiede in der Prävalenz und Symptomatik zwischen Frauen und Männern. Außerdem wird der Aufbau der Hausarbeit erläutert und die Anwendung des Fallbeispiels für eine horizontale und vertikale Verhaltensanalyse angekündigt.
Kapitel 2: Theoretische und empirische Grundlagen des depressiven Störungsbildes
Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen und empirischen Grundlagen der depressiven Störung. Es beschreibt das Krankheitsbild, beleuchtet die Prävalenz und Geschlechtsunterschiede sowie die verschiedenen Ursachen der Depression.
Kapitel 3: Methodischer Teil: Fallbeispiel
Das dritte Kapitel präsentiert ein Fallbeispiel eines depressiven Mannes und führt eine horizontale und vertikale Verhaltensanalyse durch. Die horizontale Analyse erfolgt mithilfe des SORC-Modells, während die vertikale Analyse die Makroebene des Falles beleuchtet. Auf Basis dieser Analysen werden eine Fallkonzeptualisierung und eine Therapieplanung erstellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit umfassen: Depression, affektive Störungen, Krankheitsbild, Prävalenz, Geschlechtsunterschiede, Ätiologie, Verhaltensanalyse, SORC-Modell, Fallkonzeptualisierung, Therapieplanung.
- Quote paper
- Katharina Gross (Author), 2021, Depression. Psychische und psychosomatische Symptome. Horizontale und vertikale Verhaltensanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160295