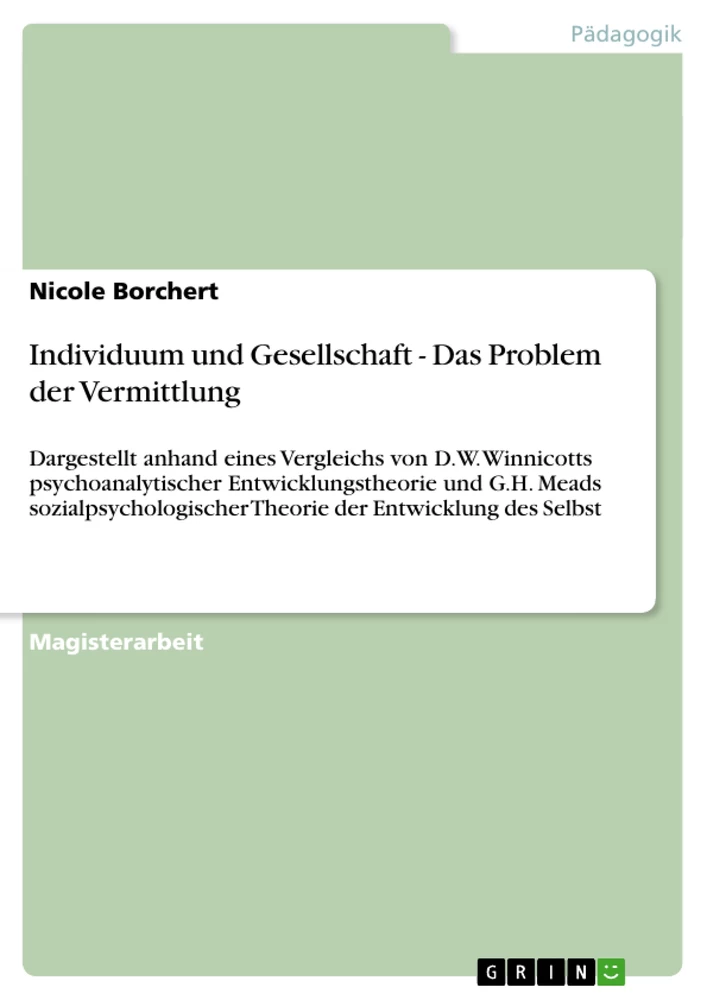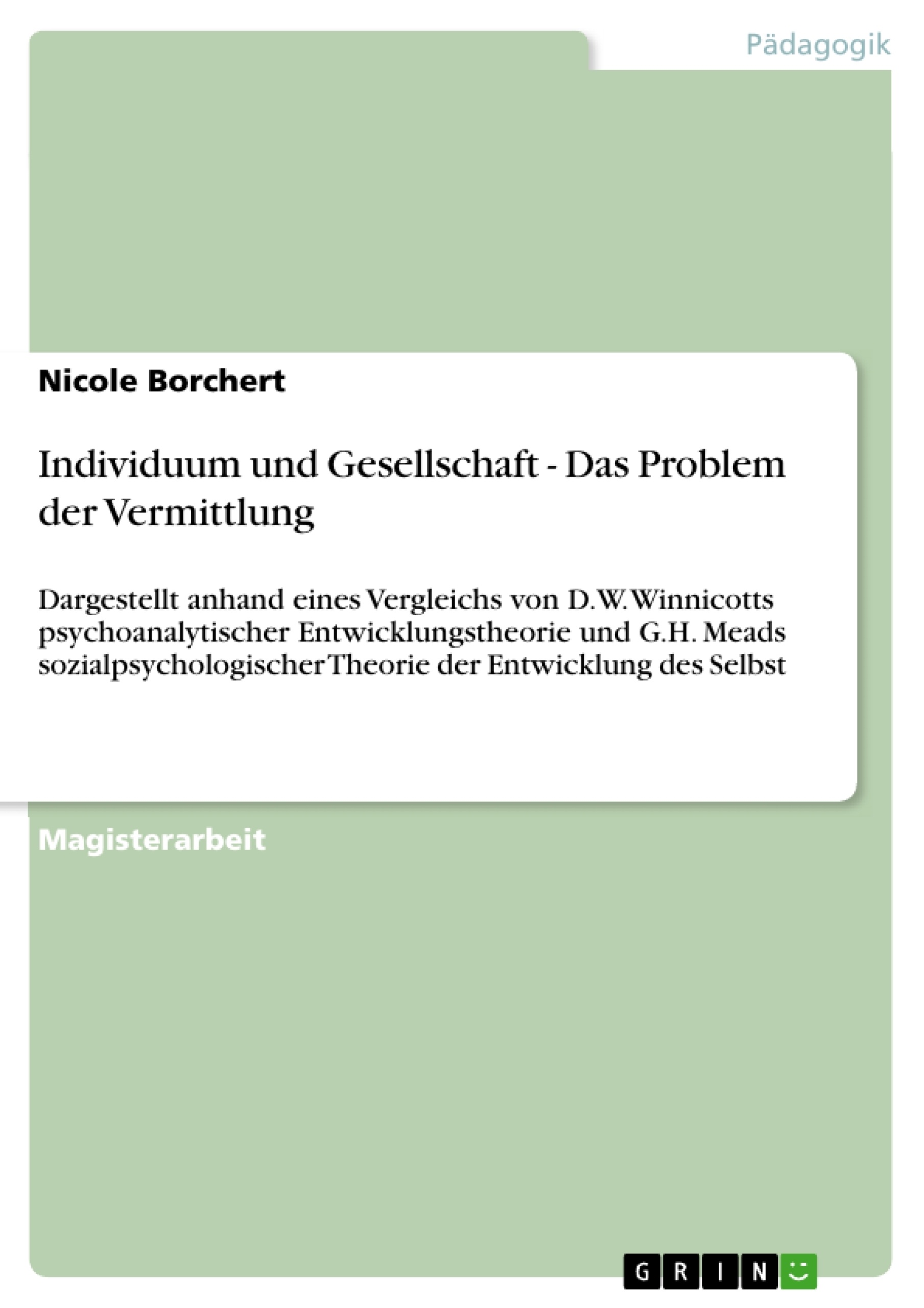Die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft stellt eines der Grundprobleme in pädagogischen Diskursen dar. In Mittelpunkt des Interesses vonseiten der Wissenschaft und der pädagogischen Praxis steht die Frage, wie der Eigensinn des Individuums mit dem gesellschaftlichen Auftrag von Bildung und Integration zu vereinbaren ist.
Diese Problematik stellt sich nicht nur in pädagogischen und bildungspolitischen Kontexten, sondern begegnet uns in fast jeder Lebenslage. Da das Individuum nur als Teil eines großen Ganzen, der Gesellschaft, gedacht werden kann, ist eine Herauslösung aus dem sozialen Umfeld nicht möglich. Aus diesem Grund erscheint es unmöglich zu erfassen, was genau das Subjektive, das man als „Kern“ der Identität bezeichnen kann, darstellt und impliziert. Trotz dieses Problems scheint es für die Meisten keine Schwierigkeit darzustellen, die Existenz eines solchen inneren Kerns anzunehmen.
Da wir als Teil einer Gemeinschaft aufwachsen und von Beginn unseres Lebens in einem wechselseitigen Verhältnis zu unserem Umfeld stehen, kann dieser Kern nicht unabhängig betrachtet werden. Es hängt zum großen Teil von unserer Umwelt und der Art und Weise unseres Aufwachsens ab, welche Anteile des „wahren Selbst“ zum Vorschein kommen. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein Mensch von Geburt an ganz bestimmte für ihn charakteristische Eigenschaften in sich trägt, entscheidet die Sozialisation maßgeblich darüber, wie ein Mensch wird. Sprechen wir vom „Werden“ eines Individuums, ist damit bereits angedeutet, dass Identität als ein Prozess, als Entwicklung zu verstehen ist. Das Menschsein ist von einer „Entwicklungstatsache“ bestimmt; Menschen sind nicht einfach, sie werden, oder genauer: Sie „werden erst, was sie sind“ ( Sesink 2001: 53). Die Potenziale für diese Entwicklung des Seins sind mit der Geburt gegeben, sie sind latent vorhanden; die Verwirklichung dieser Potenziale jedoch ist ein Prozess, welcher durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Was ist Vermittlung?
- 1.2 Die Ausgangsproblematik
- 1.3 Zielsetzung und Herangehensweise
- 1.4 Anmerkungen zum Aufbau dieser Arbeit
- Teil A
- 2. Donald W. Winnicott und die psychoanalytische Pädagogik
- 2.1 Leben und Werk
- 2.2 Die Theorie der emotionalen Entwicklung
- 3. Der Beginn der Vermittlung
- 3.1 Ich und Selbst
- 3.2 Ich-Integration
- 3.3 Omnipotenzerfahrung und Realitätsprinzip
- 3.4 Von der absoluten zur relativen Abhängigkeit
- 3.5 Übergangsphänomene und -objekte
- 4. Vermittlungen des Selbst
- 4.1 Vermittlung als soziale und individuelle Aufgabe
- 4.2 Das „wahre Selbst“ – Der Kern der Identität
- 4.3 Das „gefügige Selbst“ und Vermittlung
- 4.4 Das „falsche Selbst“
- 4.4.1 Zur Konstitution des falschen Selbst
- 4.4.2 Formen des falschen Selbst und die Gefahr der Spaltung
- 5. Voraussetzungen für Vermittlung
- 5.1 Spiel, Kreativität und der „potenzielle Raum“
- 5.2 Der Beitrag der Umwelt
- 6. Zusammenfassung: Vermittlung bei D.W. Winnicott
- 2. Donald W. Winnicott und die psychoanalytische Pädagogik
- Teil B (Vergleich)
- 7. George H. Mead und die Sozialpsychologie
- 7.1 Mead als Sozialpsychologe und Sozialphilosoph
- 7.2 Der symbolische Interaktionismus
- 8. Identitätsentwicklung
- 8.1 Identität: „I“ und „Me“
- 8.2 Subjektivität und Identität
- 8.3 Zur Konstitution des Ichs
- 8.4 Selbstbewusstsein
- 9. Voraussetzungen für Vermittlung
- 9.1 Spielen und Kreativität
- 9.2 Die Rolle der Umwelt
- 9.2.1 Identität als gesellschaftlicher Prozess
- 9.2.2 Sozialität
- 10. Zusammenfassung: Vermittlung bei G.H. Mead
- 7. George H. Mead und die Sozialpsychologie
- 11. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Problem der Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft. Sie analysiert die Konzepte von Donald W. Winnicott und George H. Mead, um die Prozesse der Identitätsentwicklung und die Rolle der Umwelt in der Gestaltung des Selbst zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Selbst als ein komplexer Prozess der Vermittlung zwischen individuellen Bedürfnissen und den Anforderungen der Gesellschaft.
- Die Bedeutung von Spiel, Kreativität und dem „potenziellen Raum“ für die gesunde Entwicklung des Selbst.
- Der Einfluss der Umwelt auf die Bildung des Selbst und die Herausforderungen der Anpassung an gesellschaftliche Normen.
- Die Bedeutung der Interaktion und des symbolischen Interaktionismus für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Identität.
- Die verschiedenen Facetten des Selbst, wie das „wahre Selbst“, das „gefügige Selbst“ und das „falsche Selbst“, und ihre Bedeutung für die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Begriff „Vermittlung“ und stellt die zentrale Frage nach der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Anschließend widmet sich Teil A der psychoanalytischen Pädagogik Donald W. Winnicotts und seiner Theorie der emotionalen Entwicklung, wobei insbesondere die Konzepte von „Ich“ und „Selbst“ sowie die Entstehung des „falschen Selbst“ beleuchtet werden. Teil B vergleicht Winnicotts Ansatz mit der sozialpsychologischen Theorie von George H. Mead, wobei der symbolische Interaktionismus und die Bedeutung von Interaktion für die Entwicklung von Identität im Fokus stehen. Abschließend werden die Erkenntnisse beider Theorien in einem Resümee zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Pädagogik und Sozialpsychologie, wie z.B. der Vermittlung von Werten und Normen, der Entwicklung des Selbst, der Bedeutung von Spiel und Kreativität, dem Einfluss der Umwelt, dem symbolischen Interaktionismus, der Identitätsbildung und der Abhängigkeit des Individuums von der Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter "Vermittlung" zwischen Individuum und Gesellschaft verstanden?
Es geht um die Frage, wie der persönliche Eigensinn eines Menschen mit den Anforderungen und Normen der Gesellschaft (Integration und Bildung) in Einklang gebracht werden kann.
Was ist das "wahre Selbst" nach Donald W. Winnicott?
Das "wahre Selbst" ist der Kern der Identität, der sich durch Spontaneität und Kreativität auszeichnet, sofern die Umwelt (besonders die Mutter) eine unterstützende Basis bietet.
Wie entsteht ein "falsches Selbst"?
Ein falsches Selbst entwickelt sich als Schutzmechanismus, wenn das Individuum gezwungen ist, sich übermäßig an gesellschaftliche Anforderungen anzupassen, was zu einer inneren Spaltung führen kann.
Welchen Ansatz verfolgt George H. Mead zur Identitätsbildung?
Mead unterscheidet zwischen dem "I" (impulsives Ich) und dem "Me" (gesellschaftliches Ich), die im ständigen Dialog die Identität durch symbolischen Interaktionismus formen.
Welche Rolle spielt das Spiel für die Entwicklung des Selbst?
Sowohl bei Winnicott als auch bei Mead ist das Spiel essenziell, um Kreativität zu entfalten, soziale Rollen zu erproben und den "potenziellen Raum" zwischen Individuum und Umwelt zu füllen.
- Citar trabajo
- Nicole Borchert (Autor), 2007, Individuum und Gesellschaft - Das Problem der Vermittlung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116140