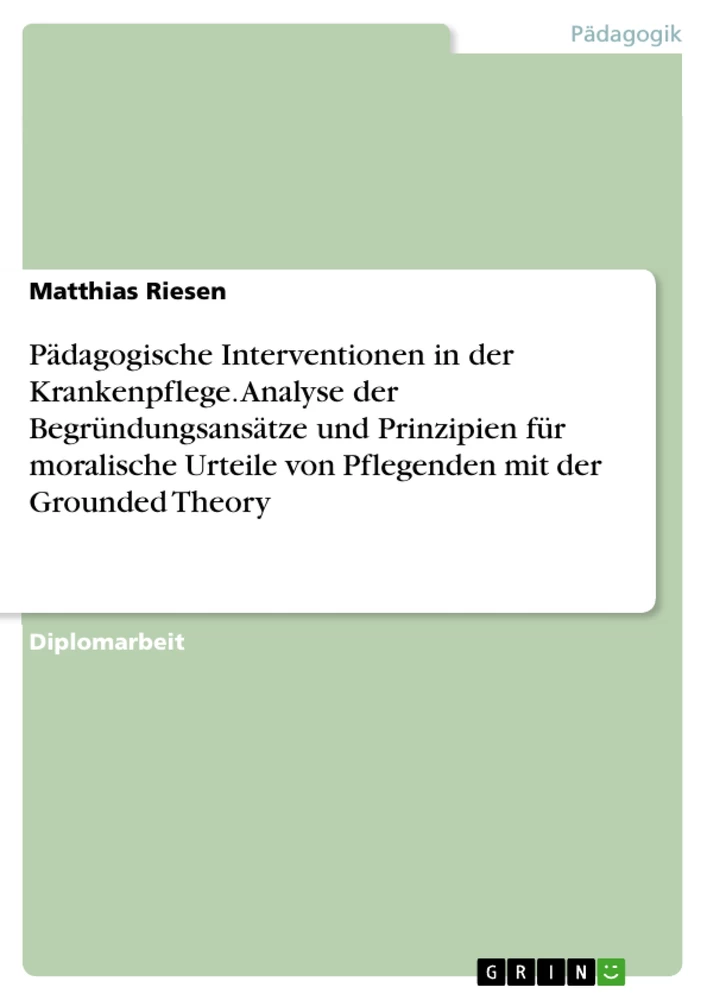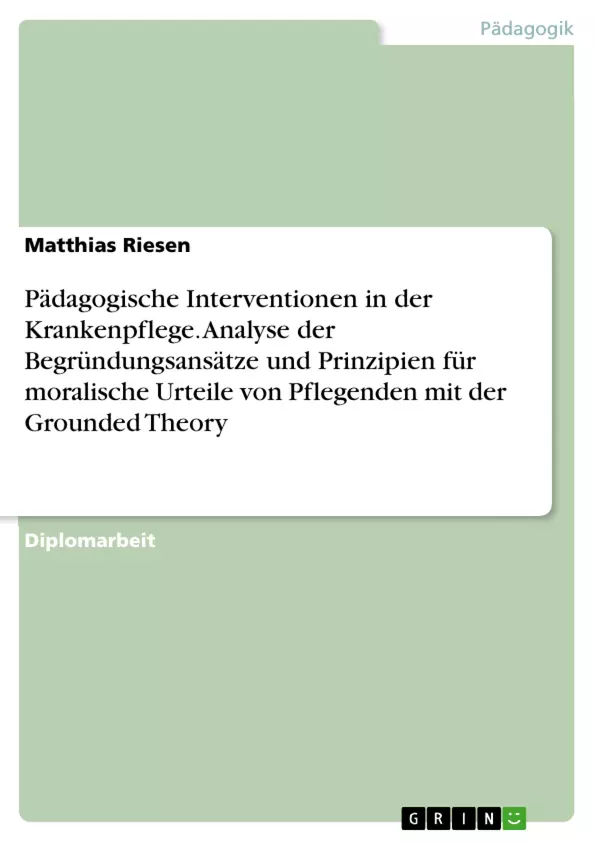In vorliegender Untersuchung soll der Frage nachgegangen werden, mit welchen Begründungsansätzen Pflegende moralisch urteilen und welche Prinzipien ihnen zugrunde gelegt werden. Anhand der Ergebnisse soll die Notwendigkeit von pädagogischen Interventionen geprüft und abgeleitet werden. Damit kann ein Beitrag für ethikrelevante Inhalte der Pflegeausbildung und die innerbetriebliche Fortbildung geleistet werden. Um dieser Fragestellung nachzugehen, wurden qualitativ auszuwertende Interviews mit Pflegenden geführt, die mit Hilfe der „Grounded Theory“ analysiert wurden.
In Kapitel 1.1 werden Begriffe definiert, die für die Themenbearbeitung erforderlich sind. Ethische Begründungsansätze als elementarer Bestandteil der Moralphilosophie sind Gegenstand von Kapitel 1.2. Die von den Autorinnen Schröck und Kersting formulierte „moralische Desensibilisierung in der Krankenpflege“ wird in Kapitel 1.3 vorgestellt. Zu Forschungsdesign und -methode wird Kapitel 2 Aufschluss geben. In Kapitel 3 werden die o.a. Interviews einer ausführlichen Einzelanalyse und Kommentierung unterzogen.
Das sich anschließende Kapitel 4.1 hat die für die Fragestellung relevanten Ergebnisse herauszustellen. Daraufhin wird in Kapitel 4.2 im Einzelnen zu prüfen sein, ob und welche pädagogischen Konsequenzen sich im beruflichen Kontext ableiten lassen. Den Abschluss bildet Kapitel 4.3 mit einer pointierten Zusammenfassung und einem Ausblick auf Möglichkeiten der Umsetzung und auf weitere Forschungsfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Definitionen
- Ethische Begründungsansätze
- Moralische Desensibilisierung in der Krankenpflege
- Forschungsdesign und -methode
- Forschungsmethodik, Datenanalyse und Dateninterpretation
- Qualitative Forschung
- Grounded Theory
- Forschungsdesign und Datenerhebung
- Die Interviews
- Transkriptionsregeln
- Wesentliche Unterschiede zwischen der vorliegenden Untersuchung und der Studie Karin Kerstings
- Die Interviewpartner
- Gang der Untersuchung
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartnerin B.
- Zusammenfassung und Kommentar (B.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartnerin R.
- Zusammenfassung und Kommentar (R.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartnerin H.
- Zusammenfassung und Kommentar (H.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartner M.
- Zusammenfassung und Kommentar (M.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartnerin P.
- Zusammenfassung und Kommentar (P.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartner L.
- Zusammenfassung und Kommentar (L.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartnerin S.
- Zusammenfassung und Kommentar (S.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartnerin J.
- Zusammenfassung und Kommentar (J.)
- Deskriptive Analyse des moralischen Urteils von Interviewpartnerin HE.
- Zusammenfassung und Kommentar (HE.)
- Evaluation der Untersuchungsbefunde
- Gesamtanalyse und Interpretation
- Pädagogische Konsequenzen im beruflichen Kontext
- Resümee und Ausblick
- Interviewleitfaden
- Transkription - Probeinterview
- Transkription - B.
- Transkription R.
- Transkription H.
- Transkription M.
- Transkription P.
- Transkription L.
- Transkription S.
- Transkription J.
- Transkription HE.
- Gegenüberstellung der Kategorien
- B.
- R.
- H.
- M.
- P.
- L.
- S.
- J.
- HE.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die moralischen Urteilsfindungsprozesse von Pflegekräften im Kontext der Krankenpflege. Die Arbeit zielt darauf ab, die Begründungsansätze und Prinzipien zu beleuchten, die Pflegende bei moralischen Entscheidungen leiten. Darüber hinaus werden pädagogische Konsequenzen aus den Befunden abgeleitet, um die ethische Kompetenz von Pflegekräften in der Ausbildung und im Beruf zu fördern.
- Moralische Urteilsfindung in der Krankenpflege
- Ethische Begründungsansätze und Prinzipien in der Pflegepraxis
- Qualitative Forschung und Grounded Theory
- Pädagogische Implikationen für die Pflegeausbildung
- Desensibilisierung und ethische Herausforderungen in der Intensivpflege
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Fragestellung: Das Kapitel beleuchtet die Relevanz ethischer Fragestellungen im Gesundheitswesen und insbesondere in der Krankenpflege. Die Bedeutung von moralischen Urteilen in der Praxis wird hervorgehoben und die Notwendigkeit von ethischen Reflexionen und Handlungskompetenz in diesem Bereich wird betont. Die Fragestellung der Untersuchung wird klar formuliert, wobei der Fokus auf die Begründungsansätze und Prinzipien von Pflegenden bei moralischen Entscheidungen liegt.
- Forschungsdesign und -methode: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsmethodik, Datenanalyse und Dateninterpretation der Untersuchung. Der qualitative Ansatz der Grounded Theory wird erläutert und die Wahl der Interviewmethode wird begründet. Das Forschungsdesign, die Datenerhebung und die Transkriptionsregeln werden detailliert dargestellt, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Untersuchung zu gewährleisten.
- Gang der Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit den Pflegenden. Die Ergebnisse werden in Form von deskriptiven Analysen und Zusammenfassungen der einzelnen Interviews dargestellt. Dabei werden die moralischen Urteile der Interviewpartner in den Mittelpunkt gestellt und ihre Begründungsansätze sowie die zugrundeliegenden Prinzipien werden analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Moralische Urteile, Krankenpflege, Ethische Begründungsansätze, Qualitative Forschung, Grounded Theory, Pädagogische Implikationen, Intensivpflege und Desensibilisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie treffen Pflegekräfte moralische Entscheidungen?
Die Arbeit analysiert mithilfe der Grounded Theory, welche ethischen Prinzipien und Begründungsansätze Pflegende in ihrem Berufsalltag heranziehen.
Was bedeutet "moralische Desensibilisierung" in der Pflege?
Dieser Begriff (nach Schröck und Kersting) beschreibt einen Prozess, bei dem Pflegende aufgrund von Überlastung oder Routine abstumpfen und moralische Konflikte weniger sensibel wahrnehmen.
Warum wurde die "Grounded Theory" als Methode gewählt?
Die Grounded Theory ermöglicht es, aus qualitativen Interviews heraus neue theoretische Konzepte zu entwickeln, die direkt in der Praxis der Krankenpflege verwurzelt sind.
Welche pädagogischen Konsequenzen ergeben sich aus der Studie?
Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, ethikrelevante Inhalte in der Pflegeausbildung und Fortbildung zu stärken, um die moralische Urteilskompetenz zu fördern.
Welchen Fokus hat die Untersuchung bei den Interviewpartnern?
Es wurden Interviews mit verschiedenen Pflegekräften (z.B. aus der Intensivpflege) geführt, um deren individuelle Sichtweisen auf ethische Dilemmata detailliert auszuwerten.
Was ist das Ziel der moralphilosophischen Betrachtung in der Arbeit?
Es geht darum, die zugrunde liegenden ethischen Begründungsansätze (wie Deontologie oder Utilitarismus) in den realen Aussagen der Pflegenden zu identifizieren.
- Quote paper
- Matthias Riesen (Author), 2003, Pädagogische Interventionen in der Krankenpflege. Analyse der Begründungsansätze und Prinzipien für moralische Urteile von Pflegenden mit der Grounded Theory, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161426