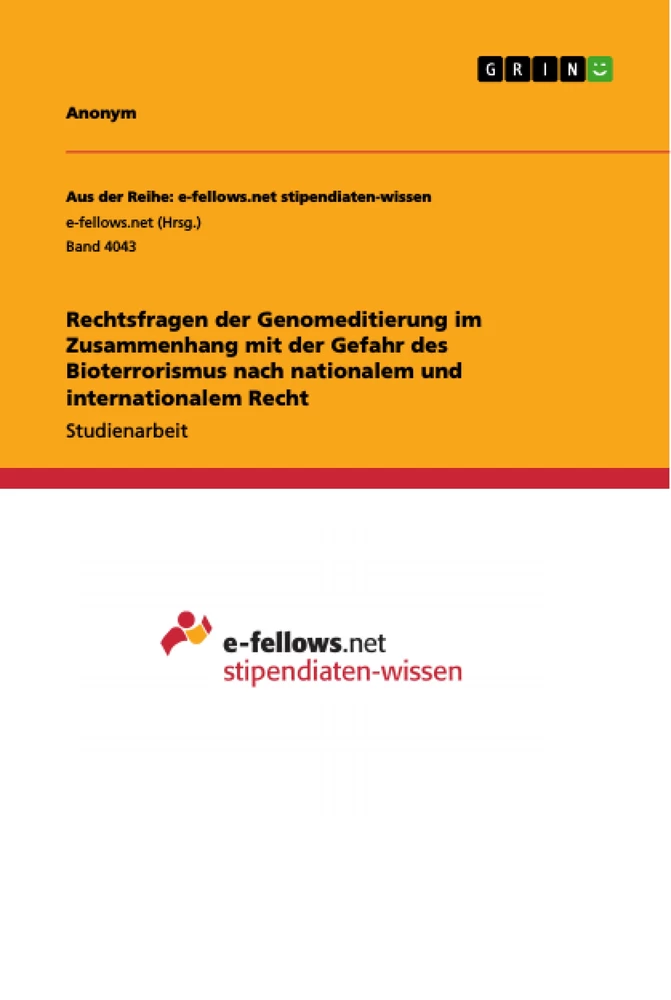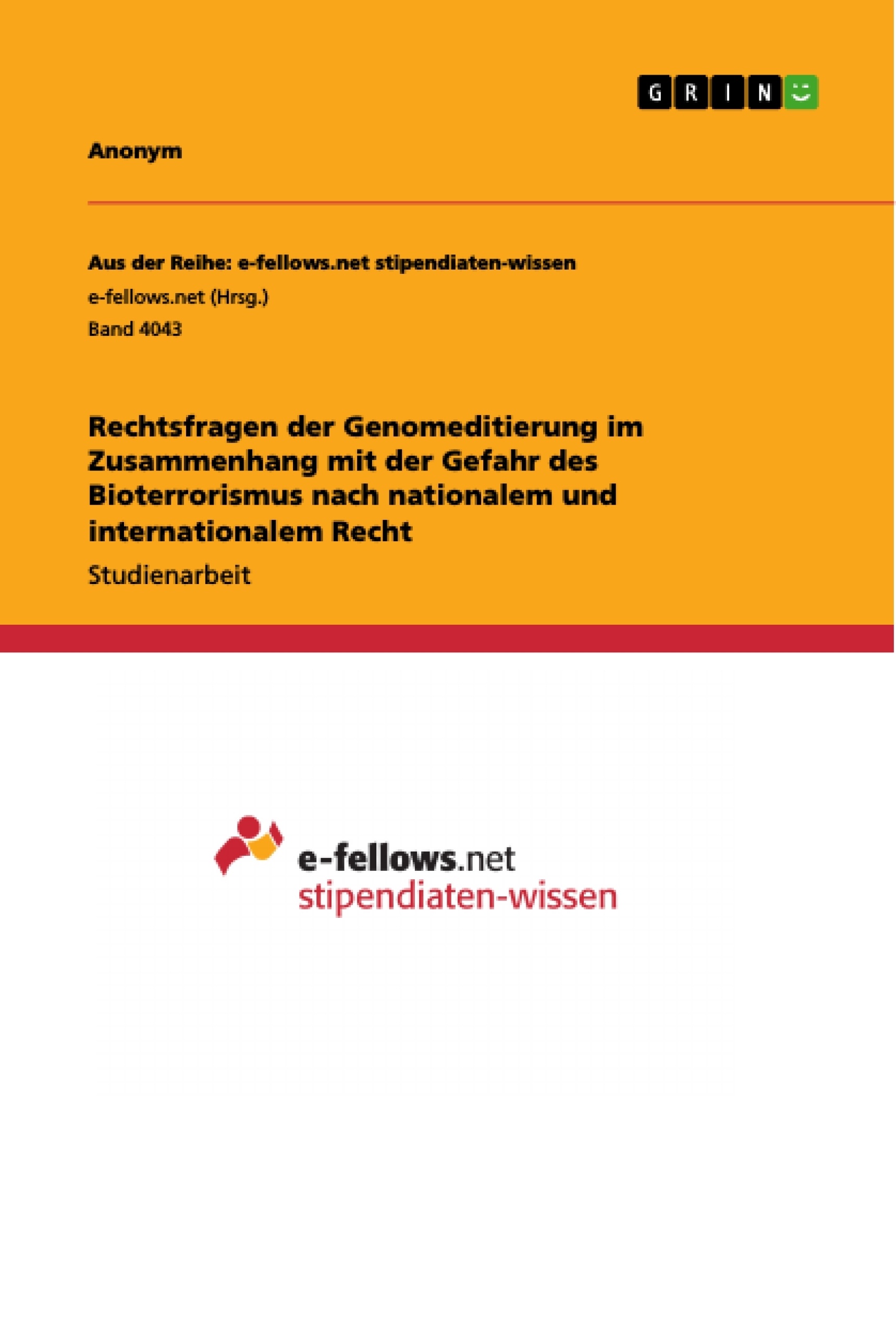Diese Arbeit bezieht sich im Folgenden ausschließlich auf die CRISPR-Technologie, als eine Methode der Genomeditierung, da diese am häufigsten genutzt und besonders verbreitet ist, sodass dort die Gefahr der missbräuchlichen Verwendung und damit die Gefahr des Bioterrorismus von besonderer Relevanz ist.
Zunächst wird der Begriff der Genomeditierung definiert sowie deren Geschichte und Funktionsweise erläutert. Dabei erfolgt bewusst keine detaillierte, medizinische Erläuterung der molekulargenetischen Wirkmechanismen, sondern eine Ausführung zur Schaffung eines grundlegenden Verständnisses, welches für die Beurteilung der Rechtsfragen der Genomeditierung notwendig ist. Daran anschließend werden vorteilhafte Anwendungsformen der Genomeditierung
aufgezeigt und diesen Anwendungsformen ihre missbräuchlichen Verwendungsformen gegenübergestellt. Sodann wird erörtert, worin die Ursache dieses missbräuchlichen Verwendungspotentials liegt. In diesem Rahmen wird die Dual-Use-Problematik vorgestellt.
Im Anschluss wird der Begriff des Bioterrorismus eingeführt und darauf aufbauend erläutert, welche der missbräuchlichen Anwendungsformen unter den Begriff des Bioterrorismus subsumiert werden können. Dies ermöglicht, im Rahmen der rechtlichen Betrachtung, die Konzentration auf die Anwendungsformen der Genomeditierung mit bioterroristischer Gefahr. Anschließend werden Regulierungsansätze der Genomeditierung im Hinblick auf die damit verbundene bioterroristische Gefahr betrachtet. Einleitend werden dabei die Begriffe Biosafety und Biosecurity dargestellt. Es werden dann relevante Regelwerke herausgegriffen und geprüft, ob die genomeditierten Agenzien unter diese Regelwerke subsumiert werden können. Weiterhin wird anhand der darin enthaltenen Regulierungen erarbeitet, ob die Regelwerke derart ausgestaltet sind, dass sie die der Genomeditierung anhaftende Dual-Use-Problematik berücksichtigen, Biosecurity gewährleisten und damit die bioterroristische Gefahr effektiv regulieren. Abschließend wird
anhand der ausgearbeiteten Rechtsfragen zusammenfassend festgestellt, wie Genomeditierung in Bezug auf die Gefahr des Bioterrorismus national und international reguliert ist und es wird ein Ausblick gegeben, wie die Regulierung zukünftig effektiver gestaltet werden könnte.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Einführung Genomeditierung
- C. Missbräuchliches Verwendungspotenzial der Genomeditierung
- I. Vorteilhafte Anwendungsformen der Genomeditierung und deren missbräuchliche Verwendung.
- II. Dual-Use-Problematik als eine Ursache des Missbrauchspotenzials.
- D. Gefahr des Bioterrorismus durch Genomeditierung.
- I. Begriffsklärung Bioterrorismus
- II. Missbräuchliche Anwendungen der Genomeditierung mit bioterroristischem Potential.
- E. Regulierungsansätze zur Einschränkung der bioterroristischen Gefahr durch Genomeditierung..
- I. Regulierung gentechnisch veränderte Organismen (GVO) auf europäischer und nationaler Ebene...
- 1. Genomeditierte Agenzien als GVO gemäß Art. 2 Nr. 2 Freisetzungsrichtlinie.
- 2. Genomeditierte Agenzien als Mutagenese gemäß Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Anhang I B Nr. 1 Freisetzungsrichtlinie
- 3. Ausgestaltung der Regulierung im Hinblick auf die Eindämmung bioterroristischer Gefahr..
- II. Regulierung zur Bekämpfung biologischer Waffen auf nationaler und internationaler Ebene
- 1. Biowaffenübereinkommen (BWÜ)..
- a) Genomeditierte Agenzien als mikrobiologische Agenzien gemäß Art. I Nr. 1 BWÜ
- b) Ausgestaltung der Regulierung im Hinblick auf die Eindämmung bioterroristischer Gefahr
- 2. Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWKG)....
- a) Genomeditierte Agenzien als Kriegswaffen gemäß § 1 Abs. 1 KrWKG.....
- b) Ausgestaltung der Regulierung im Hinblick auf die Eindämmung bioterroristischer Gefahr.
- 1. Biowaffenübereinkommen (BWÜ)..
- III. Regulierung des grenzüberschreitenden Verkehrs veränderter Organismen auf europäischer und internationaler Ebene
- 1. Cartagena-Protokoll
- a) Genomeditierte Agenzien als LVO gemäß Art. 3 g Cartagena-Protokoll
- b) Ausgestaltung der Regulierung im Hinblick auf die Eindämmung bioterroristischer Gefahr..
- 2. Dual-Use-Verordnung...
- 1. Cartagena-Protokoll
- I. Regulierung gentechnisch veränderte Organismen (GVO) auf europäischer und nationaler Ebene...
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rechtsfragen der Genomeditierung im Zusammenhang mit der Gefahr des Bioterrorismus. Sie analysiert die potentiellen Risiken der neuen Technologie und beleuchtet die Regulierungsansätze auf nationaler und internationaler Ebene.
- Dual-Use-Problematik der Genomeditierung
- Bioterrorismus durch Genomeditierung
- Regulierung gentechnisch veränderter Organismen (GVO)
- Regulierung biologischer Waffen
- Grenzüberschreitender Verkehr veränderter Organismen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz der Fragestellung heraus. Kapitel B erläutert die Funktionsweise der Genomeditierung und ihre vielseitigen Anwendungen. Kapitel C untersucht das Missbrauchspotenzial der Technologie, insbesondere im Kontext der Dual-Use-Problematik.
Kapitel D befasst sich mit der Gefahr des Bioterrorismus durch Genomeditierung und definiert den Begriff. Zudem werden konkrete Anwendungsformen der Genomeditierung mit bioterroristischem Potential dargestellt. Kapitel E analysiert verschiedene Regulierungsansätze, die zum Schutz vor dieser Gefahr beitragen sollen.
Zunächst werden die Regelungen für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) auf europäischer und nationaler Ebene beleuchtet. Anschließend werden die Regulierungsansätze zur Bekämpfung biologischer Waffen auf nationaler und internationaler Ebene untersucht. Abschließend werden die Regelungen zum grenzüberschreitenden Verkehr veränderter Organismen näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Genomeditierung, Bioterrorismus, Dual-Use, GVO, Freisetzungsrichtlinie, Biowaffenübereinkommen (BWÜ), Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWKG), Cartagena-Protokoll, Dual-Use-Verordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die CRISPR-Technologie und warum birgt sie Risiken?
CRISPR ist eine präzise Methode der Genomeditierung. Das Risiko liegt in der missbräuchlichen Verwendung zur Erzeugung gefährlicher Krankheitserreger, was eine bioterroristische Gefahr darstellt.
Was versteht man unter der Dual-Use-Problematik bei der Genomeditierung?
Dual-Use bedeutet, dass Forschungsergebnisse und Technologien, die für nützliche Zwecke (z.B. Heilung von Krankheiten) entwickelt wurden, gleichzeitig für schädliche Zwecke (z.B. Biowaffen) missbraucht werden können.
Wie werden genomeditierte Organismen rechtlich eingestuft?
Nach europäischem Recht werden sie oft als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) eingestuft und unterliegen damit strengen Freisetzungsrichtlinien.
Was ist das Biowaffenübereinkommen (BWÜ)?
Das BWÜ ist ein internationaler Vertrag, der die Entwicklung, Herstellung und Lagerung von biologischen Waffen verbietet. Die Arbeit prüft, ob moderne genomeditierte Agenzien unter diesen Schutzschirm fallen.
Was unterscheidet Biosafety von Biosecurity?
Biosafety schützt Menschen vor Unfällen mit biologischen Stoffen (Labor-Sicherheit), während Biosecurity den Schutz vor Diebstahl, Verlust oder absichtlichem Missbrauch dieser Stoffe (Sicherung gegen Terrorismus) bezeichnet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Rechtsfragen der Genomeditierung im Zusammenhang mit der Gefahr des Bioterrorismus nach nationalem und internationalem Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161765