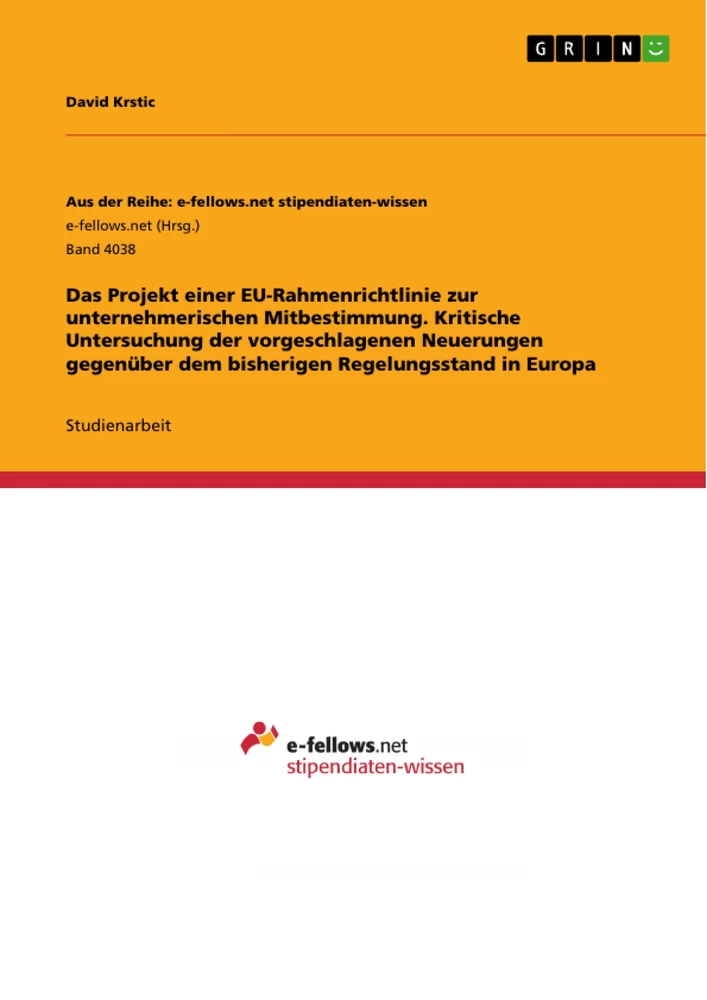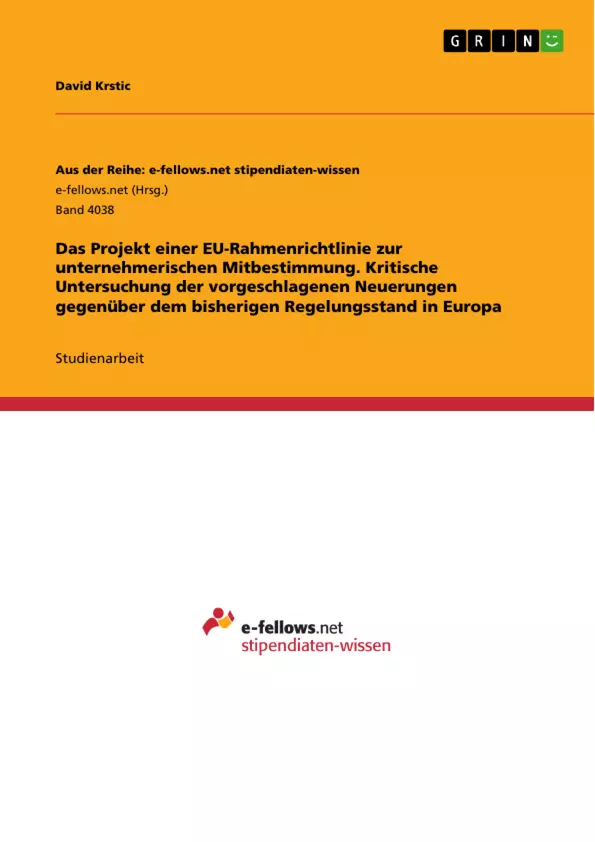Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit dem insbesondere vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) erarbeiteten Vorschlag für eine EU-Rahmenrichtlinie zur unternehmerischen Mitbestimmung. Nach einer Bestandsaufnahme zur aktuellen (jüngst erneut modifizierten) Rechtslage zur unternehmerischen Mitbestimmung in Europa, stellt der Verfasser das vorgeschlagene Projekt ausführlich dar und erläutert, inwiefern hierdurch ein Mehr an Mitbestimmung erreicht werden könnte. Anschließend findet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Vorschlag des DGB statt sowie eine Skizzierung möglicher alternativer Regelungskonzepte.
Inhaltsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Projekt einer EU-Rahmenrichtlinie zur Mitbestimmung und dem angestrebten Mehr gegenüber dem bisherigen Regelungsstand in Europa. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser Richtlinie auf die europäische Unternehmenslandschaft und die Bedeutung der Mitbestimmung in der modernen Arbeitswelt.
- Die Auswirkungen einer EU-Rahmenrichtlinie zur Mitbestimmung auf das europäische Unternehmensrecht
- Der Mehrwert der Richtlinie gegenüber dem bisherigen Regelungsstand in Europa
- Die Bedeutung der Mitbestimmung in der modernen Arbeitswelt
- Die Regulierung von grenzüberschreitenden Unternehmensfusionen und -spaltungen
- Die Rolle der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs im Prozess der Gesetzgebung und Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund des Projekts einer EU-Rahmenrichtlinie zur Mitbestimmung skizziert. Im Anschluss daran werden die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der Mitbestimmung in Deutschland und der Europäischen Union erläutert. Die Arbeit analysiert dann die aktuellen Herausforderungen der europäischen Mitbestimmung im Kontext der Globalisierung und der Digitalisierung. Im Fokus stehen dabei die Auswirkungen von Unternehmensfusionen und -spaltungen auf die Mitbestimmung sowie die Rolle der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs im Prozess der Gesetzgebung und Rechtsprechung.
Schlüsselwörter
EU-Rahmenrichtlinie, Mitbestimmung, Unternehmensrecht, Europäisches Wirtschaftsrecht, Globalisierung, Digitalisierung, Unternehmensfusionen, Unternehmens-spaltungen, Europäische Kommission, Europäischer Gerichtshof.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der vorgeschlagenen EU-Rahmenrichtlinie zur Mitbestimmung?
Ziel ist es, einheitliche Mindeststandards für die unternehmerische Mitbestimmung in Europa zu schaffen, um Arbeitnehmerrechte auch bei grenzüberschreitenden Fusionen zu sichern.
Welche Rolle spielt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bei diesem Projekt?
Der DGB hat den maßgeblichen Vorschlag für die EU-Rahmenrichtlinie erarbeitet, um ein "Mehr" an Mitbestimmung gegenüber dem aktuellen Rechtsstand zu erreichen.
Warum sind grenzüberschreitende Fusionen eine Herausforderung für die Mitbestimmung?
Oft werden Fusionen genutzt, um nationale Mitbestimmungsregeln zu umgehen. Die Richtlinie soll sicherstellen, dass Mitbestimmungsniveaus durch solche Transaktionen nicht herabgesetzt werden.
Welche Institutionen beeinflussen die europäische Mitbestimmungsgesetzgebung?
Maßgeblich sind die Europäische Kommission als Initiator von Richtlinien sowie der Europäische Gerichtshof (EuGH) durch seine richtungsweisende Rechtsprechung.
Gibt es alternative Konzepte zur vorgeschlagenen Rahmenrichtlinie?
Die Arbeit skizziert alternative Regelungskonzepte, die eine flexiblere oder stärker auf nationalen Traditionen basierende Lösung für die europäische Unternehmensebene vorsehen.
- Arbeit zitieren
- David Krstic (Autor:in), 2020, Das Projekt einer EU-Rahmenrichtlinie zur unternehmerischen Mitbestimmung. Kritische Untersuchung der vorgeschlagenen Neuerungen gegenüber dem bisherigen Regelungsstand in Europa, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161882