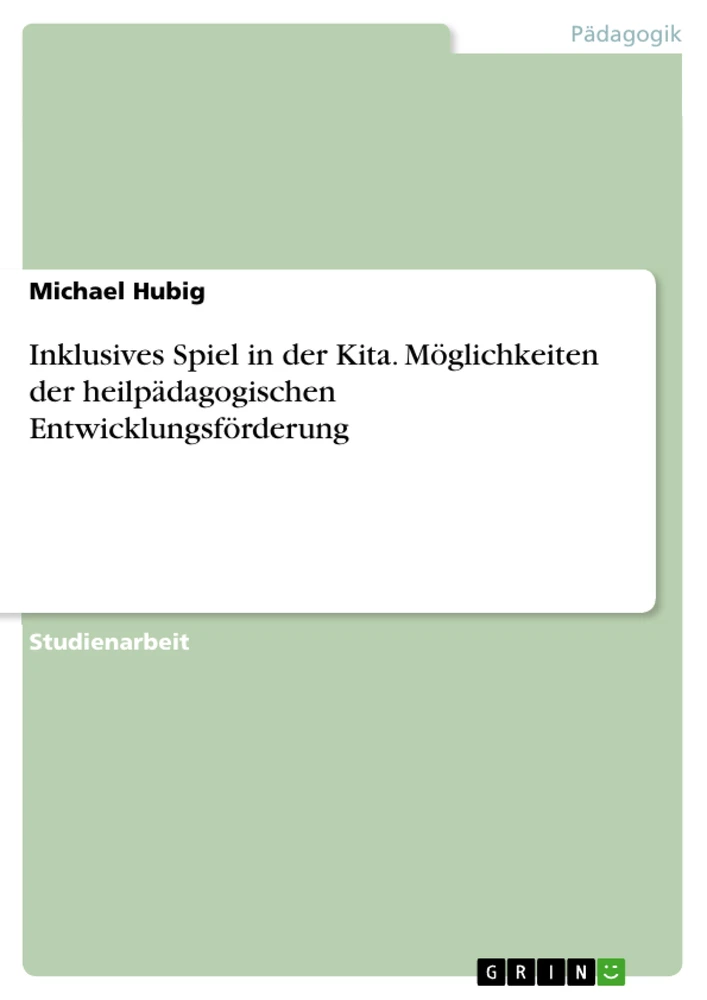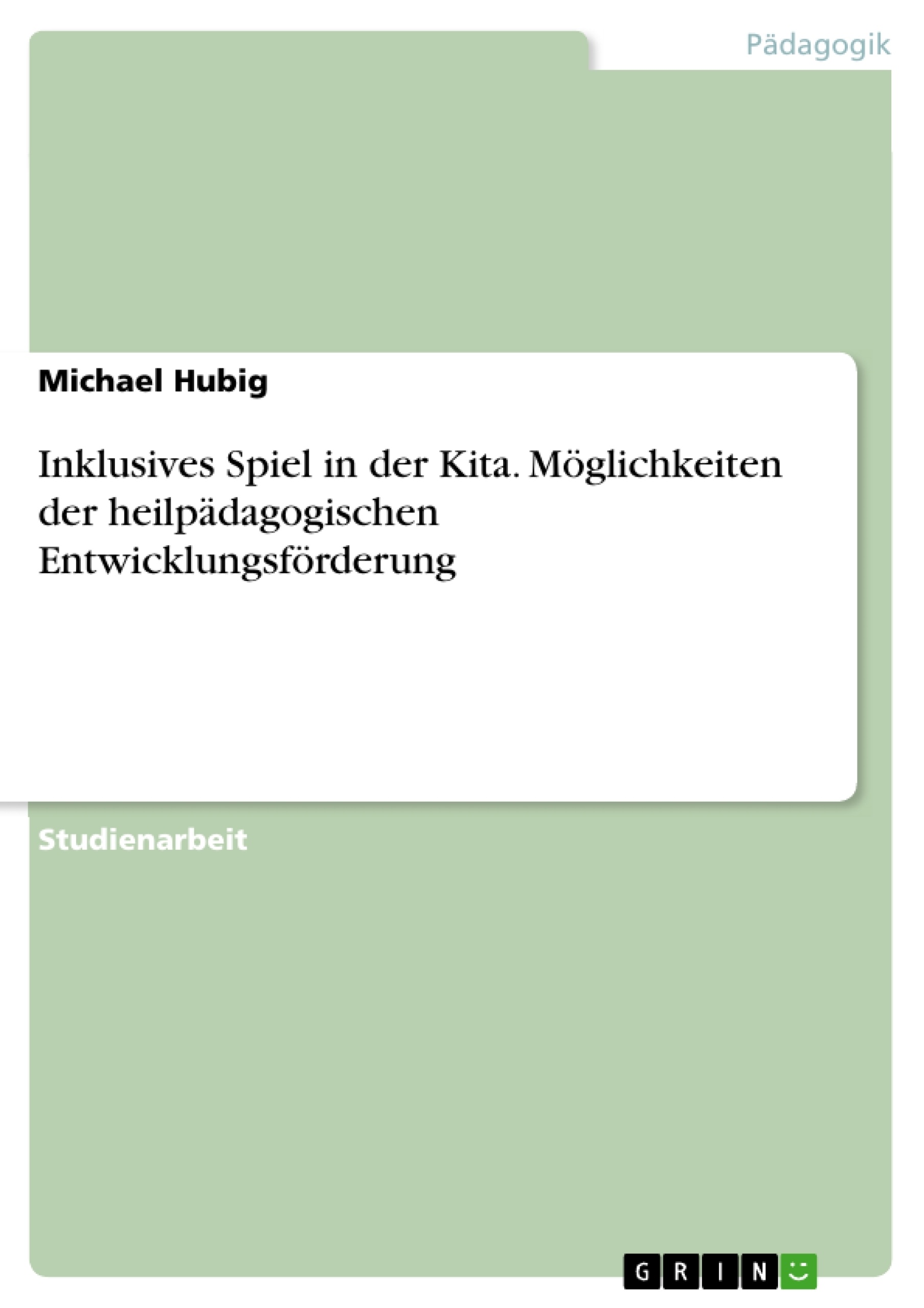In dieser Arbeit geht es um entwicklungsförderliche Spielgestaltungsmöglichkeiten in Regelkindergärten, inklusiven Kindergärten sowie Förderkindergärten. Während in Förderkindergärten ausdifferenziert wird, um eine optimierte, förderbedarfsspezifische Förderung zu erreichen, sind sowohl in Regelkindergärten, als auch in inklusiven Kindergärten, bei unterschiedlichen Rahmenbedingen Kinder mit und ohne Förderbedarf zu finden. Die Arbeit untersucht heilpädagogische Gestaltungsmöglichkeiten von inklusiven Spielsituationen in Regelkindergärten und inklusiven Kindergärten. Dabei soll dargestellt werden, welche Methodik in der inklusiven Spielgestaltung eine entwicklungsförderliche Auswirkung gleichermaßen für Kinder mit und ohne Förderbedarf darstellt. Dabei soll in dieser Arbeit in besonderem Masse die Gruppe der Kinder mit „geistigen Behinderungen“ berücksichtigt werden.
Der inklusive Leitgedanke gemäß Behindertenrechtskonvention kennt keine separierten Gruppen, dies bedeutet in der Konsequenz, dass nicht nur eine Ausgrenzung aufgrund eines Förderbedarfs zu vermeiden ist, sondern letztlich jegliche denkbare, z.B. auch durch Ethnizität oder Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen. Im Gegensatz zu vielen Regelkindergärten werden in inklusiven Kitas Abweichungen von der Norm nicht nur im positiven Sinne angenommen, sondern diese als Vielfalt ausdrücklich willkommen geheißen. Ein anderer kultureller Hintergrund wird hier z.B. eher als Vorteil interpretiert. Eine solche Kita ist als ein Ort des Lebens und Lernen für alle zu verstehen. Während der inklusive Leitgedanke in Regelkindergärten durch Zuteilung von Unterstützungsressourcen entsprechend den jeweiligen Bedarfen erfolgt, ist das Potenzial und Know-How in inklusiven Kindergärten systemimmanent. Erforderliche Veränderungen in konzeptioneller, personeller und baulicher Hinsicht sind hier im Idealfall gegeben bzw. abgeschlossen.
Neben dem Abbau von Barrieren auf allen Ebenen ist es eine Kernaufgabe, Lern- und Spielsituationen so zu gestalten, dass alle Kinder uneingeschränkt an den Angeboten teilnehmen können und diese Spielsituationen zum gemeinsamen Spiel aller Kinder miteinander einladen und sich hier keine homogenen Gruppen bilden. Die besondere Herausforderung ist hier, dass diese inklusiven Spielsituationen nicht nur von allen gleichermaßen nutzbar sind, sondern auch für alle Kinder eine entwicklungsförderliche Wirkung beinhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gestaltung des inklusiven Spiels in der Kita
- Umsetzung des inklusiven Leitgedankens
- Besonderheiten des inklusiven Spiels in der Kita
- Aufbau der Arbeit
- Inklusive Lern- und Spielsituationen
- Methodik und Didaktik einer entwicklungsförderlichen Gestaltung
- Bedeutung des kindlichen Spiels für die pädagogische Arbeit
- Lern- und Spielsituationen in Kitas aus heilpädagogischer Perspektive
- Gestaltung eines entwicklungsförderlichen Spielumfelds
- Umsetzung der inklusiven Spielgestaltung in der Kita
- Kinder mit geistiger Behinderung in der Kita
- Optionen der Spielgestaltung für Kinder mit geistiger Behinderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gestaltungsmöglichkeiten von inklusiven Spielsituationen in Regelkindergärten und inklusiven Kindergärten zu untersuchen und dabei die Methodik und Didaktik einer entwicklungsförderlichen Spielgestaltung für Kinder mit und ohne Förderbedarf aufzuzeigen. Besonderer Fokus liegt auf der Gruppe der Kinder mit "geistigen Behinderungen".
- Entwicklungsförderliche Spielgestaltung für Kinder mit und ohne Förderbedarf
- Methodik und Didaktik des inklusiven Spielens in der Kita
- Bedeutung des Spiels für die pädagogische Arbeit in inklusiven Settings
- Besondere Herausforderungen bei der Gestaltung inklusiver Spielsituationen für Kinder mit geistiger Behinderung
- Umsetzung des inklusiven Leitgedankens in Kindertagesstätten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des inklusiven Spiels in der Kita und stellt den aktuellen Stand des Inklusionsprozesses in Deutschland dar. Sie erläutert auch die Besonderheiten des inklusiven Spiels und die Herausforderungen, die sich bei der Gestaltung von Spielsituationen ergeben, die für alle Kinder entwicklungsförderlich sind. Anschließend wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des kindlichen Spiels für die pädagogische Arbeit und betrachtet Lern- und Spielsituationen in Kitas aus heilpädagogischer Perspektive. Es stellt auch die Gestaltung eines entwicklungsförderlichen Spielumfelds in den Vordergrund, wobei die Umsetzung der inklusiven Spielgestaltung in der Kita und die besonderen Herausforderungen für Kinder mit geistiger Behinderung im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Spiel, Kita, Kinder mit Förderbedarf, geistige Behinderung, Entwicklungsförderung, Methodik, Didaktik, inklusive Spielgestaltung, heilpädagogische Perspektive.
- Quote paper
- Michael Hubig (Author), 2021, Inklusives Spiel in der Kita. Möglichkeiten der heilpädagogischen Entwicklungsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163089