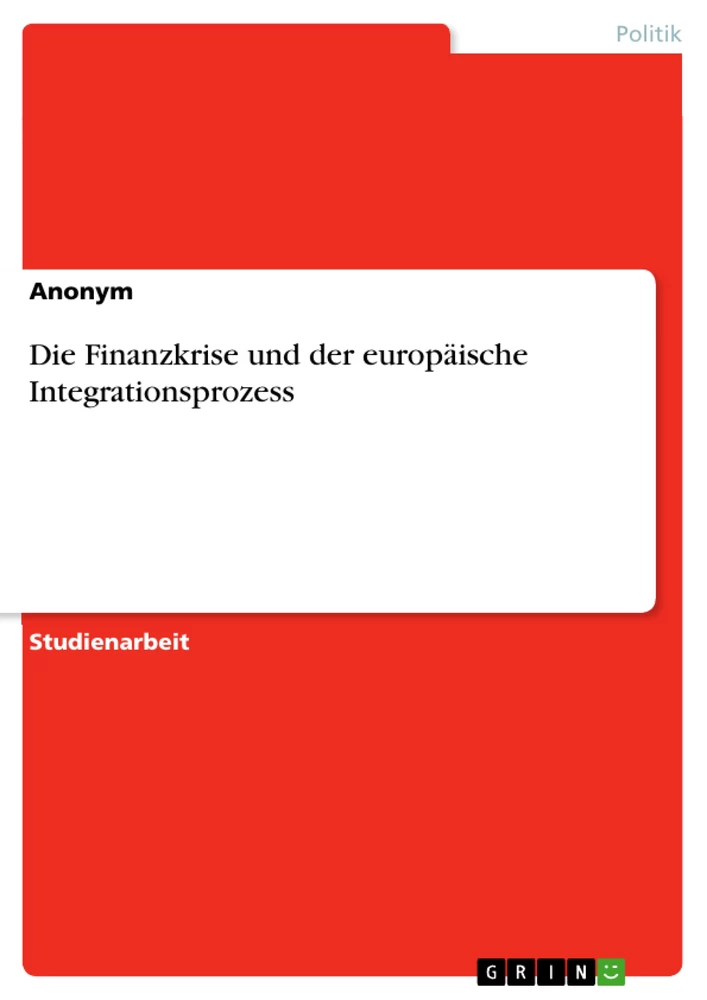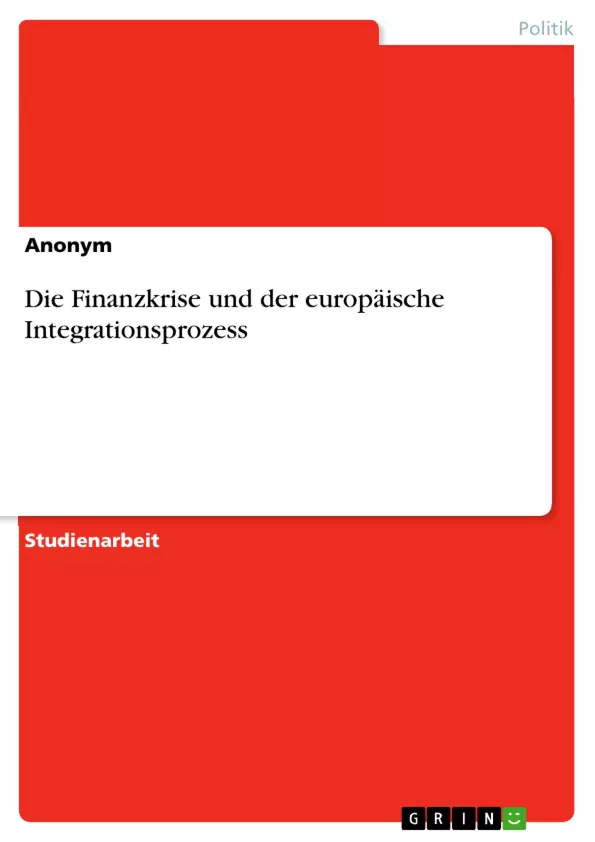Diese Arbeit analysiert, inwiefern die Finanzkrise den europäischen Integrationsprozess prägte.
Die Geschichte der europäischen Integration, die mit der Gründung der Montanunion im Jahr 1952 ihren Anfang nahm, ist voller bedeutsamer Ereignisse. Zweifelsohne gehört die Weltfinanzkrise mit ihren zahlreichen Folgekrisen zu den einschneidendsten Vorfällen der europäischen Geschichte, deren Auswirkungen die Europäische Union (EU) bis heute prägen. Mit dem Platzen einer Immobilienblase in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) wurde 2007 eine verheerende Kettenreaktion ausgelöst, die in kürzester Zeit die international vernetzte Finanzwelt und später ganze Staaten erschütterte.
Noch im September 2008 äußerte der damalige Finanzminister Peer Steinbrück: "Die Finanzmarktkrise ist vor allem ein amerikanisches Problem." Wie falsch er mit dieser Einschätzung lag, sollte die EU nur kurze Zeit später erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Theoretische Reflektion...
- Ursachen und Vorgeschichte
- Das Versagen des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP).
- Das europäische Integrationsgeschehen unmittelbar vor der Finanzkrise .......
- Die Dynamik der Finanzkrise.......
- Irland als erstes Krisenopfer ....
- Beginn der Staatsschuldenkrise.
- Die europäischen Stabilitätsmechanismen und Reformen.......
- Der Euro-Rettungsschirm (EFSM, EFSF und ESM).
- Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts (Sixpack).......
- Europäischer Fiskalpakt..
- Europäische Bankenunion ......
- Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern die Finanzkrise den europäischen Integrationsprozess prägte. Es wird argumentiert, dass die Finanzkrise als Katalysator für den europäischen Integrationsprozess fungierte. Dazu werden die zentralen Begrifflichkeiten der Arbeit reflektiert und der theoretische Hintergrund erläutert. Es folgt eine historische Einordnung der Ereignisse, bevor der Integrationsprozess in Bezug auf ausgewählte politische Reformen untersucht wird.
- Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Europäische Union (EU).
- Die Rolle des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (SWP) in der Finanzkrise.
- Die Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses vor und nach der Finanzkrise.
- Die europäischen Stabilitätsmechanismen und Reformen in Reaktion auf die Finanzkrise.
- Die Rolle des Intergouvernementalismus und Supranationalismus im europäischen Integrationsprozess.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Finanzkrise für den europäischen Integrationsprozess dar und erläutert die These, dass die Krise als Katalysator für den Integrationsprozess fungierte. Außerdem werden die wichtigsten Themen und Kapitel der Arbeit vorgestellt.
- Theoretische Reflektion: Dieses Kapitel klärt die Betrachtungsperspektive der Arbeit und definiert die zentralen Begriffe wie Integration, Intergouvernementalismus, Supranationalismus, Souveränität und Autonomie.
- Ursachen und Vorgeschichte: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen der Finanzkrise, wobei vor allem auf das Versagen des SWP, die Weltfinanzkrise und den Beginn der Euro-Krise eingegangen wird.
- Die europäischen Stabilitätsmechanismen und Reformen: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen europäischen Stabilitätsmechanismen und Reformen, die in Reaktion auf die Finanzkrise eingeführt wurden, darunter der Euro-Rettungsschirm, die Reform des SWP, der Europäische Fiskalpakt und die Europäische Bankenunion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die europäischen Integration, die Finanzkrise, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Euro-Krise, den Euro-Rettungsschirm, den europäischen Fiskalpakt, die Europäische Bankenunion, Intergouvernementalismus, Supranationalismus, Souveränität und Autonomie. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Finanzkrise auf den europäischen Integrationsprozess, die Rolle des SWP in der Krise, die Entwicklung des Integrationsprozesses vor und nach der Krise, die europäischen Stabilitätsmechanismen und Reformen, sowie die Rolle des Intergouvernementalismus und Supranationalismus im Integrationsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Finanzkrise die europäische Integration beeinflusst?
Die Finanzkrise fungierte als Katalysator, der die EU zu tiefergreifenden Reformen und einer engeren wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit zwang.
Was war das Problem am Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP)?
Der SWP erwies sich als unzureichend, um die Verschuldung der Mitgliedstaaten wirksam zu begrenzen, was den Ausbruch der Staatsschuldenkrise begünstigte.
Was sind EFSM, EFSF und ESM?
Dies sind verschiedene Stabilitätsmechanismen (Euro-Rettungsschirme), die geschaffen wurden, um zahlungsunfähigen EU-Staaten finanzielle Unterstützung zu gewähren und den Euro zu sichern.
Was beinhaltet die Europäische Bankenunion?
Die Bankenunion zielt darauf ab, die Bankenaufsicht und -abwicklung auf europäischer Ebene zu zentralisieren, um künftige Finanzkrisen zu verhindern.
Was bedeutet "Supranationalismus" in diesem Kontext?
Supranationalismus beschreibt die Übertragung von nationalen Hoheitsrechten auf die europäische Ebene, was durch die Krisenmaßnahmen deutlich verstärkt wurde.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Die Finanzkrise und der europäische Integrationsprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163343