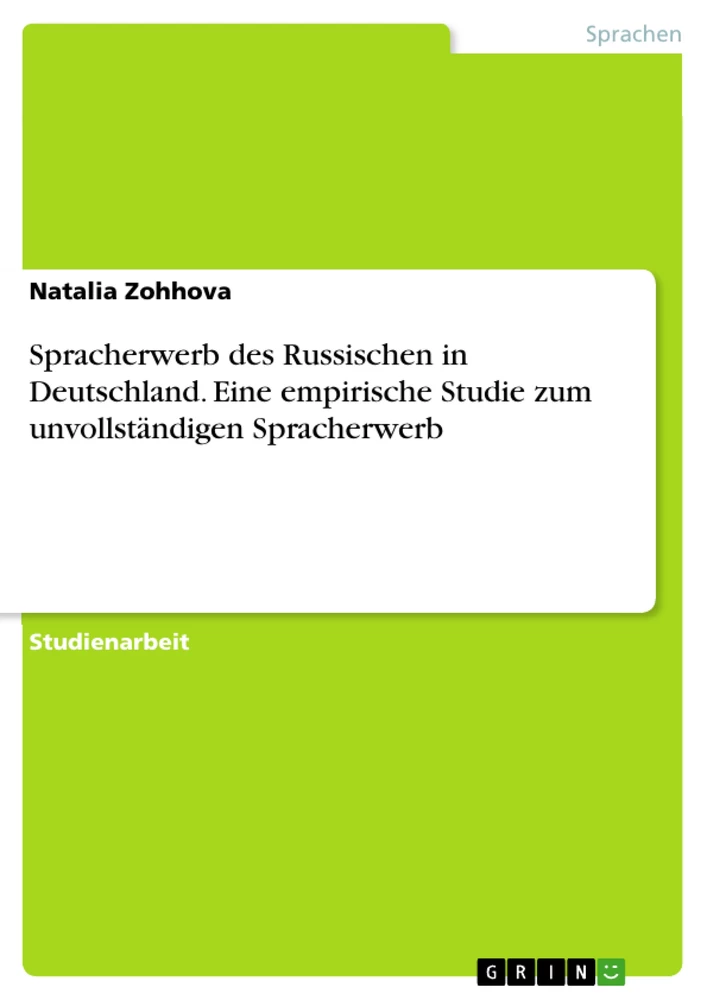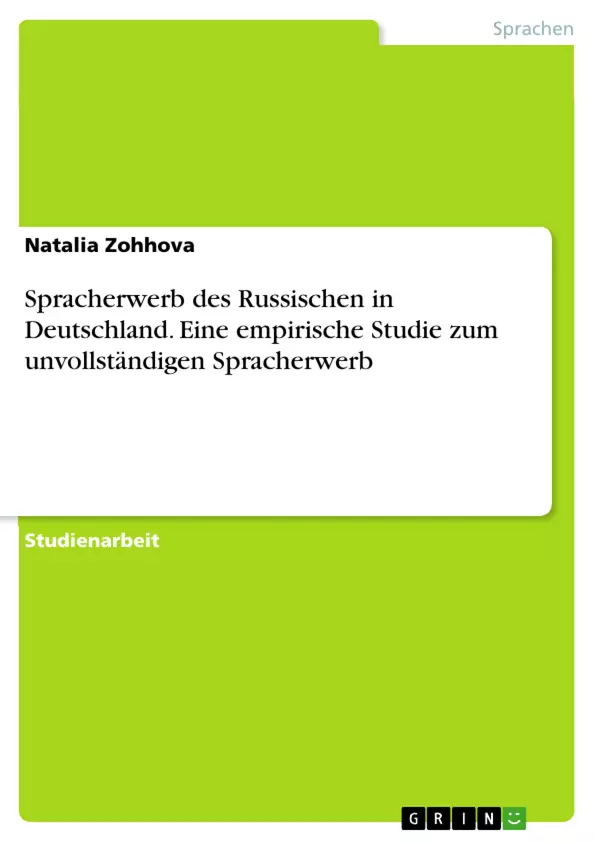Zweisprachigkeit bzw. Mehrsprachigkeit stellt ein kontroverses Thema in der Wissenschaft dar, zumal die Sprache selbst traditionsbedingt oft einem bestimmten Staat zugewiesen wird, der bis auf einige Ausnahmefälle als einsprachig gilt. Insbesondere in Deutschland haben sich jedoch durch mehrere Zuwanderungswellen verschiedene Sprachgruppen gebildet. Die russischsprachige Gesellschaft bildet dabei eine der größten Sprachminderheiten Deutschlands. Während die erste Generation die russische Sprache als Muttersprache gelernt und perfektioniert hat, stellt das Erlernen der russischen Sprache für die zweite Generation, also die Nachkommen der ersten Generation, die bis zum 3. Lebensjahr immigriert oder bereits in Deutschland geboren wurden, eine Herausforderung dar. Sie lernen die Sprache in einer Umgebung, die ihre Sprache nicht beherrscht, sondern eine ganz andere, meist kaum verwandte Sprache spricht. Die Nutzung der Sprache ist daher auf bestimmte Areale des Lebens minimiert.
Es stellt sich die Frage, inwieweit das Erlernen der russischen Sprache innerhalb einer deutschen Umgebung möglich gemacht werden kann und ob es einen sprachlichen Unterschied bzw. sprachliche Defizite mit sich bringt. Die
folgende Arbeit soll diese Frage behandeln und untersuchen, in welchen Bereichen der Sprache der Spracherwerb unvollständig bleibt. Dafür beschäftigt sich die folgende Arbeit zunächst mit dem theoretischen Teil und den bereits vorhandenen Studien zum bilingualen Spracherwerb bzw. dem Spracherwerb einer Herkunftssprache in einem Land mit einer anderen Umgebungssprache. Anschließend soll anhand Untersuchungen zweier Probanden exemplarisch dargestellt werden, welche Merkmale des unvollständigen Spracherwerbs die Herkunftssprecher aufzeigen. Diese sollen
nicht nur die Frage beantworten, inwiefern Einwandererkinder die russische Sprache selbst beherrschen, sondern auch eventuelle Vorhersagen treffen können, ob die nachfolgende Generation weiterhin zur russischen Sprachminderheit gehören wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Generation der Herkunftssprache und Herkunftssprecher
- 3. Spracherwerb
- 3.1. Spracherwerbsgruppen
- 3.2. Arten des Spracherwebs
- 3.3. Spracherwerb und dessen Folgen
- 3.4. Gründe für einen sprachlichen Transfer
- 3.5. Exkurs: Attrition vs. Unvollständiger Spracherwerb
- 4. Empirische Untersuchung des unvollständigen Spracherwerbs
- 4.1. Methode
- 4.2. Analyse
- 4.2.1. Elisabeth
- 4.2.2. Anastasia
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den unvollständigen Spracherwerb des Russischen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ziel ist es, die Besonderheiten des Spracherwerbs einer Herkunftssprache in einem mehrsprachigen Umfeld zu analysieren und die Auswirkungen auf die Sprachkompetenz der Nachkommen von russischsprachigen Migranten zu beleuchten.
- Der Einfluss der Umgebungssprache auf den Erwerb der Herkunftssprache
- Die Unterschiede zwischen Muttersprachlern und Herkunftssprechern des Russischen
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten des Spracherwerbs in einem mehrsprachigen Umfeld
- Die Rolle der Familie und der Gesellschaft beim Erhalt der Herkunftssprache
- Die Frage, ob der unvollständige Spracherwerb langfristige Auswirkungen auf die Sprachkompetenz der Nachkommen hat
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der mehrsprachigen Sprachentwicklung ein und beleuchtet die Besonderheiten des Spracherwerbs des Russischen in Deutschland. Kapitel 2 definiert die Begriffe "Herkunftssprache" und "Herkunftssprecher" und erläutert die spezifischen Herausforderungen, denen diese Sprechergruppe gegenübertritt. In Kapitel 3 werden verschiedene Aspekte des Spracherwerbs untersucht, darunter die Spracherwerbsgruppen, Arten des Spracherwerbs, die Folgen des Spracherwerbs und die Gründe für einen sprachlichen Transfer. Kapitel 4 analysiert exemplarisch den unvollständigen Spracherwerb anhand von zwei Probanden und untersucht die sprachlichen Defizite und Besonderheiten. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung und einem Fazit in Kapitel 5 abgeschlossen.
Schlüsselwörter
Herkunftssprache, Herkunftssprecher, Spracherwerb, mehrsprachig, unvollständiger Spracherwerb, Sprachentwicklung, russische Sprache, deutsche Sprache, Migrationsgesellschaft, Sprachkompetenz, empirische Studie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „unvollständigem Spracherwerb“?
Es beschreibt den Fall, dass eine Herkunftssprache (z. B. Russisch) in einem Umfeld mit einer anderen Dominanzsprache (z. B. Deutsch) nicht in vollem Umfang oder fehlerhaft erlernt wird.
Wer sind „Herkunftssprecher“?
Herkunftssprecher sind Personen, die mit einer Sprache zu Hause aufgewachsen sind, diese aber aufgrund des Einflusses der Umgebungssprache nicht perfekt beherrschen.
Was ist der Unterschied zwischen Attrition und unvollständigem Erwerb?
Attrition bezeichnet den Verlust einer bereits voll erworbenen Sprache, während unvollständiger Erwerb bedeutet, dass die Sprache nie vollständig gelernt wurde.
Warum ist die russischsprachige Minderheit in Deutschland besonders?
Sie bildet eine der größten Sprachminderheiten, wobei die zweite Generation oft vor der Herausforderung steht, Russisch in einer fast rein deutschen Umgebung zu bewahren.
Welche Rolle spielt die Familie beim Spracherwerb?
Die Familie ist oft der einzige Ort, an dem die Herkunftssprache genutzt wird. Bleibt die Nutzung dort minimal, entstehen oft Defizite in Grammatik und Wortschatz.
- Arbeit zitieren
- Natalia Zohhova (Autor:in), 2020, Spracherwerb des Russischen in Deutschland. Eine empirische Studie zum unvollständigen Spracherwerb, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163844