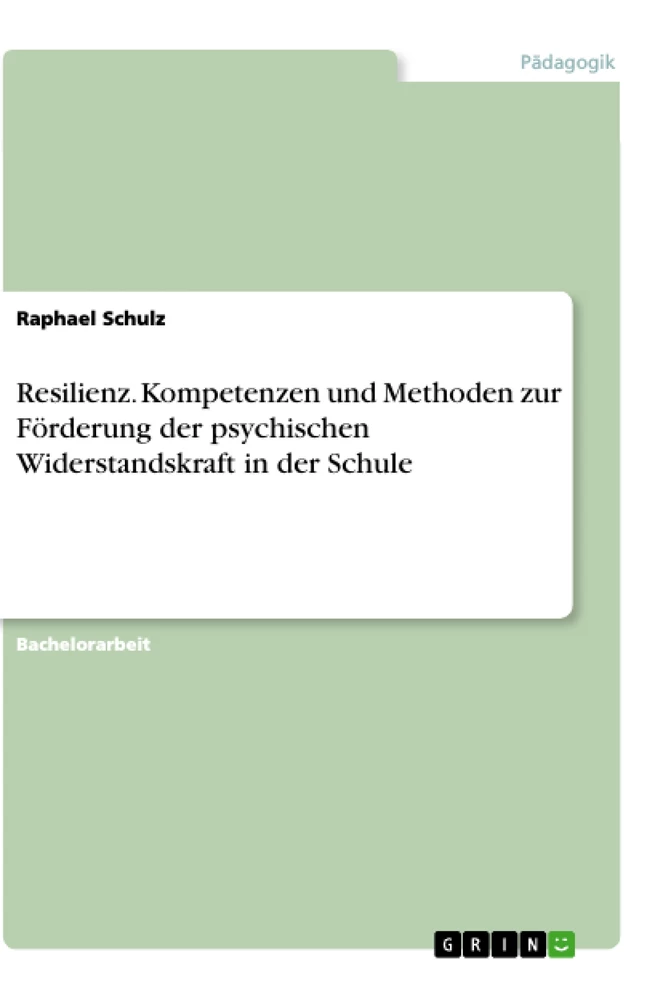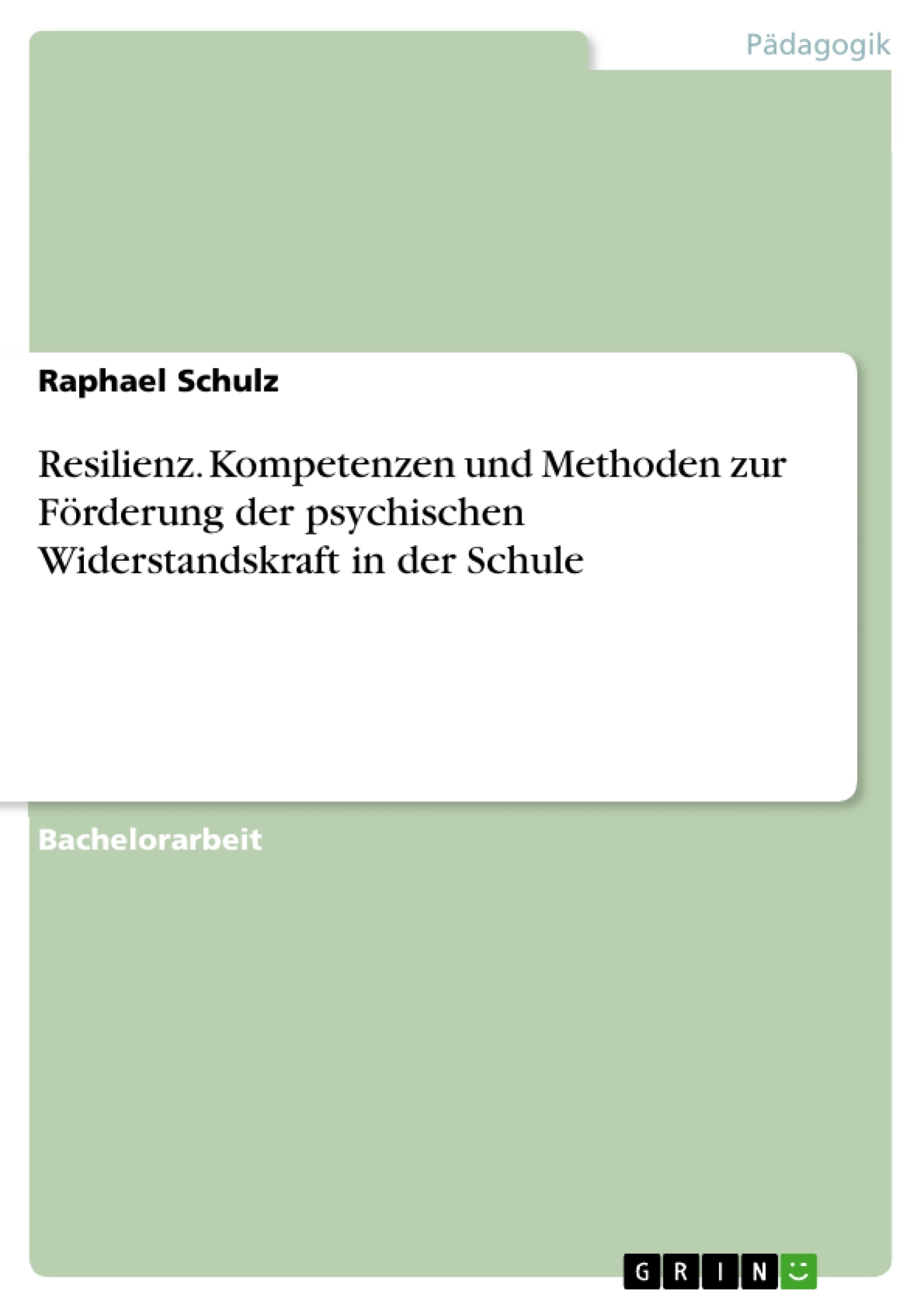Die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist ein wesentliches Ziel der Pädagogik auch in der Schule. In dieser Arbeit wird Resilienz (seelische Widerstandsfähigkeit) speziell für den Bereich von schulischer Pädagogik behandelt, um Lehrern, Eltern und anderen Bezugspersonen, die auf die Entwicklung der Kinder positiven Einfluss ausüben wollen, für dieses Thema zu sensibilisieren. Eingegrenzt wird das Thema einerseits auf die Darstellung und Untersuchung resilienzfördernder Methoden, die in der Schule Anwendung finden und andererseits auf die Kompetenzen, die der Lehrer braucht, um resilienzfördernden Unterricht zu gestalten.
Vorausgesetzt, dass Resilienz durch pädagogisches Verhalten und Maßnahmen bei Kindern in der Schule gestärkt werden kann, ergeben sich folgende Schlüsselfragen für die Praxis, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen: Welche Methoden zur Förderung der Resilienz gibt es, die schon erfolgreich in der Schule angewendet werden? Welche Kompetenzen des Lehrers sind erforderlich für einen resilienzfördernden Unterricht?
Dies ist eine literaturbasierte Arbeit. Ihr liegt eine systematische Literaturrecherche zugrunde mit dem Ziel die Fragestellungen auf Grundlage des aktuellen Forschungsstands zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systematische Literaturrecherche
- Resilienz
- Vorläufer und verwandte Forschungsgebiete
- Bindungstheorie
- Salutogenese
- Coping
- Resilienzforschung
- Pioniere der Resilienzforschung
- Aktueller Forschungsstand
- Resilienzbegriff und Resilienzdebatte
- Vorläufer und verwandte Forschungsgebiete
- Resilienzförderung
- Grundlagen der Resilienzförderung
- Vorschulische Resilienzförderung
- Resilienzförderung in der frühen Kindheit
- Resilienzförderung in Kita, Kindergarten und Vorschule
- Methoden zur Resilienzförderung in der Schule
- Schulischer Bildungsauftrag
- Beispiele resilienzfördernder Methoden in der Schule
- Service-Learning/Lernen-durch-Engagement
- Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen – PRiGS
- Kompetenzen zur Resilienzförderung in der Schule
- Schule als Risiko- oder Schutzfaktor
- Lehrerkompetenzen
- Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung von Resilienz im schulischen Kontext. Ziel ist es, Methoden zur Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen und die dafür notwendigen Lehrerkompetenzen zu identifizieren. Die Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturrecherche.
- Resilienz als Konzept und seine theoretischen Grundlagen
- Methoden der Resilienzförderung in der Schule
- Notwendige Lehrerkompetenzen für resilienzfördernden Unterricht
- Resilienzförderung in der frühen Kindheit und Vorschule
- Beispiele erfolgreicher Programme zur Resilienzförderung (z.B. PRiGS)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Resilienz ein und erläutert die Bedeutung der psychischen Widerstandsfähigkeit für Kinder und Jugendliche. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit: Welche Methoden zur Förderung der Resilienz gibt es in der Schule, und welche Kompetenzen benötigen Lehrer für einen resilienzfördernden Unterricht? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und begründet die Relevanz des Themas.
Systematische Literaturrecherche: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Literaturrecherche. Es werden die verwendeten Datenbanken (EBSCOhost, PubPsych, PsychSpider) und die Suchstrategie detailliert dargestellt, inklusive der verwendeten Suchbegriffe und der Vorgehensweise bei der Auswahl relevanter Literatur. Die Beschreibung der verwendeten Datenbanken und Suchstrategien gewährleistet die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Forschungsarbeit.
Resilienz: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über das Konzept der Resilienz. Es beleuchtet Vorläufermodelle wie Bindungstheorie, Salutogenese und Coping und analysiert den aktuellen Forschungsstand zur Resilienzforschung. Der Fokus liegt auf der Definition des Begriffs und den verschiedenen Facetten der Resilienzdebatte, was ein fundiertes Verständnis für die folgenden Kapitel schafft.
Resilienzförderung: Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Resilienzförderung und betrachtet die Bedeutung der Förderung der psychischen Widerstandsfähigkeit bereits in der vorschulischen Bildung. Es werden die essentiellen Faktoren und Strategien der Resilienzförderung in der frühen Kindheit sowie im Kita- und Kindergartenbereich erläutert. Es bildet somit die Grundlage für die Betrachtung der schulischen Resilienzförderung in den folgenden Kapiteln.
Methoden zur Resilienzförderung in der Schule: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Methoden zur Resilienzförderung im schulischen Kontext. Es untersucht den schulischen Bildungsauftrag im Hinblick auf die Förderung von Resilienz und stellt konkrete Beispiele resilienzfördernder Methoden vor. Zwei ausgewählte Methoden werden detaillierter betrachtet, da sie bereits in deutschen Schulen Anwendung finden (z.B. Service-Learning und PRiGS). Diese detaillierte Betrachtung verschiedener Methoden ermöglicht es, die Vielfältigkeit und den Praxisbezug der Resilienzförderung im Unterricht darzustellen.
Kompetenzen zur Resilienzförderung in der Schule: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kompetenzen, die Lehrer für einen erfolgreichen resilienzfördernden Unterricht benötigen. Es analysiert die Rolle der Schule als Risiko- oder Schutzfaktor und beschreibt die spezifischen Lehrerkompetenzen, die zur Stärkung der Resilienz bei Schülern beitragen. Darüber hinaus werden Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs für Lehrer beleuchtet.
Schlüsselwörter
Resilienz, Resilienzförderung, Schule, Lehrerkompetenzen, psychische Widerstandsfähigkeit, Methoden, Prävention, frühe Kindheit, Service-Learning, PRiGS, Bindungstheorie, Salutogenese, Coping.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Förderung von Resilienz im schulischen Kontext
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Förderung von Resilienz im schulischen Kontext. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Resilienz, präsentiert Methoden zur Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen und identifiziert die dafür notwendigen Lehrerkompetenzen. Die Arbeit beinhaltet eine systematische Literaturrecherche und umfasst Kapitel zur Einleitung, der Methodik der Literaturrecherche, dem Resilienzkonzept, der Resilienzförderung (inkl. vorschulischer Förderung), Methoden der Resilienzförderung in der Schule (mit Beispielen wie Service-Learning und PRiGS), notwendigen Lehrerkompetenzen und einem Resümee. Schlüsselwörter umfassen Resilienz, Resilienzförderung, Schule, Lehrerkompetenzen, psychische Widerstandsfähigkeit, Methoden, Prävention, frühe Kindheit, Service-Learning, PRiGS, Bindungstheorie, Salutogenese und Coping.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Resilienz als Konzept und seine theoretischen Grundlagen, Methoden der Resilienzförderung in der Schule, notwendige Lehrerkompetenzen für resilienzfördernden Unterricht, Resilienzförderung in der frühen Kindheit und Vorschule sowie Beispiele erfolgreicher Programme zur Resilienzförderung (z.B. PRiGS).
Welche Methoden der Resilienzförderung in der Schule werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Methoden zur Resilienzförderung im schulischen Kontext, untersucht den schulischen Bildungsauftrag im Hinblick auf die Förderung von Resilienz und stellt konkrete Beispiele resilienzfördernder Methoden vor. Zwei ausgewählte Methoden, die bereits in deutschen Schulen Anwendung finden (z.B. Service-Learning und PRiGS), werden detaillierter betrachtet.
Welche Lehrerkompetenzen werden für resilienzfördernden Unterricht benötigt?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Schule als Risiko- oder Schutzfaktor und beschreibt die spezifischen Lehrerkompetenzen, die zur Stärkung der Resilienz bei Schülern beitragen. Darüber hinaus werden Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs für Lehrer beleuchtet.
Wie wurde die Literaturrecherche durchgeführt?
Das Kapitel zur systematischen Literaturrecherche beschreibt detailliert die verwendete Methodik, inklusive der Datenbanken (EBSCOhost, PubPsych, PsychSpider), der Suchstrategie, der Suchbegriffe und der Vorgehensweise bei der Auswahl relevanter Literatur. Dies gewährleistet die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Forschungsarbeit.
Welche theoretischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet Vorläufermodelle wie Bindungstheorie, Salutogenese und Coping und analysiert den aktuellen Forschungsstand zur Resilienzforschung. Der Fokus liegt auf der Definition des Begriffs und den verschiedenen Facetten der Resilienzdebatte.
Welche Rolle spielt die frühe Kindheit in der Resilienzförderung?
Die Arbeit betrachtet die Bedeutung der Förderung der psychischen Widerstandsfähigkeit bereits in der vorschulischen Bildung. Es werden die essentiellen Faktoren und Strategien der Resilienzförderung in der frühen Kindheit sowie im Kita- und Kindergartenbereich erläutert.
Welche Programme zur Resilienzförderung werden beispielhaft genannt?
Die Arbeit nennt als Beispiel für erfolgreiche Programme zur Resilienzförderung "PRiGS" (Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Methoden zur Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen und die dafür notwendigen Lehrerkompetenzen zu identifizieren.
- Quote paper
- Raphael Schulz (Author), 2015, Resilienz. Kompetenzen und Methoden zur Förderung der psychischen Widerstandskraft in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163888