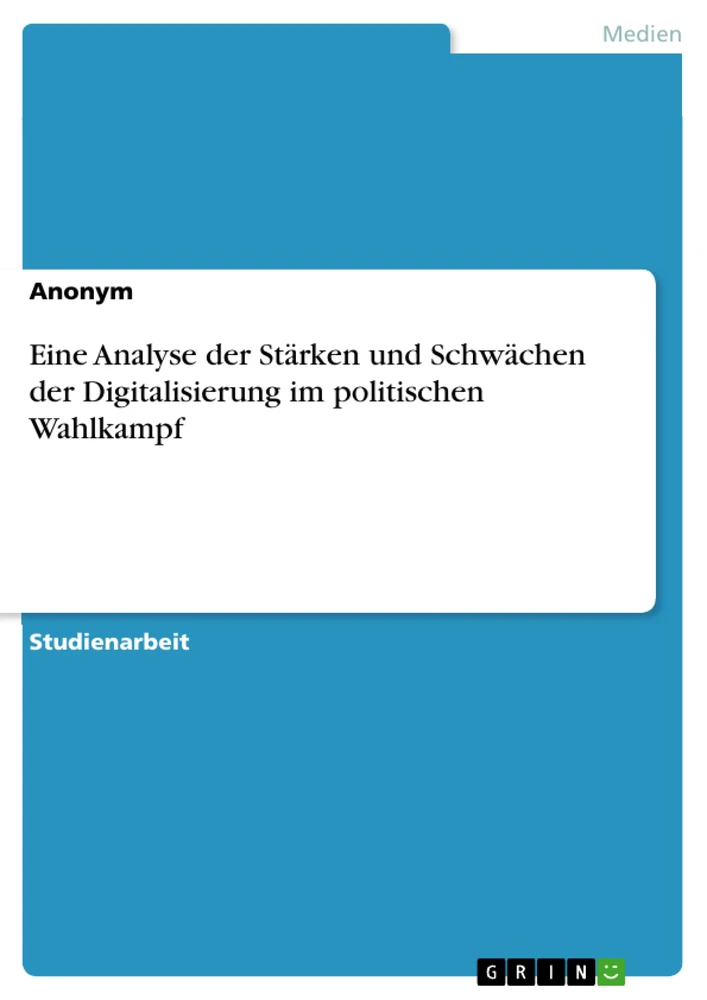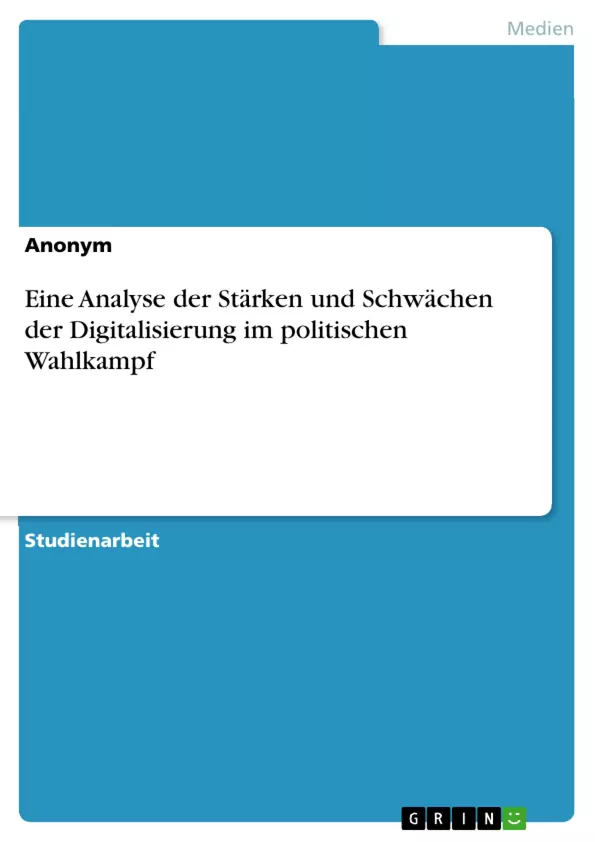In der folgenden Praxistransferarbeit wird zunächst einführend die Rolle der Politik auf Bundestagsebene und dessen gesetzlichen Richtlinien zum Thema Wahlkampf und auch Wahlkampfwerbung erklärt. Anschließend wird im Zusammenhang der Verschiebung der Informationskanäle, die Präsenz der Politik in den sozialen Medien und dessen systematische Digitalisierung im Wahlkampf aufgezeigt. Hier werden die zentralen Fragen, welche Schwächen in den Werkzeugen des digitalen Wahlkampfes liegen und welche Potentiale bei erfolgreicher digitaler Wahlwerbung ausgebaut oder aktualisiert werden müssen, beantwortet. Insbesondere die Manipulationswerkzeuge in sozialen Medien stellen eine zu analysierende Schwäche dar.
Im Anschluss der Stärken-Schwächen- Analyse mit den entsprechenden Wettbewerbsfaktoren des digitalen Wandels im deutschen Wahlkampf wird ein Wettbewerbsvergleich mit den USA in Hinblick auf dessen Präsidentschaftswahl 2020 durchgeführt. Es folgen Handlungsprognosen, um die digitalen Werkzeuge gewinnbringend in sozialen Netzwerken zu benutzen und den Ausbau der festgestellten Stärken sowie die Dekomposition der Schwächen für die digitale politische Kommunikation für die Bundestagswahl 2021 zu nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Begriffsdefinition des digitalen Wandels
- 2.2 Politische digitale Rahmenbedingungen auf Bundestagsebene
- 2.2.1 Strukturelle Veränderung der Bundestagsmandate
- 2.2.2 Gesetzlicher Rahmen des Wahlkampfes sowie der Wahlwerbung
- 2.3 Einordnung der sozialen Medien
- 2.4 Grundkonzept der Stärken-Schwächen-Analyse
- 3 Systematische Digitalisierung des Wahlkampfes
- 3.1 Politisches Bewusstsein neuer Zielgruppen
- 3.2 Funktionen und Arten der sozialen Medien in Deutschland
- 3.3 Analyse der Stärken und Schwächen des Wahlkampfes in der digitalen Demokratie
- 3.4 Wahlmanipulation in der digitalen Grauzone
- 3.5 Rechtliche Einordnung von Manipulationswerkzeugen
- 4 Politischer Online-Wahlkampf in den USA im Vergleich mit Deutschland
- 5 Prognose des strukturellen, digitalen Wandels der politischen Kommunikation in Deutschland
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen der Digitalisierung im deutschen politischen Wahlkampf. Sie untersucht den Einfluss des digitalen Wandels auf die politische Kommunikation, insbesondere im Kontext der Bundestagswahl 2021. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Rolle sozialer Medien im Wahlkampf, inklusive der Herausforderungen durch Wahlmanipulation.
- Digitaler Wandel im politischen Wahlkampf
- Rolle sozialer Medien in der politischen Kommunikation
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Wahlmanipulation
- Stärken-Schwächen-Analyse des digitalen Wahlkampfes
- Vergleich des digitalen Wahlkampfes in Deutschland und den USA
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Digitalisierung im politischen Wahlkampf ein und skizziert den Kontext der Arbeit. Sie verweist auf die Notwendigkeit des Aufholprozesses der Digitalisierung in der Politik, insbesondere im Angesicht der COVID-19 Pandemie, welche die Nutzung digitaler Medien verstärkt hat. Die Arbeit fokussiert sich auf die Bundestagswahl 2021 und untersucht die Stärken und Schwächen des digitalen Wahlkampfes auf Bundestagsebene, unter Berücksichtigung der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und der Herausforderungen durch Manipulationen in sozialen Medien. Der Fokus liegt auf der Analyse der digitalen Werkzeuge und deren effektiven Nutzung für den politischen Wahlkampf.
2 Theoretische Grundlagen: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse fest. Er definiert den digitalen Wandel, beleuchtet die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den Wahlkampf auf Bundesebene, inklusive der strukturellen Veränderungen der Bundestagsmandate und des gesetzlichen Rahmens für Wahlwerbung. Weiterhin wird die Rolle sozialer Medien und das Grundkonzept der verwendeten Stärken-Schwächen-Analyse erläutert. Der Abschnitt schafft ein solides Fundament für die anschließende empirische Analyse.
3 Systematische Digitalisierung des Wahlkampfes: Dieses Kapitel analysiert die systematische Digitalisierung des Wahlkampfes. Es untersucht das politische Bewusstsein neuer Zielgruppen, die Funktionen und Arten sozialer Medien in Deutschland, und führt eine detaillierte Stärken-Schwächen-Analyse des digitalen Wahlkampfes in der deutschen Demokratie durch. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Phänomen der Wahlmanipulation in der digitalen Grauzone und deren rechtlichen Einordnung. Dieser Abschnitt stellt einen Kern der Arbeit dar, indem er die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Wahlkampf beleuchtet.
4 Politischer Online-Wahlkampf in den USA im Vergleich mit Deutschland: Dieses Kapitel vergleicht den politischen Online-Wahlkampf in den USA (Präsidentschaftswahl 2020) mit dem in Deutschland. Dieser Vergleich dient dazu, Best-Practice-Beispiele und unterschiedliche Ansätze im Umgang mit der Digitalisierung im Wahlkampf zu identifizieren und zu analysieren. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse für die Verbesserung des deutschen Wahlkampfes.
5 Prognose des strukturellen, digitalen Wandels der politischen Kommunikation in Deutschland: Dieses Kapitel bietet Prognosen zum zukünftigen strukturellen, digitalen Wandel der politischen Kommunikation in Deutschland. Es basiert auf den vorherigen Analysen und bietet Handlungsempfehlungen zur gewinnbringenden Nutzung digitaler Werkzeuge in sozialen Netzwerken. Der Fokus liegt auf dem Ausbau von Stärken und der Bewältigung von Schwächen in der digitalen politischen Kommunikation im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021.
Schlüsselwörter
Digitalisierung, Wahlkampf, soziale Medien, politische Kommunikation, digitale Demokratie, Wahlmanipulation, Stärken-Schwächen-Analyse, Deutschland, USA, Bundestagswahl 2021, rechtliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Digitalen Wandels im Deutschen Politischen Wahlkampf
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen der Digitalisierung im deutschen politischen Wahlkampf, insbesondere im Kontext der Bundestagswahl 2021. Sie untersucht den Einfluss des digitalen Wandels auf die politische Kommunikation, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Rolle sozialer Medien, einschließlich der Herausforderungen durch Wahlmanipulation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse behandelt den digitalen Wandel im politischen Wahlkampf, die Rolle sozialer Medien in der politischen Kommunikation, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Wahlmanipulation, eine Stärken-Schwächen-Analyse des digitalen Wahlkampfes und einen Vergleich des digitalen Wahlkampfes in Deutschland und den USA.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Systematische Digitalisierung des Wahlkampfes, Politischer Online-Wahlkampf im Vergleich USA/Deutschland, Prognose des strukturellen, digitalen Wandels und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein. Die theoretischen Grundlagen definieren den digitalen Wandel und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das dritte Kapitel analysiert die Digitalisierung des Wahlkampfes, inklusive Wahlmanipulation. Ein Vergleich mit dem US-Wahlkampf folgt, bevor Prognosen und ein Fazit die Arbeit abschließen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Stärken-Schwächen-Analyse, um den digitalen Wahlkampf zu bewerten. Sie analysiert den Einfluss des digitalen Wandels, die Rolle sozialer Medien und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ein Vergleich mit dem US-amerikanischen Wahlkampf dient als Benchmark. Die Ergebnisse liefern eine Grundlage für Prognosen und Handlungsempfehlungen.
Welche Rolle spielen soziale Medien?
Die Analyse untersucht die Funktionen und Arten sozialer Medien in Deutschland im Kontext des politischen Wahlkampfes. Sie beleuchtet den Einfluss der sozialen Medien auf das politische Bewusstsein neuer Zielgruppen und die Herausforderungen durch Wahlmanipulation in der digitalen Grauzone.
Wie werden rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Wahlkampf auf Bundesebene, einschließlich der strukturellen Veränderungen der Bundestagsmandate und des gesetzlichen Rahmens für Wahlwerbung. Sie analysiert auch die rechtliche Einordnung von Manipulationswerkzeugen im digitalen Raum.
Welchen Vergleich bietet die Analyse?
Die Analyse vergleicht den politischen Online-Wahlkampf in den USA (Präsidentschaftswahl 2020) mit dem in Deutschland, um Best-Practice-Beispiele und unterschiedliche Ansätze im Umgang mit der Digitalisierung im Wahlkampf zu identifizieren und zu analysieren.
Welche Schlussfolgerungen und Prognosen werden gezogen?
Die Arbeit bietet Prognosen zum zukünftigen strukturellen, digitalen Wandel der politischen Kommunikation in Deutschland und gibt Handlungsempfehlungen zur gewinnbringenden Nutzung digitaler Werkzeuge in sozialen Netzwerken. Der Fokus liegt auf dem Ausbau von Stärken und der Bewältigung von Schwächen in der digitalen politischen Kommunikation im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Digitalisierung, Wahlkampf, soziale Medien, politische Kommunikation, digitale Demokratie, Wahlmanipulation, Stärken-Schwächen-Analyse, Deutschland, USA, Bundestagswahl 2021, rechtliche Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Eine Analyse der Stärken und Schwächen der Digitalisierung im politischen Wahlkampf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1164061