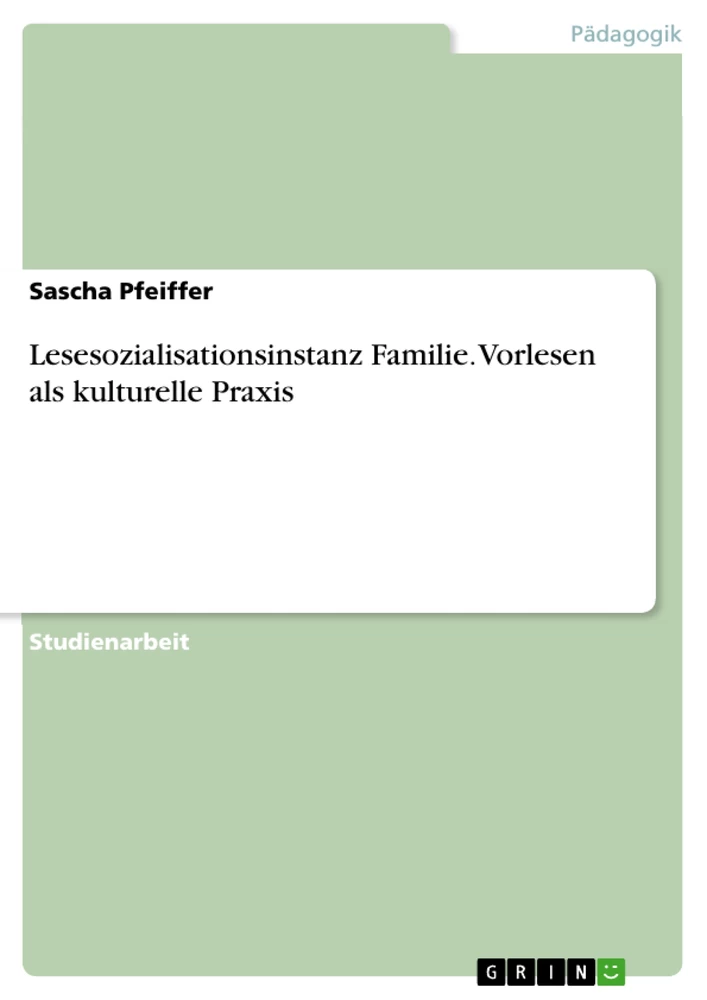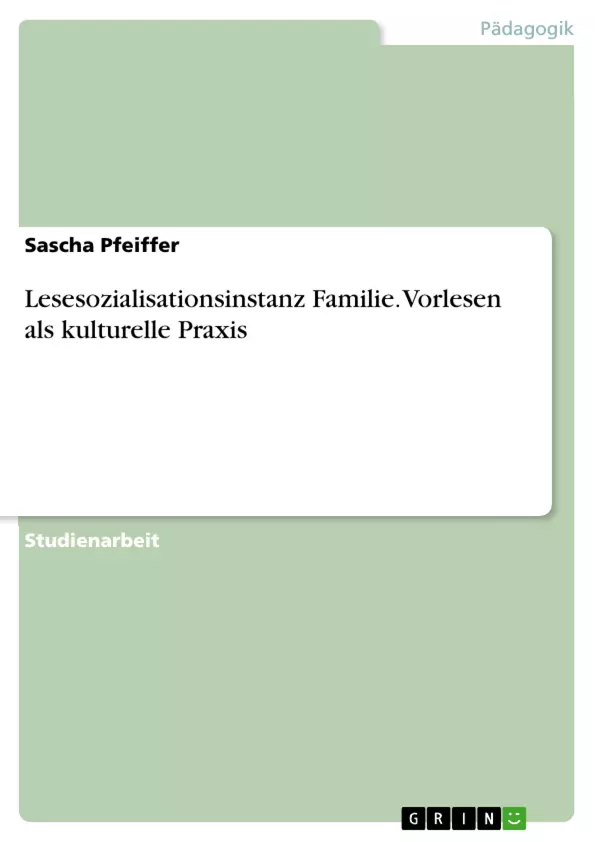Der Begriff der Sozialisation stammt ursprünglich aus der Soziologie und beschäftigt sich mit der aktiven Partizipation des Individuums an der Gesellschaft. Für den im Rahmen des Referats untersuchten Bereich der Lesesozialisation ist insbesondere die Sozialisation im Kindes- und Jugendalter wichtig. Dabei ist Sozialisation mehr als die Untersuchung der Erziehungsmethoden, denn Sozialisation umfasst auch nicht-intentionale Einflüsse, sowie die individuelle Entwicklung. Zudem werden die physisch-materielle und soziale Umwelt mit analysiert, da nicht nur das Individuum die Gesellschaft beeinflusst, sondern gerade in der Erziehung die Gesellschaft das Individuum beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Theoretischer Ausgangspunkt
- 3.) Frühe Lesesozialisation
- 4.) Lesesozialisation in der Grundschule
- 5.) Lesesozialisation im Jugendalter
- 6.) Historischer Wandel der Lesesozialisation
- 7.) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle der Familie als Lesesozialisationsinstanz, insbesondere im Kontext des Vorlesens als kulturelle Praxis. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Vorlesens in der frühen Kindheit, der Grundschule und im Jugendalter und beleuchtet den historischen Wandel der Lesesozialisation in der Familie. Sie untersucht, wie Kinder durch Vorleseerfahrungen eine Beziehung zur Sprache und Literatur entwickeln und wie diese Erfahrungen ihre spätere Leseentwicklung beeinflussen.
- Die Bedeutung der Familie als erste und wichtigste Sozialisationsinstanz
- Der Einfluss des Vorlesens auf die sprachliche und kognitive Entwicklung von Kindern
- Die Rolle des Vorlesens im Aufbau einer Beziehung zur Literatur und zum Lesen
- Der historische Wandel der Lesesozialisation in der Familie
- Der Einfluss der Gesellschaft auf die Lesesozialisation
Zusammenfassung der Kapitel
1.) Einleitung
Die Einleitung stellt den Begriff der Lesesozialisation und die Bedeutung der Familie als Lesesozialisationsinstanz vor. Sie definiert die wichtigsten Begriffe und führt in die Thematik des Vorlesens als kulturelle Praxis ein.
2.) Theoretischer Ausgangspunkt
Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es behandelt zentrale Konzepte wie die Sozialisationstheorie, das Familienkonzept und das Gegenstandskonzept, die für das Verständnis der Lesesozialisation relevant sind.
3.) Frühe Lesesozialisation
Dieses Kapitel fokussiert auf die ersten literarischen Kontakte von Kindern im Kontext der Familie. Es untersucht die Bedeutung von Bilderbüchern, Geschichtenerzählen und Sprachspielen für die Entwicklung der Lesekompetenz in der frühen Kindheit.
4.) Lesesozialisation in der Grundschule
Dieses Kapitel behandelt den Übergang von der frühen Lesesozialisation in der Familie zur Lesesozialisation in der Grundschule. Es beleuchtet die Rolle der Schule in der Entwicklung der Lesefertigkeiten und das Verhältnis von Familie und Schule in Bezug auf die Lesesozialisation.
5.) Lesesozialisation im Jugendalter
Dieses Kapitel untersucht die Lesesozialisation im Jugendalter und die Bedeutung der Familie für die Entwicklung von Leseinteressen und -gewohnheiten in dieser Phase.
6.) Historischer Wandel der Lesesozialisation
Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Wandel der Lesesozialisation in der Familie und die Einflüsse, die diesen Wandel beeinflusst haben. Es betrachtet die Veränderungen in den Familienstrukturen, den Lesegewohnheiten und den gesellschaftlichen Erwartungen an Kinder und Jugendliche.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lesesozialisation, Familie, Vorlesen, kulturelle Praxis, frühe Lesesozialisation, Grundschule, Jugendalter, historischer Wandel, Lesekompetenz, Sprachentwicklung, Kinderliteratur, Sozialisationstheorie, Familienkonzept, Gegenstandskonzept, und Interaktion.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Lesesozialisation?
Es ist der Prozess, in dem Individuen (besonders Kinder) eine Beziehung zur Schriftsprache und Literatur entwickeln und aktiv an der Lesekultur teilhaben.
Warum ist die Familie die wichtigste Instanz für das Lesen?
In der Familie finden die ersten literarischen Kontakte statt, die die spätere Leseentwicklung und Sprachkompetenz maßgeblich prägen.
Welche Rolle spielt das Vorlesen in der frühen Kindheit?
Vorlesen fördert die kognitive Entwicklung, den Wortschatz und baut eine emotionale Bindung zu Büchern und Geschichten auf.
Wie verändert sich die Lesesozialisation im Jugendalter?
Die Arbeit untersucht, wie familiäre Vorbilder auch in der Pubertät noch Einfluss auf die Lesegewohnheiten und Interessen der Jugendlichen haben.
Was wird unter „Vorlesen als kulturelle Praxis“ verstanden?
Es beschreibt das Vorlesen nicht nur als pädagogische Methode, sondern als festen Bestandteil des sozialen und kulturellen Zusammenlebens in der Familie.
Gibt es einen historischen Wandel bei der Lesesozialisation?
Ja, die Arbeit beleuchtet, wie sich Familienstrukturen und gesellschaftliche Erwartungen an das Lesen über die Zeit verändert haben.
- Citation du texte
- Master of Arts und Master of Education Sascha Pfeiffer (Auteur), 2016, Lesesozialisationsinstanz Familie. Vorlesen als kulturelle Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1164815