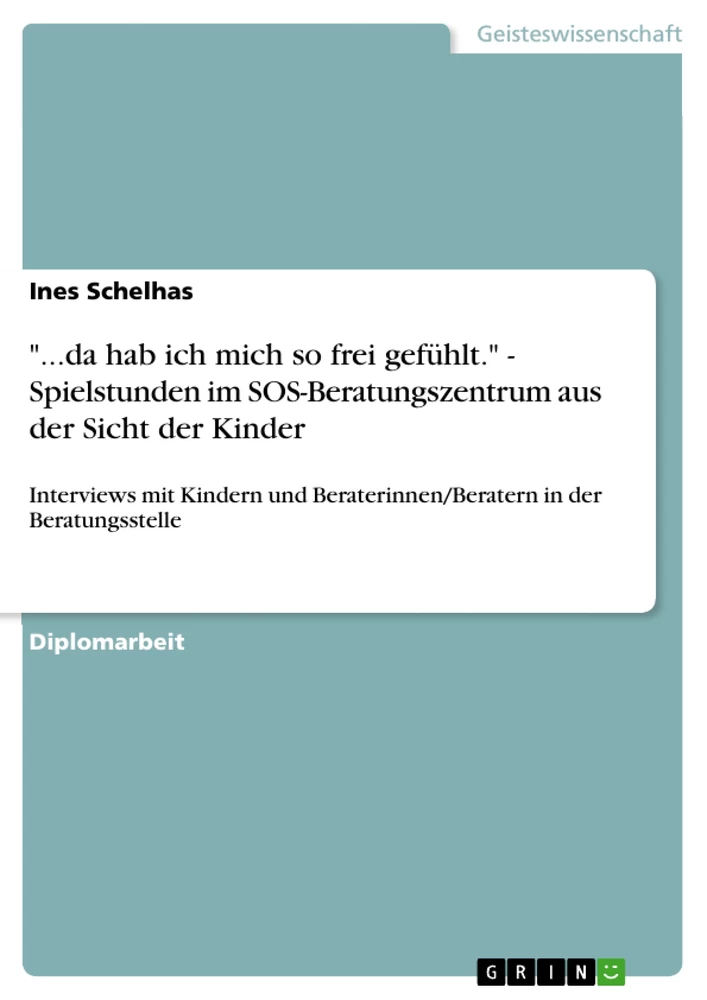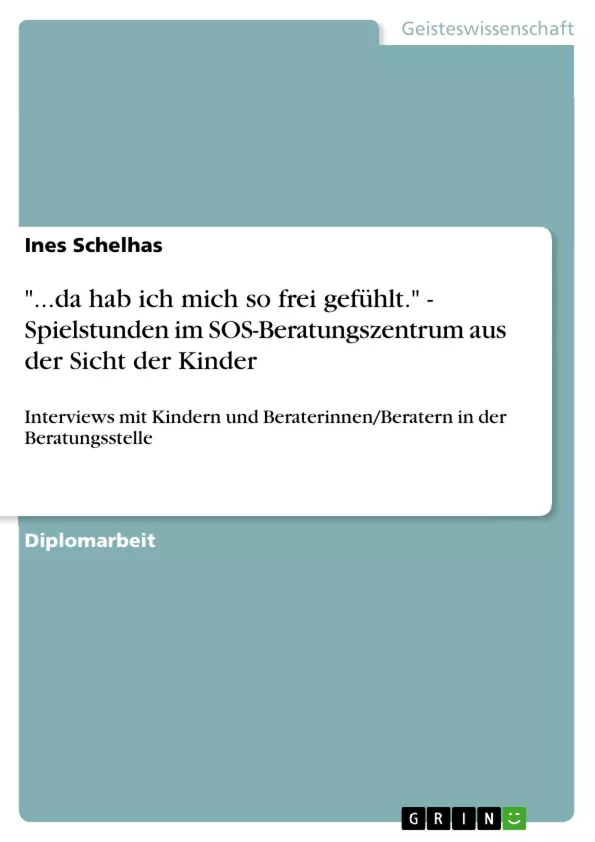Erziehungsberatung ist dem Wort nach ein Angebot für Eltern, die Hilfe bei der "Erziehung" ihres Kindes suchen. Seit den 1970er Jahren ist in diesem Zusammenhang jedoch auch der Kontext der Familie ins Blickfeld gerückt. Die Kinder werden stärker miteinbezogen und erhalten parallel zur Beratung der Eltern oftmals Einzelspielstunden in der Erziehungsberatungsstelle – heute versteht sich Erziehungsberatung als Erziehungs- und Familienberatung (vgl. Lenz 2001, S.7).
Doch wie nehmen Kinder eigentlich die Angebote wahr, die ihnen in der Erziehungsberatungsstelle gemacht werden? Welche Sicht haben sie auf sich selbst, ihre Familie und auf die BeraterInnen?
Kinder werden in der Kinder- und Jugendhilfe nicht automatisch als Klienten, als eigenständige Personen wahrgenommen, die etwas zur Problematik der Familie zu sagen und eine Meinung zu der (mit ihnen durchgeführten) Maßnahme haben. Ihre Meinung ist aber hörenswert, weil es sich um die Wahrnehmung der Betroffenen handelt. Schließlich suchen Eltern eine Erziehungsberatungsstelle auf, weil etwas mit dem Kind "nicht stimmt" und das Kind familiäre Konflikte verursacht oder deutlich macht. Die Stimme der Kinder ist wertvoll, weil niemand bessere Anregungen für die Optimierung und Weiterentwicklung von pädagogischen oder therapeutischen Maßnahmen liefern könnte als sie. Ihre Stimme ist wertvoll, weil Kinder ein Recht haben, gehört und ernst genommen zu werden. Und sie ist wertvoll, weil Kinder eine leise Stimme haben, die nicht von alleine hörbar ist, sondern erfragt werden muss. Die "neue Kindheitsforschung" betont die Notwendigkeit, "Kindern ‘Gehör’ zu verschaffen, ihnen eine Stimme zu geben" (Mey 2001, Absatz 11) seit vielen Jahren.
Die Kinder, die ich im Rahmen dieser Arbeit befragt habe, besuchten die Spielstunden in der SOS-Beratungsstelle in München Berg-am-Laim und haben mir Antworten auf folgende Fragen gegeben: Wie bewerten die Kinder die Spielstunden im SOS-Beratungszentrum? Was finden sie gut oder schlecht? Über welche Veränderungen können sie berichten?
Im Rahmen dieser Arbeit können zwar nicht die Wirkfaktoren der Spielstunden benannt werden, ich möchte jedoch die Veränderungen beschreiben und vorsichtige Schlussfolgerungen ziehen, womit sie zusammenhängen könnten. Die Aussagen der BeraterInnen sollen dabei helfen, das Bild der Kinder um einige Facetten aus der Sicht der Erwachsenen zu bereichern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Konzept und Fragestellung
- Zur "Grounded Theorie"
- Die Entwicklung der Fragestellung
- Reflexive Sozialpsychologie und qualitative Sozialforschung
- Überblick zum Stand der Forschung
- Quantitative Studien
- Qualitative Untersuchungen
- Kinder in der Erziehungsberatung
- Effekte der Erziehungsberatung
- Beurteilung der Erziehungsberatung aus Kindersicht
- Die Entwicklung des Settings in der Beratung
- Das familienorientierte Setting
- Die Kombination aus Einzel- und Familiensetting
- Das SOS-Beratungs- und Familienzentrum
- Konzept der Einrichtung und Leitbild
- Praxisforschung und Qualitätsmanagement
- Der Weg zur Erziehungsberatungsstelle
- Das Aufnahmeverfahren
- Die Beratungsanlässe
- Beratung oder Therapie?
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Die Spielstunden in der Beratungsstelle
- Emotionale Störungen bei Kindern
- Risiko- und Schutzfaktoren der kindlichen Entwicklung
- Merkmale emotionaler Störungen
- Spieltherapie
- Die Nichtdirektivität in der Spieltherapie
- Die Rolle der TherapeutInnen
- Das Spielzimmer als Schutzraum
- Spieltherapie als "Reifungshilfe"
- Abgrenzung zur Lösungsorientierten Therapie
- Die Einbeziehung der Eltern
- Wirksamkeit von Psychotherapie
- Methodisches Design
- Das Leitfaden-Interview
- Die Erstellung des Interviewleitfadens
- Die Entwicklung des Playmobiltests
- Die Durchführung der Interviews und des Playmobiltests
- Das Problem der Suggestion
- Die Untersuchungsgruppen
- Vorstellung der Kinder
- Die Beraterinnen und Berater
- Exkurs: Zur Methodologie der Kindheitsforschung
- Die Methodik der Auswertung
- Ergebnisse der empirischen Untersuchung zum Zeitpunkt I
- Die Lebenssituation der Kinder
- Die Problemdefinition der Kinder
- Die Lebenssituation aus Sicht der BeraterInnen
- Exkurs: gegenwärtige Lage von Kindern als Asylbewerber in Deutschland
- Die familiären Beziehungen der Kinder
- Wünsche und Phantasien der Kinder
- Bisherige Lösungsversuche und Ressourcen
- Der Zugang zur Beratungsstelle und zu den Spielstunden
- Partizipation der Kinder an Entscheidungsprozessen
- Erwartungen der Kinder
- Die Spielstunden
- Das Setting der Spielstunden
- Die Spielstunden als Freiraum
- Die Spielstunden als Freiraum: die Sicht der Kinder
- Die Spielstunden als Freiraum: die Sicht der BeraterInnen
- Die Beziehung zwischen Kindern und ihren BeraterInnen
- Die Beziehung aus der Sicht der Kinder
- Die Beziehung aus der Sicht der BeraterInnen
- Vorläufiges Resümee nach den ersten Interviewgesprächen
- Ergebnisse der empirischen Untersuchung zum Zeitpunkt II
- Die Lebenssituation der Kinder
- Die externen Veränderungen
- Individuelle Veränderungen beim Kind
- Die individuellen Veränderungen aus der Sicht der Kinder
- Die individuellen Veränderungen aus der Sicht der BeraterInnen
- Veränderungen der familiären und sozialen Beziehungen
- Die Spielstunden
- Das Setting der Spielstunden
- Die Spielstunden als Freiraum
- Die Spielstunden als Freiraum: die Sicht der Kinder
- Die Spielstunden als Freiraum: die Sicht der BeraterInnen
- Die Beziehung zwischen Kindern und ihren BeraterInnen
- Die Beziehung aus der Sicht der Kinder
- Die Beziehung aus der Sicht der BeraterInnen
- Der Abschied von den Spielstunden
- Wünsche und Phantasien der Kinder
- Persönliche Stellungnahme
- Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse
- Ausblick und Folgerungen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Erfahrungen von Kindern in der Spieltherapie eines SOS-Beratungszentrums. Ziel ist es, die Perspektive der Kinder auf die Beratungsarbeit aus ihrer Sicht zu beleuchten und zu analysieren, wie sie die Spielstunden erleben. Die Arbeit konzentriert sich auf die subjektiven Erfahrungen der Kinder und die Bedeutung der Spielstunden als Freiraum und Schutzraum.
- Die subjektiven Erfahrungen von Kindern in der Spieltherapie
- Die Bedeutung der Spielstunden als Freiraum und Schutzraum
- Die Beziehung zwischen den Kindern und ihren BeraterInnen
- Die Auswirkungen der Spieltherapie auf die Lebenswelt der Kinder
- Die Rolle der Spieltherapie in der Erziehungsberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der "Grounded Theorie" und beschreibt die Entwicklung der Fragestellung. Der dritte Teil bietet einen Überblick über den Stand der Forschung zu Kindern in der Erziehungsberatung. Das vierte Kapitel beleuchtet die Effekte der Erziehungsberatung aus der Sicht der Kinder. Das fünfte Kapitel stellt das SOS-Beratungs- und Familienzentrum vor und beschreibt das Konzept der Einrichtung, die Praxisforschung und das Aufnahmeverfahren. Das sechste Kapitel widmet sich der Spieltherapie und erläutert die Nichtdirektivität, die Rolle der TherapeutInnen und die Bedeutung des Spielzimmers als Schutzraum. Das siebte Kapitel beschreibt das methodische Design der Studie, die Durchführung der Interviews und des Playmobiltests sowie die Untersuchungsgruppen. Das achte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zum Zeitpunkt I, die die Lebenssituation der Kinder, den Zugang zur Beratungsstelle und die Erfahrungen mit den Spielstunden beleuchtet. Das neunte Kapitel analysiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zum Zeitpunkt II, die die Veränderungen in der Lebenssituation der Kinder und die Entwicklung der Beziehung zu den BeraterInnen untersucht.
Schlüsselwörter
Spieltherapie, Erziehungsberatung, Kinderperspektive, SOS-Beratungszentrum, Freiraum, Schutzraum, Beziehung, subjektive Erfahrungen, qualitative Forschung, Grounded Theory, Playmobiltest.
Häufig gestellte Fragen
Wie nehmen Kinder Spielstunden in der Erziehungsberatung wahr?
Die Arbeit zeigt, dass Kinder die Spielstunden oft als befreienden Freiraum und geschützten Raum erleben, in dem sie sich ernst genommen fühlen.
Was ist das Besondere am methodischen Design dieser Studie?
Neben Leitfaden-Interviews wurde ein eigens entwickelter "Playmobiltest" genutzt, um den Kindern den Ausdruck ihrer Gefühle zu erleichtern.
Welche Rolle spielt die Nichtdirektivität in der Spieltherapie?
Sie ermöglicht dem Kind, das Tempo und die Inhalte der Therapie selbst zu bestimmen, was die Selbstheilungskräfte fördert.
Wie unterscheidet sich die Sicht der Berater von der Sicht der Kinder?
Berater analysieren oft systemische Ursachen, während Kinder ihre unmittelbaren emotionalen Veränderungen und die Qualität der Beziehung betonen.
Welche Bedeutung hat das SOS-Beratungszentrum München Berg-am-Laim?
Es dient als Fallbeispiel für moderne Erziehungsberatung, die Kinder als eigenständige Klienten mit wertvoller Stimme betrachtet.
- Citar trabajo
- Dipl. Soz.-Päd., Dipl. Psych. Ines Schelhas (Autor), 2007, "...da hab ich mich so frei gefühlt." - Spielstunden im SOS-Beratungszentrum aus der Sicht der Kinder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116489