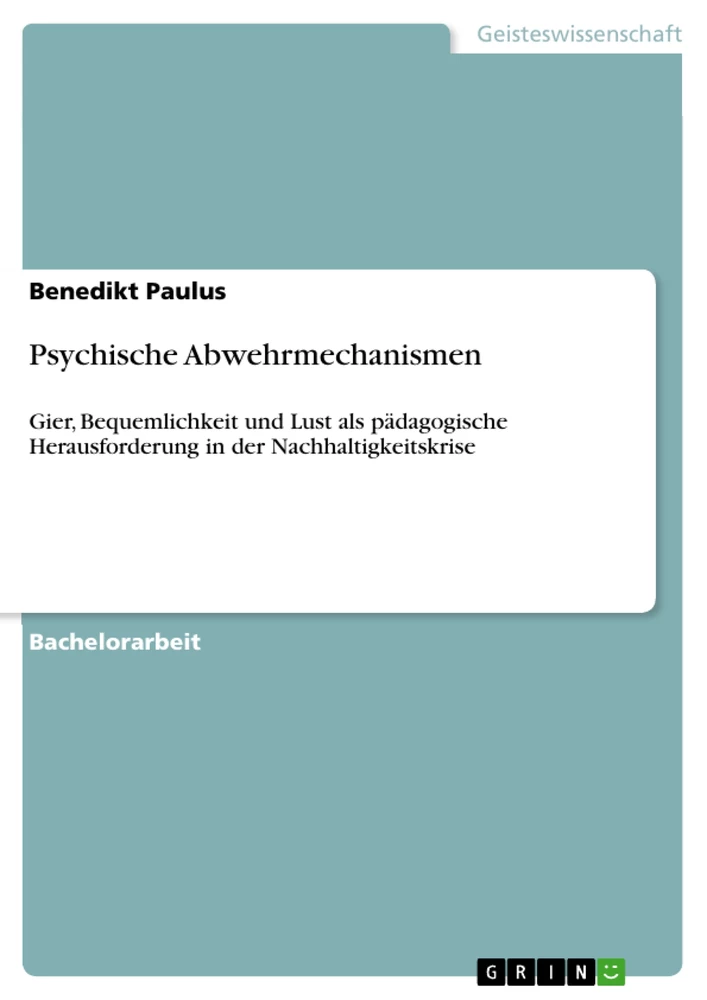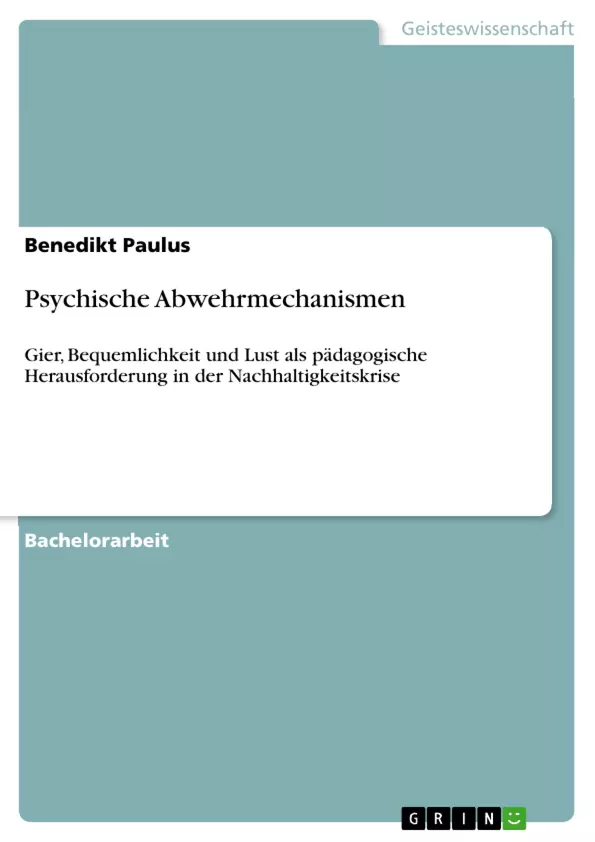In der Arbeit wird der derzeitige Umgang des Menschen mit der Nachhaltigkeitskrise aus einer psychoanalytischen Perspektive betrachtet.
Betrachtet man das Verhalten in der kapitalistischen Gesellschaft, waschen sich die Menschen eher durch einen ‚grünen Konsum‘ rein und verzichten auf Plastiktüten, um dennoch in den Urlaub fliegen zu können. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an und orientiert sich in ihrem ersten Teil an folgender zugrunde liegender Forschungsfrage: Wie lässt sich die Kluft zwischen dem wachsenden Bewusstsein über die Folgen menschlichen Handels und der fehlenden Verhaltensänderung erklären?
Die Psychoanalyse beschäftigt sich vor allem mit unbewussten Prozessen und aufgebauten Widerständen, die dem Menschen dabei helfen, mit belastenden und schmerzhaften Erfahrungen umzugehen, um sein psychisches Gleichgewicht beizubehalten. Hier setzt der zweite Teil dieser Arbeit an, der sich mit dem Bereich der Pädagogik befasst. Der Pädagogik wird in der Bildung und Erziehung der Gesellschaft eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Im Laufe der Geschichte der Schulpädagogik lässt sich ein Wandel feststellen, der die ökonomische Bildung immer mehr in den Vordergrund rückt. Dieser Wandel brachte der westlichen Industriegesellschaft in vielerlei Hinsicht bedeutsame ‚Fortschritte‘, die gleichzeitig eine Entsagung humanistischer Werte und einen Verlust der wesentlichen Essenz des menschlichen Daseins bedeutet. Der Mensch fühlt sich der Natur immer mehr überlegen und betrachtet sie als reine Ressource, anstatt sie als Existenzgrundlage zu verstehen. Folglich wird die zweite zugrunde liegende Forschungsfrage sein: Welche pädagogischen Maßnahmen können im Umgang mit der Bewältigung der Nachhaltigkeitskrise ergriffen werden, und welche Chancen ergeben sich daraus?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Psychoanalytische Betrachtung von Abwehrmechanismen
- 3. Ursprünge und Folgen menschlicher Laster
- 3.1 Gier
- 3.2 Bequemlichkeit
- 3.3 Lust
- 4. Das verhängnisvolle Zusammenspiel von Abwehrmechanismen und menschlichen Lastern
- 4.1 Die „Mutter-Kind“-Beziehung
- 4.2 Abwehrmechanismen im Kontext der Perversion
- 5. Pädagogik und ihre Bedeutung in der Nachhaltigkeitskrise
- 5.1 Pädagogik vs. Therapie
- 5.2 Umgang mit den Herausforderungen in der Praxis
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen dem wachsenden Bewusstsein für die Folgen menschlichen Handelns in der Nachhaltigkeitskrise und dem ausbleibenden entsprechenden Verhaltenswandel. Sie analysiert diese Kluft unter Zuhilfenahme psychoanalytischer Perspektiven und erörtert anschließend mögliche pädagogische Maßnahmen zur Bewältigung der Krise.
- Psychoanalytische Erklärungen für ambivalentes menschliches Verhalten in Bezug auf die Nachhaltigkeitskrise
- Die Rolle von Abwehrmechanismen (z.B. Verdrängung) im Umgang mit der Angst vor den Folgen des Klimawandels
- Der Einfluss von Gier, Bequemlichkeit und dem Streben nach Lust auf das Handeln in der Krise
- Die Bedeutung von Pädagogik in der Bewältigung der Nachhaltigkeitskrise
- Entwicklung geeigneter pädagogischer Maßnahmen zur Förderung nachhaltigen Verhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die dringende Notwendigkeit zum Handeln angesichts der Klimakrise und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln. Sie verweist auf die wachsende gesellschaftliche Wahrnehmung des Problems und den gleichzeitigen Mangel an Verhaltensänderungen, trotz des wissenschaftlichen Konsenses zur Notwendigkeit einer Verhaltensänderung. Die Einleitung legt den Grundstein für die psychoanalytische Betrachtung im zweiten Teil und die pädagogischen Überlegungen im zweiten Teil der Arbeit.
2. Psychoanalytische Betrachtung von Abwehrmechanismen: Dieses Kapitel analysiert die psychoanalytischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens im Kontext der Klimakrise. Es wird die Bedeutung unbewusster Prozesse und Abwehrmechanismen im Umgang mit Angst und Bedrohung herausgestellt. Der Fokus liegt auf der psychologischen Verarbeitung der komplexen und bedrohlichen Realität des Klimawandels. Das Kapitel legt die theoretische Grundlage für das Verständnis der menschlichen Reaktionen auf die Krise.
3. Ursprünge und Folgen menschlicher Laster: Dieses Kapitel beleuchtet Gier, Bequemlichkeit und Lust als zentrale Triebkräfte, die das menschliche Handeln in der Nachhaltigkeitskrise beeinflussen. Es untersucht die psychologischen Wurzeln dieser „Laster“ und ihre Auswirkungen auf den Umgang mit der ökologischen Herausforderung. Es wird diskutiert, wie diese menschlichen Eigenschaften zu einem Verhalten führen, das der notwendigen nachhaltigen Lebensweise widerspricht.
4. Das verhängnisvolle Zusammenspiel von Abwehrmechanismen und menschlichen Lastern: Dieses Kapitel untersucht die Wechselwirkung zwischen den im vorherigen Kapitel behandelten psychoanalytischen Konzepten und den „Lastern“. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen der „Mutter-Kind-Beziehung“ und der Entwicklung von Abwehrmechanismen. Der Fokus liegt auf dem komplexen Zusammenspiel dieser Faktoren und ihren Auswirkungen auf das Handeln in der Nachhaltigkeitskrise.
5. Pädagogik und ihre Bedeutung in der Nachhaltigkeitskrise: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle der Pädagogik bei der Bewältigung der Nachhaltigkeitskrise. Es unterscheidet zwischen pädagogischen und therapeutischen Ansätzen und skizziert Möglichkeiten, wie pädagogische Maßnahmen zum nachhaltigen Handeln beitragen können. Der Fokus liegt auf der Bildung selbstbewusster und kritischer Individuen, die in der Lage sind, die Herausforderungen der Krise zu bewältigen.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeitskrise, Klimawandel, Psychoanalyse, Abwehrmechanismen, Gier, Bequemlichkeit, Lust, Pädagogik, Verhaltensänderung, Bewältigungsstrategien, humanistische Werte, Ökologische Bildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychoanalytische und Pädagogische Aspekte der Nachhaltigkeitskrise
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen dem wachsenden Bewusstsein für die Folgen menschlichen Handelns in der Nachhaltigkeitskrise und dem ausbleibenden entsprechenden Verhaltenswandel. Sie analysiert diese Kluft unter Zuhilfenahme psychoanalytischer Perspektiven und erörtert anschließend mögliche pädagogische Maßnahmen zur Bewältigung der Krise.
Welche psychoanalytischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit nutzt psychoanalytische Perspektiven, um ambivalentes menschliches Verhalten im Kontext der Nachhaltigkeitskrise zu erklären. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Abwehrmechanismen (z.B. Verdrängung) im Umgang mit der Angst vor den Folgen des Klimawandels.
Welche menschlichen „Laster“ werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht Gier, Bequemlichkeit und Lust als zentrale Triebkräfte, die das menschliche Handeln in der Nachhaltigkeitskrise negativ beeinflussen. Es wird analysiert, wie diese Eigenschaften zu einem Verhalten führen, das der notwendigen nachhaltigen Lebensweise widerspricht.
Wie wird das Zusammenspiel von Abwehrmechanismen und „Lastern“ beschrieben?
Die Arbeit beleuchtet die Wechselwirkung zwischen den psychoanalytischen Konzepten und den „Lastern“, insbesondere den Zusammenhang zwischen der „Mutter-Kind-Beziehung“ und der Entwicklung von Abwehrmechanismen. Der Fokus liegt auf dem komplexen Zusammenspiel dieser Faktoren und ihren Auswirkungen auf das Handeln in der Nachhaltigkeitskrise.
Welche Rolle spielt die Pädagogik in der Arbeit?
Die Arbeit widmet sich der Rolle der Pädagogik bei der Bewältigung der Nachhaltigkeitskrise. Sie unterscheidet zwischen pädagogischen und therapeutischen Ansätzen und skizziert Möglichkeiten, wie pädagogische Maßnahmen zum nachhaltigen Handeln beitragen können. Es geht um die Bildung selbstbewusster und kritischer Individuen, die die Herausforderungen der Krise bewältigen können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, die die Problematik einführt; ein Kapitel zur psychoanalytischen Betrachtung von Abwehrmechanismen; ein Kapitel zu den Ursprüngen und Folgen menschlicher „Laster“ (Gier, Bequemlichkeit, Lust); ein Kapitel zum Zusammenspiel von Abwehrmechanismen und „Lastern“; ein Kapitel zur Rolle der Pädagogik in der Nachhaltigkeitskrise; und schließlich ein Fazit und Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nachhaltigkeitskrise, Klimawandel, Psychoanalyse, Abwehrmechanismen, Gier, Bequemlichkeit, Lust, Pädagogik, Verhaltensänderung, Bewältigungsstrategien, humanistische Werte, Ökologische Bildung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Diskrepanz zwischen dem Wissen um die Folgen des menschlichen Handelns in der Nachhaltigkeitskrise und dem ausbleibenden entsprechenden Verhaltenswandel.
Welche konkreten Maßnahmen werden im Bereich Pädagogik vorgeschlagen?
Die Arbeit skizziert Möglichkeiten, wie pädagogische Maßnahmen zum nachhaltigen Handeln beitragen können, ohne konkrete Maßnahmen explizit zu benennen. Der Fokus liegt auf der Bildung selbstbewusster und kritischer Individuen.
- Quote paper
- Benedikt Paulus (Author), 2021, Psychische Abwehrmechanismen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1165432