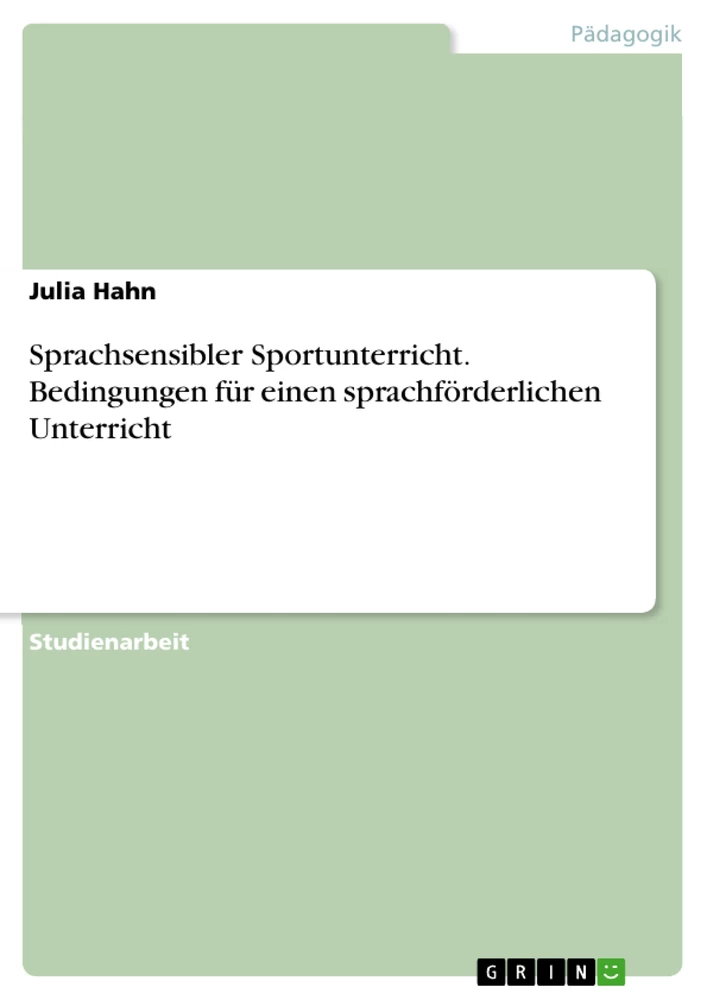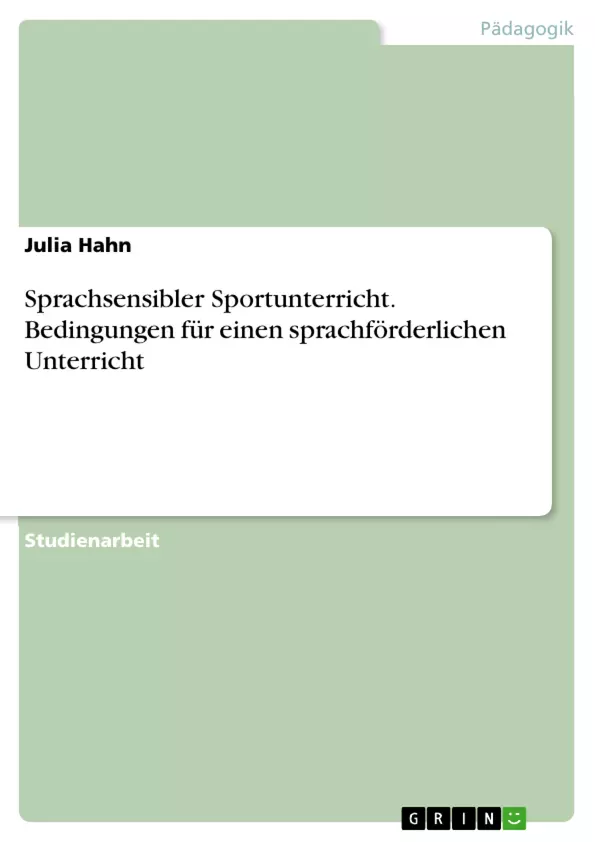Wie lässt sich Sportunterricht sprachsensibel gestalten? Zunächst werden einige relevante Grundlagen des Zweitspracherwerbs dargestellt, indem die Unterscheidung von konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit im Rahmen der Schule erfolgt, altersgemäße Entwicklungsaufgaben beschrieben und die bekanntesten Zweitspracherwerbstheorien erläutert werden. Nachfolgend werden die Bedingungen für einen sprachförderlichen Unterricht beschrieben. Im nächsten Schritt wird auf die Besonderheiten im Sportunterricht eingegangen und die didaktischen Konsequenzen daraus abgeleitet. Abschließend folgt die Schlussbetrachtung.
Viele Grundschulkinder, die eine deutsche Schule besuchen, haben einen Migrationshintergrund und lernen Deutsch daher als zweite Sprache. Internationale Schulleistungsvergleichsstudien, wie PISA, IGLU und DESI, zeigen, dass insbesondere bei Lernenden mit einem Migrationshintergrund ein Förderbedarf im Bereich der deutschen Sprache besteht. In jedem Schulfach gehören schulspezifische Sprachhandlungen, wie Erklären, Beschreiben und Analysieren auf der Grundlage einer bestimmten Fachsprache zum Alltag. Eine Förderung der Sprachkompetenzen kann und sollte daher auch über den Deutschunterricht hinaus praktiziert werden. Auch im Sportunterricht findet immer eine sprachliche Verständigung statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Zweitspracherwerbs
- BICS und CALP
- Entwicklungsaufgaben
- Zweitspracherwerbstheorien
- Interaktionistische Theorie
- Lerntheorie
- Reifungstheorien
- Kognitive Theorie
- Sprachförderliche Lernbedingungen
- Besonderheiten im Rahmen des Sportunterrichts und didaktische Konsequenzen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema des sprachsensiblen Sportunterrichts für Grundschulkinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Sie untersucht, wie die spezifischen sprachlichen Bedürfnisse dieser Lernenden im Sportunterricht berücksichtigt werden können, um deren Lern- und Entwicklungsprozesse zu optimieren. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen des Zweitspracherwerbs und die Bedeutung von sprachförderlichen Lernbedingungen im Sportunterricht.
- Grundlagen des Zweitspracherwerbs: BICS und CALP, Entwicklungsaufgaben im Sprachlernen, relevante Zweitspracherwerbstheorien
- Sprachförderliche Lernbedingungen: Emotionale Bedingungen, Umgang mit Fehlern, Sprachvorbilder, Sprachförderliches Potential wahrnehmen, Sprachanlässe gestalten, Verbale Begleitung, Rituale und Regeln
- Besonderheiten im Sportunterricht: Spezifische Herausforderungen und didaktische Konsequenzen für sprachsensiblen Sportunterricht
- Entwicklung von Strategien für einen effektiven und inklusiven Sportunterricht für DaZ-Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Problem des Zweitspracherwerbs im Kontext des Sportunterrichts dar und erläutert die Relevanz des Themas. Sie führt die Frage ein, wie Sportunterricht sprachsensibel gestaltet werden kann. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Hausarbeit und die wichtigsten Themenbereiche, die behandelt werden.
Grundlagen des Zweitspracherwerbs
Dieses Kapitel liefert wichtige Grundlagen zum Verständnis des Zweitspracherwerbs. Es beleuchtet die Unterscheidung von konzeptioneller Mündlichkeit (BICS) und konzeptioneller Schriftlichkeit (CALP) im schulischen Kontext. Darüber hinaus werden altersgemäße Entwicklungsaufgaben im Sprachlernen beschrieben und die wichtigsten Zweitspracherwerbstheorien vorgestellt.
Sprachförderliche Lernbedingungen
Dieses Kapitel befasst sich mit den Bedingungen, die einen sprachförderlichen Unterricht für DaZ-Lernende ermöglichen. Es werden Faktoren wie emotionale Unterstützung, der Umgang mit Fehlern, die Bedeutung von Sprachvorbildern, die aktive Wahrnehmung von Sprachförderpotenzialen und die Gestaltung von Sprachanlässen im Unterricht beleuchtet.
Besonderheiten im Rahmen des Sportunterrichts und didaktische Konsequenzen
Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifischen Herausforderungen, die sich im Sportunterricht für DaZ-Lernende ergeben. Es werden didaktische Konsequenzen für einen sprachsensiblen Sportunterricht abgeleitet.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Sprachförderung, BICS und CALP, Entwicklungsaufgaben, Sprachsensibler Sportunterricht, Didaktische Konsequenzen, Inklusion, Sprachliche Verständigung, Fachsprache, Sprachhandlungen, Sprachvorbilder, Fehlerkultur, Motivation, Interaktion, Sprachanlässe, Verbale Begleitung, Rituale und Regeln, Lernstrategien, Differenzierung
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter sprachsensiblem Sportunterricht?
Sprachsensibler Sportunterricht berücksichtigt die sprachlichen Hürden und Bedürfnisse von Schülern, insbesondere von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), um deren Teilhabe und den Lernerfolg zu sichern.
Was bedeuten die Begriffe BICS und CALP im schulischen Kontext?
BICS steht für alltagssprachliche Kompetenzen (Basic Interpersonal Communicative Skills), während CALP die bildungssprachlichen Fähigkeiten (Cognitive Academic Language Proficiency) beschreibt, die für den schulischen Erfolg entscheidend sind.
Warum ist Sprachförderung im Sportunterricht sinnvoll?
Im Sportunterricht finden ständig Sprachhandlungen wie Erklären, Beschreiben und Analysieren statt. Da hier reale Handlungssituationen vorliegen, bietet der Sport ideale Gelegenheiten für informelles und fachsprachliches Lernen.
Welche Zweitspracherwerbstheorien werden in der Arbeit behandelt?
Es werden die interaktionistische Theorie, Lerntheorien, Reifungstheorien und kognitive Theorien erläutert, um die Grundlagen des Spracherwerbs zu verstehen.
Wie können Lehrer Sprachanlässe im Sportunterricht gestalten?
Durch gezielte verbale Begleitung, den Einsatz von Ritualen und Regeln sowie die Schaffung einer positiven Fehlerkultur können Lehrer die Sprechfreude und Sprachkompetenz der Schüler fördern.
- Citar trabajo
- Julia Hahn (Autor), 2021, Sprachsensibler Sportunterricht. Bedingungen für einen sprachförderlichen Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1165678