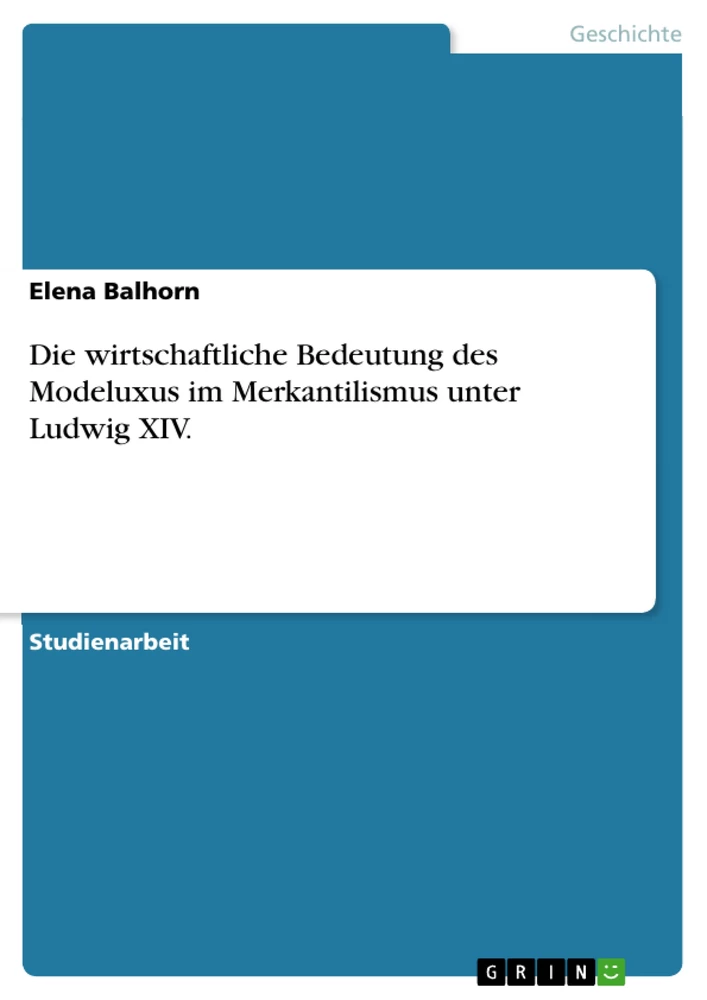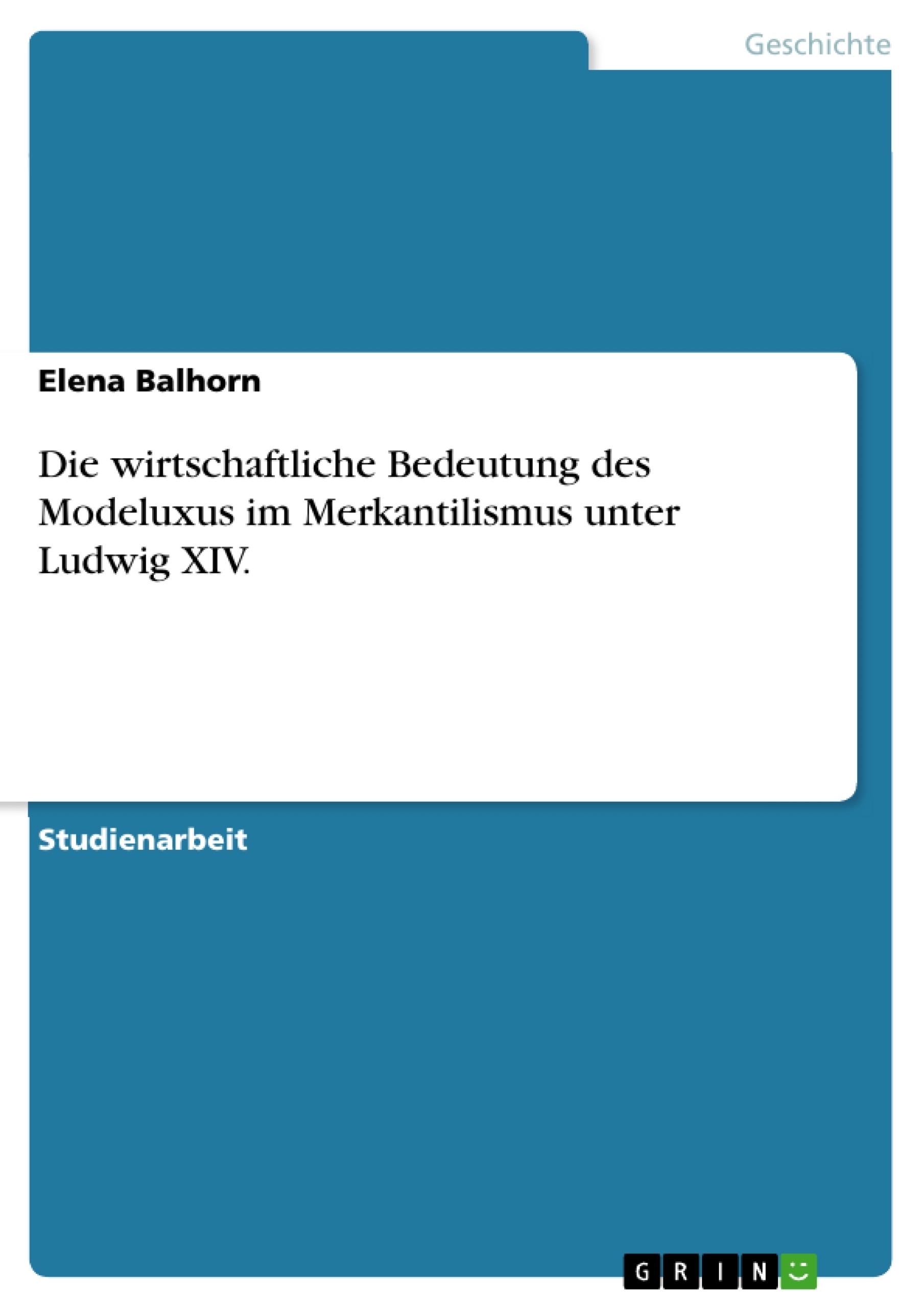König Ludwig XIV. von Frankreich regierte sein Land im Stil des Absolutismus.
In Hinblick dessen strebte der Monarch nicht nur für das französische Inland die Umsetzung seines absoluten Herrschaftsgedankens an, sondern beanspruchte diesen auch über seine Landesgrenzen hinaus. Seine kontinentalen Machtansprüche galten sowohl territorialen Eroberungen als auch gegenüber der ökonomischen Expansion Frankreichs. Anhand der merkantilistischen Wirtschaftstheorie verfolgte der König, mit erheblicher Unterstützung seines Wirtschaftsministers Jean Baptiste Colbert, das Ziel, Frankreich zur Wirtschaftsmacht in Europa aufzurüsten.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, am Beispiel des Modeluxus die wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs im Zeitalter des Merkantilismus zu skizzieren. Um dessen Relevanz für die Epoche bestimmen zu können, wird zunächst die generelle Idee der merkantilistischen Wirtschaftstheorie behandelt. Es schließt sich eine Erörterung darüber an, wie der Merkantilismus den absolutistischen Regierungsstil Ludwig XIV. prägte, bevor in Abschnitt 2.3 des Königs Wirtschaftsminister Jean Baptiste Colbert sowie dessen politische Arbeit dargestellt wird. Anschließend analysiert das Kapitel den Einfluss merkantilistischer Wirtschaftspraktiken auf den Produktionserfolg französischer Luxustextilien. Diesbezüglich soll im ersten Abschnitt der Ausbau des inländischen Manufakturwesens erläutert werden, daran anknüpfend erfolgt im zweiten Abschnitt eine Übersicht über die erfolgreiche Entwicklung französischer Textil-Luxusgüter.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Bedeutung des Merkantilismus für die Wirtschaftspolitik Ludwigs XIV
- 2.1 Der Merkantilismus
- 2.2 Der Merkantilismus im absolutistischen Zeitalter Ludwigs XIV.
- 2.3 Der Colbertismus
- 3. Die Bedeutung des Merkantilismus für französische Luxustextilien
- 3.1 Der Aufbau des französischen Manufakturwesens
- 3.2 Textile Luxusgüter aus Frankreich
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung Frankreichs im Zeitalter des Merkantilismus, speziell am Beispiel des Modeluxus. Sie untersucht, wie die merkantilistische Wirtschaftstheorie die Politik Ludwigs XIV. prägte und welchen Einfluss sie auf die Produktion französischer Luxustextilien hatte.
- Der Merkantilismus als wirtschaftspolitisches Hauptelement des 17. und 18. Jahrhunderts
- Die Rolle des Merkantilismus im absolutistischen Frankreich unter Ludwig XIV.
- Der Colbertismus als konkrete Ausprägung merkantilistischer Politik unter Ludwig XIV.
- Der Einfluss des Merkantilismus auf die Entwicklung des französischen Manufakturwesens
- Die Bedeutung französischer Luxustextilien im Kontext des Merkantilismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt König Ludwig XIV. und sein absolutistisches Herrschaftsverständnis vor und erläutert, wie der Merkantilismus unter seiner Regentschaft die Wirtschaftspolitik Frankreichs prägte.
2. Die Bedeutung des Merkantilismus für die Wirtschaftspolitik Ludwigs XIV.
2.1 Der Merkantilismus
Dieser Abschnitt beleuchtet die grundlegenden Prinzipien des Merkantilismus und seine Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Dabei wird die Zielsetzung, die nationale Wohlstandssteigerung durch Gold- und Silberbesitz, und die Anwendung von Handelsbeschränkungen und Zöllen erläutert.
2.2 Der Merkantilismus im absolutistischen Zeitalter Ludwigs XIV.
Dieses Kapitel untersucht die Integration des Merkantilismus in den absolutistischen Regierungsstil Ludwigs XIV. und stellt seine Auswirkungen auf die französische Wirtschaftspolitik dar. Es beleuchtet die absolute Macht des Königs und seine Streben nach territorialen und ökonomischen Eroberungen.
2.3 Der Colbertismus
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den Wirtschaftsminister Jean Baptiste Colbert und seine politische Arbeit im Kontext des Merkantilismus. Es werden Colberts Strategien zur Förderung der französischen Wirtschaft, wie die Entwicklung von Manufakturen und die Kontrolle des Handels, behandelt.
3. Die Bedeutung des Merkantilismus für französische Luxustextilien
3.1 Der Aufbau des französischen Manufakturwesens
In diesem Abschnitt wird die Ausweitung des französischen Manufakturwesens im Kontext des Merkantilismus untersucht. Es werden die Maßnahmen zur Förderung der Produktion von Luxusgütern und die Entwicklung der französischen Textilindustrie beleuchtet.
3.2 Textile Luxusgüter aus Frankreich
Dieses Kapitel beleuchtet die erfolgreiche Entwicklung französischer Luxustextilien, die als Ausdruck des Wohlstandes und der Macht des Landes galten. Es wird der Einfluss des Merkantilismus auf die Herstellung und den Handel dieser Luxusgüter untersucht.
Schlüsselwörter
Merkantilismus, Absolutismus, Ludwig XIV., Colbertismus, Frankreich, Wirtschaft, Luxustextilien, Manufakturen, Handel, Export, Import, Zölle, Handelsbilanz, Wohlstand, Macht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Merkantilismus?
Eine Wirtschaftstheorie des Absolutismus, die den nationalen Wohlstand durch Exportförderung und die Anhäufung von Edelmetallen steigern wollte.
Wer war Jean Baptiste Colbert?
Colbert war der Wirtschaftsminister von Ludwig XIV. und Schöpfer des „Colbertismus“, einer speziellen Form des Merkantilismus zur Stärkung der französischen Industrie.
Warum förderte Ludwig XIV. den Modeluxus?
Luxustextilien dienten als ökonomisches Expansionsmittel, um Frankreich zur führenden Wirtschaftsmacht in Europa zu machen und Devisen ins Land zu bringen.
Was ist ein Manufakturwesen?
Es ist eine Vorform der Fabrik, in der Handwerker arbeitsteilig Produkte (wie Seide oder Teppiche) für den Export herstellten.
Welche Rolle spielten Zölle im Merkantilismus?
Zölle wurden genutzt, um den Import von Fertigwaren zu erschweren und gleichzeitig Rohstoffe billig ins Land zu holen, um die Handelsbilanz zu optimieren.
- Arbeit zitieren
- Elena Balhorn (Autor:in), 2019, Die wirtschaftliche Bedeutung des Modeluxus im Merkantilismus unter Ludwig XIV., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1165784