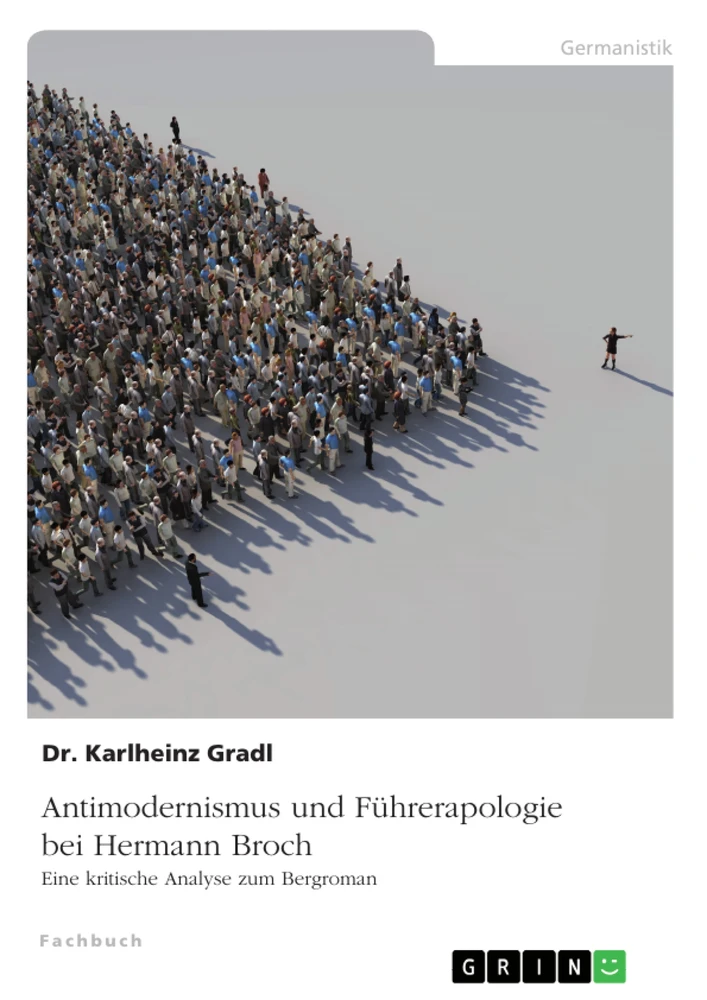Dieses Fachbuch beschäftigt sich mit den Themen Antimodernismus und Führerapologie in Hermann Brochs "Bergroman".
Die Arbeit beinhaltet eine kritische Analyse der Stellung Brochs zur Moderne, rekonstruiert aus der Analyse des "Bergromans" unter Einbeziehung der im zeitlichen Umfeld seiner Entstehung verfassten theoretischen Schriften des Autors. Dabei geht es auch um die Beurteilung von Brochs Verständnis von politischer Religion (des Nationalsozialismus) einschließlich einer Kritik der für den "Bergroman" relevanten Begriffe "Masse" und "Führer" in Brochs späterer Massenpsychologie.
Ausgangspunkt ist eine Skizze des für die Thematik relevanten Handlungsverlaufs; dem folgt die Rekonstruktion theoretischer Grundpositionen Brochs im Spiegel von Basistheoremen der Moderne; daraus ergibt sich die Möglichkeit einer kritischen Bewertung der für den "Bergroman" zentralen Motive Verzauberung, Opfer und Massenwahn; anschließend erfolgt eine Beurteilung von Brochs Stellung zur Moderne im Blick auf sein Verständnis von politischer Religion (des Nationalsozialismus); den Abschluss bildet die Kritik der für den Bergroman relevanten Begriffe „Masse“ und „Führer“.
Der Ich-Erzähler des "Bergromans", ein älterer Arzt, hat sich seit langem schon, aus Ekel vor dem städtischen Leben, in das Alpendorf Kuppron zurückgezogen, um hier nach einem „Wissen“ zu suchen, das „erfüllt“ sein soll. Seine im „Vorwort“ gegebene Selbsteinschätzung vermittelt dem Leser das Bild eines sozial desintegrierten, vereinsamten Menschen, der in Kuppron etwas wiederzufinden hofft, was er im Verlauf seines städtischen Lebens verloren hat: ein im Glauben fundiertes „Wissen“, das dem in der Moderne vorherrschenden „Erkennen“ übergeordnet sein soll.
Inhaltsverzeichnis
- I. Handlungsskizze des Bergromans
- II. Theoretischer Hintergrund: Säkularisierung und Moderne
- III. Zentraler Themenkomplex: Erlösung, Tod und Massensuggestion
- IV. Führer-Mythos: Marius Ratti und Brochs Verständnis von politischer Religion
- V. Der Bergroman: Literarisches Zeugnis eines ideologisch imprägnierten Antimodernismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hermann Brochs Bergroman, um dessen kritische Auseinandersetzung mit der Moderne zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse des Romans im Kontext von Brochs zeitgenössischen Essays. Die Arbeit rekonstruiert Brochs theoretische Positionen und wertet zentrale Motive des Romans kritisch aus.
- Antimodernismus und die Sehnsucht nach einem ganzheitlichen Weltbild
- Die Rolle von Erlösung, Tod und Massensuggestion im Roman
- Der Führermythos und Brochs Verständnis von politischer Religion
- Die Kritik an der Moderne und der Säkularisierungsprozess
- Die literarische Darstellung von "Masse" und "Führer"
Zusammenfassung der Kapitel
I. Handlungsskizze des Bergromans: Der Bergroman, 1935 fertiggestellt und erst postum veröffentlicht, spielt in einem Alpen-Bauerndorf kurz vor der NS-Machtergreifung. Broch, in seinen Kommentaren selbst auf den Zeitbezug hinweisend, ordnet das Werk seinem schon in "Die Schlafwandler" konstatierten Religions- und Werteverfall der bürgerlichen Welt zu. Der Roman folgt einem Ich-Erzähler, einem Arzt, der sich aus Ekel vor dem städtischen Leben zurückgezogen hat, auf der Suche nach einem sinnstiftenden "Wissen". Die Ankunft des Fremden Marius Ratti, dessen anti-fortschrittliche, religiöse Botschaft auf Resonanz stößt, bringt das Dorf aus dem Gleichgewicht. Rattis Einfluss führt schließlich zu einem rituellen Mord, der das zentrale Ereignis und den Höhepunkt der Handlung darstellt. Der Erzähler schwankt zwischen dem Glauben an eine religiös vermittelte "Wiedergeburt" und der aufgeklärten Vernunft, spiegelnd die erste Phase des Säkularisierungsprozesses mit der Sehnsucht nach einem geschlossenen Weltbild.
II. Theoretischer Hintergrund: Säkularisierung und Moderne: Brochs theoretische Schriften, zeitgleich mit dem Bergroman entstanden, bilden den theoretischen Hintergrund der Analyse. Broch leitet aus der "platonischen Idee" ein umfassendes Ordnungssystem ab, welches den Säkularisierungsprozess als eine vom Apriorismus sich emanzipierende Entwicklung sieht, die in Werterelativismus und Glaubensverlust mündet. Der Verlust des Wertes der "Aufhebung des Todes" stellt für Broch das Kernproblem dar, welches nur durch eine Erneuerung religiösen Bewusstseins gelöst werden kann – eine Erneuerung, die er von der historischen Aufklärung löst und in einer irrationalen Utopie verortet. Brochs philosophisches Niveau wird kritisch hinterfragt, seine Argumentationsketten werden als tautologisch und widersprüchlich beschrieben.
Schlüsselwörter
Hermann Broch, Bergroman, Antimodernismus, Säkularisierung, Moderne, Erlösung, Tod, Massensuggestion, Führermythos, politische Religion, Religions- und Werteverfall, "Wiedergeburt", platonische Idee, Massenpsychologie.
Häufig gestellte Fragen zum Bergroman von Hermann Broch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Hermann Brochs "Bergroman", um dessen kritische Auseinandersetzung mit der Moderne zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse des Romans im Kontext von Brochs zeitgenössischen Essays, rekonstruiert seine theoretischen Positionen und wertet zentrale Motive kritisch aus.
Welche Themen werden im Bergroman behandelt?
Zentrale Themen sind Antimodernismus und die Sehnsucht nach einem ganzheitlichen Weltbild, die Rolle von Erlösung, Tod und Massensuggestion, der Führermythos und Brochs Verständnis von politischer Religion, die Kritik an der Moderne und der Säkularisierungsprozess sowie die literarische Darstellung von "Masse" und "Führer".
Wie ist der Bergroman aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Handlungsskizze des Romans, eine Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund (Säkularisierung und Moderne), eine Analyse des zentralen Themenkomplexes (Erlösung, Tod, Massensuggestion), eine Betrachtung des Führermythos und schließlich eine Einordnung des Romans als literarisches Zeugnis eines ideologisch imprägnierten Antimodernismus.
Was ist die Handlung des Bergromans in Kürze?
Der Roman spielt in einem Alpen-Bauerndorf kurz vor der NS-Machtergreifung. Ein Arzt, der sich aus Ekel vor dem städtischen Leben zurückgezogen hat, sucht nach einem sinnstiftenden "Wissen". Die Ankunft des Fremden Marius Ratti, dessen anti-fortschrittliche, religiöse Botschaft Anklang findet, stört das Dorfleben. Rattis Einfluss führt zu einem rituellen Mord, dem Höhepunkt der Handlung. Der Erzähler schwankt zwischen Glauben an eine religiös vermittelte "Wiedergeburt" und aufgeklärter Vernunft.
Welche Rolle spielt die Säkularisierung in Brochs Werk?
Broch sieht den Säkularisierungsprozess als Emanzipation vom Apriorismus, der in Werterelativismus und Glaubensverlust mündet. Der Verlust des Wertes der "Aufhebung des Todes" ist das Kernproblem, das nur durch eine Erneuerung des religiösen Bewusstseins gelöst werden kann – eine Erneuerung, die er außerhalb der historischen Aufklärung in einer irrationalen Utopie verortet. Seine philosophischen Argumentationen werden kritisch hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Bergroman und seine Thematik?
Schlüsselwörter sind: Hermann Broch, Bergroman, Antimodernismus, Säkularisierung, Moderne, Erlösung, Tod, Massensuggestion, Führermythos, politische Religion, Religions- und Werteverfall, "Wiedergeburt", platonische Idee, Massenpsychologie.
Wie wird Brochs theoretische Position im Roman dargestellt?
Brochs zeitgenössische Essays bilden den theoretischen Hintergrund der Analyse. Seine theoretischen Positionen werden rekonstruiert und im Kontext des Romans kritisch ausgewertet. Seine Argumentationsketten werden als tautologisch und widersprüchlich beschrieben.
Welche Bedeutung hat der Führermythos im Bergroman?
Der Führermythos und Brochs Verständnis von politischer Religion sind zentrale Themen der Analyse. Der Roman untersucht die Wirkung von Rattis charismatischer Führung und die Massenpsychologischen Mechanismen, die zu dessen Einfluss beitragen.
- Citar trabajo
- Karlheinz Gradl (Autor), 2021, Antimodernismus und Führerapologie bei Hermann Broch. Eine kritische Analyse zum Bergroman, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1165947