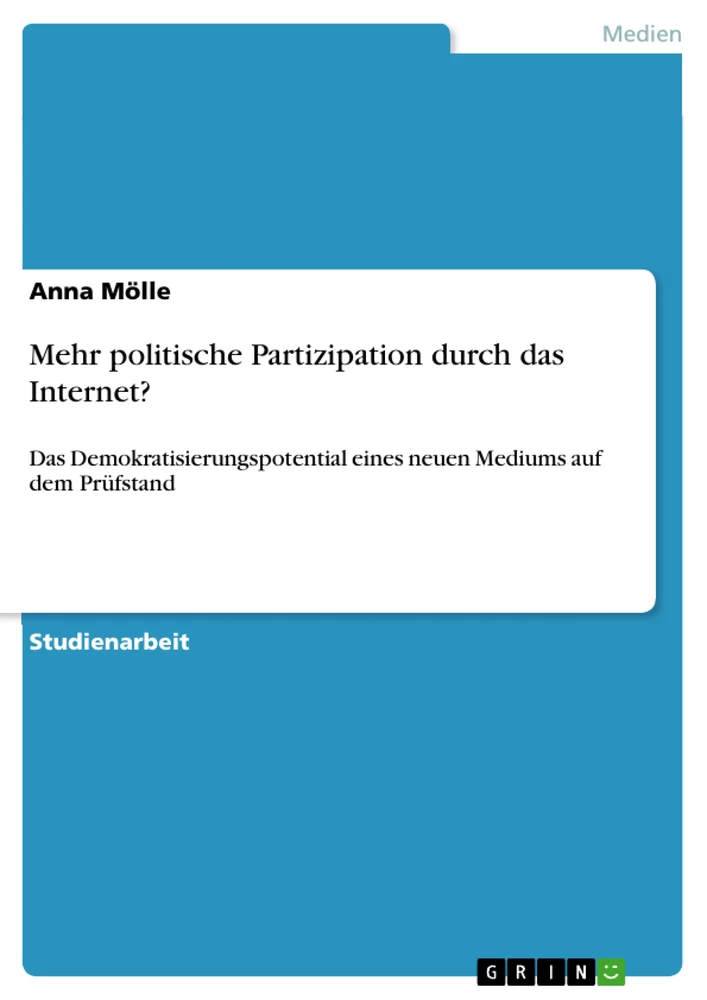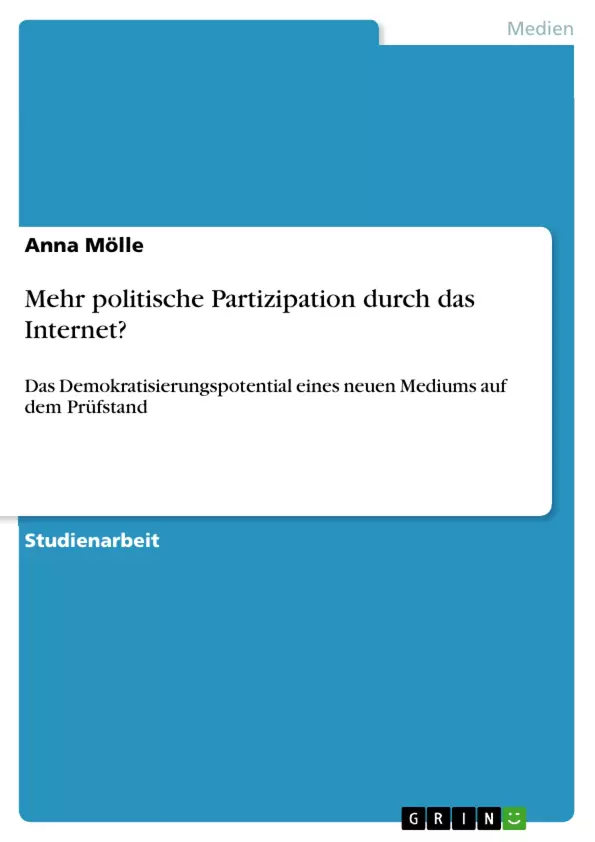In dieser Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich die Internetnutzung auf die politische Partizipation auswirkt. Im Mittelpunkt steht hierbei das Individuum (die Mirkoebene) und nicht etwa die Ebene der politischen Organisationen (Mesoebene) oder die Ebene der politischen Systeme (Makroebene). Es wird zunächst ein kurzer Überblick über den Forschungsstand gegeben, um die Schwerpunkte der Diskussion über die Auswirkungen des Internets auf die Politik aufzuzeigen. Hierbei findet zunächst eine Einordnung der in der Diskussion häufig gebrauchten Schlagworte E-Democacy und E-Government statt, daraufhin wird kurz auf die drei oben erwähnten Ebenen eingegangen, um dann zu den drei verschiedenen Positionen in der Diskussion überzuleiten, den Pessimisten, Optimisten und Neutralisten. Diesen drei Positionen werden drei unterschiedliche Thesen in Bezug auf die Auswirkungen der Internetnutzung zugeordnet, die Reinforcementthese, die Mobilisierungsthese und die Indifferenzthese. Da die so gefürchtete Digitale Spaltung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der politischen Partizipation eine große Rolle einnimmt, soll auch auf diese These in einem nächsten Schritt eingegangen werden und ihre Relevanz für das Thema dieser Arbeit deutlich gemacht werden.
Im zweiten großen Abschnitt werden die aufgeführten Thesen empirisch überprüft. Hierzu wird zunächst auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellsten ARD/ZDF-Online-Studie ein Überblick über die Internetnutzung im allgemeinen gegeben, um darüber Klarheit zu schaffen, wie groß die Gruppe der Offliner bzw. der Onliner überhaupt ist, und wodurch sich diese bei-den Gruppen unterscheiden. Danach wird mithilfe zweier Studien, die Mirko Marr in Bezug auf das Thema politische Informiertheit und digitale Spaltung überprüft hat und im weiteren mithilfe einer Studie von Martin Emmer, Markus Seifert und Gerhard Vowe zum Thema Internet und politische Kommunikation, geprüft, inwiefern sich die optimistischen, pessimistischen oder neutralistischen Erwartungen durch die empirischen Belege stützen lassen, inwieweit die Internetnutzung also eine Auswirkung auf die politische Partizipation hat und man von einem Demokratisierungspotential des Internets sprechen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über den Forschungsstand
- E-Government und E-Democracy
- Mikro-, Meso- und Makroebene
- Pessimisten, Optimisten und Neutralisten
- Mobilisierung-, Reinforcement- und Indifferenzthese
- Digitale Spaltung
- Definition
- Relevanz der digitalen Spaltung für die Demokratisierungsfunktion des Internets
- Empirische Befunde
- Die ARD/ZDF-Online-Studie
- Methode und Untersuchungsdesign
- Ergebnisse der ARD/ZDF-Online-Studie 2006
- Mirko Marr
- Datengrundlage
- Ergebnisse
- Emmer/Seifert/Vowe
- Datengrundlage und Ziel der Studie
- Die ARD/ZDF-Online-Studie
- Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Internetnutzung auf die politische Partizipation. Der Fokus liegt auf der Mikroebene, dem Individuum und seinen politischen Aktivitäten, und nicht auf der Ebene der politischen Organisationen oder der politischen Systeme. Das Ziel ist es, die Auswirkungen des Internets auf die politische Partizipation zu analysieren und zu beurteilen, ob es ein Demokratisierungspotenzial besitzt.
- Die Bedeutung der digitalen Spaltung für die politische Partizipation
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Einfluss des Internets auf die Politik (Pessimisten, Optimisten, Neutralisten)
- Die Rolle des Internets in der politischen Kommunikation und Information
- Die empirische Überprüfung der Auswirkungen der Internetnutzung auf die politische Partizipation
- Die Analyse der Ergebnisse von verschiedenen Studien zur Internetnutzung und politischen Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der politischen Partizipation im digitalen Zeitalter ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Internetnutzung auf die politische Partizipation. Der zweite Abschnitt bietet einen Überblick über den Forschungsstand und ordnet die Diskussion über die Auswirkungen des Internets auf die Politik in verschiedene Ebenen (Mikro, Meso, Makro) und Perspektiven (Pessimisten, Optimisten, Neutralisten) ein. Anschließend wird die Digitale Spaltung und ihre Relevanz für die politische Partizipation beleuchtet. Im dritten Abschnitt werden empirische Befunde aus verschiedenen Studien präsentiert, die die Internetnutzung und ihre Auswirkungen auf die politische Partizipation analysieren. Schließlich werden die Ergebnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Internet, Digitale Spaltung, E-Government, E-Democracy, Mikroebene, Demokratisierungspotenzial, Online-Kommunikation, politische Information, empirische Befunde, ARD/ZDF-Online-Studie, Mirko Marr, Emmer/Seifert/Vowe.
Häufig gestellte Fragen
Führt das Internet zu mehr politischer Partizipation?
Die Arbeit untersucht dies empirisch und stellt verschiedene Thesen (Mobilisierung, Reinforcement, Indifferenz) gegenüber, um das Demokratisierungspotenzial zu bewerten.
Was bedeutet die "Digitale Spaltung" für die Demokratie?
Die digitale Spaltung beschreibt den ungleichen Zugang zum Internet, was dazu führen kann, dass bereits politisch aktive Gruppen gestärkt werden, während andere weiter ins Abseits geraten.
Was besagt die Mobilisierungsthese?
Diese optimistische Sichtweise geht davon aus, dass das Internet neue Bevölkerungsgruppen für die Politik motiviert, die zuvor inaktiv waren.
Was ist der Unterschied zwischen E-Government und E-Democracy?
E-Government bezieht sich auf die elektronische Abwicklung von Verwaltungsdiensten, während E-Democracy die Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen via Internet meint.
Welche Rolle spielt die Mikroebene in der Untersuchung?
Die Analyse konzentriert sich auf das Individuum und sein persönliches Verhalten, statt auf Parteien (Mesoebene) oder ganze politische Systeme (Makroebene).
Welche empirischen Quellen nutzt die Arbeit?
Es werden unter anderem die ARD/ZDF-Online-Studie sowie Untersuchungen von Mirko Marr und Emmer/Seifert/Vowe herangezogen.
- Citar trabajo
- Anna Mölle (Autor), 2007, Mehr politische Partizipation durch das Internet?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116626