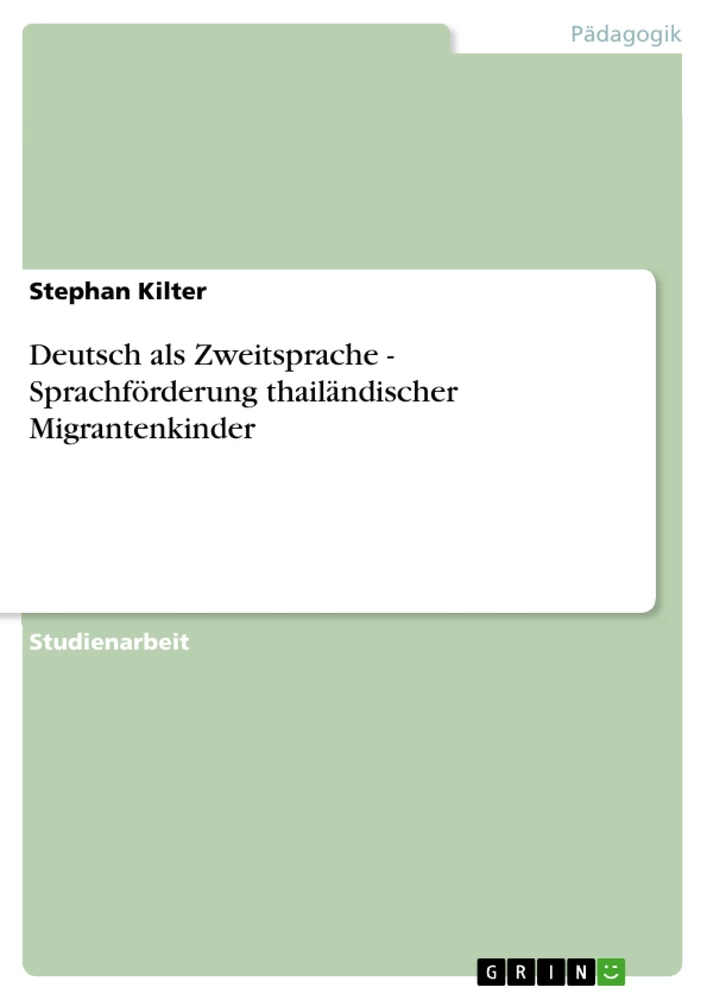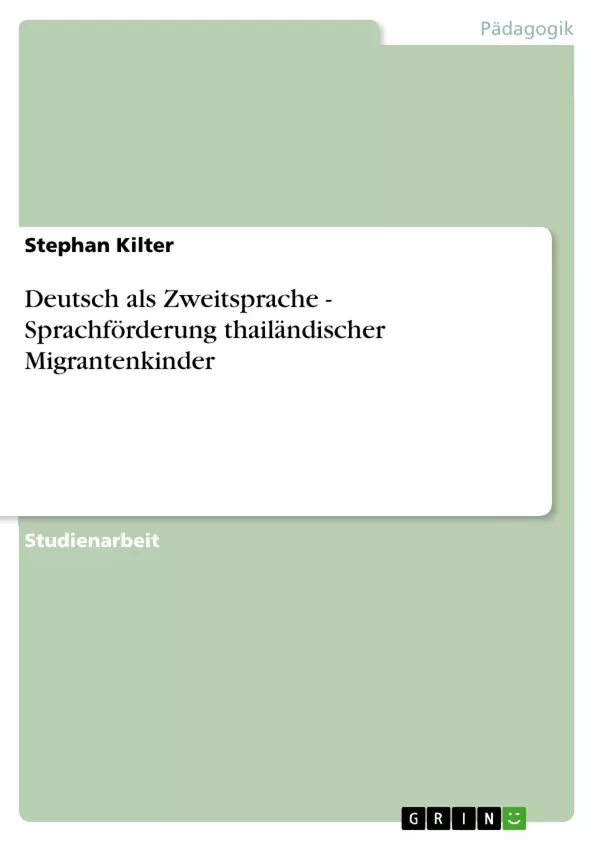„Migration“, „Integration“, „Multi-Kulti-Idylle“ und „doppelte Halbsprachigkeit“: Wenig
andere Themen sind im Zusammenhang mit den letzten Pisa-Ergebnissen so sehr in den
Blickpunkt des öffentlichen Diskurses gerückt worden, wie das der Migration und den damit
verbundenen Problemen im Schulalltag und Unterricht. Auch wenn der Deutsch-Unterricht
davon keineswegs allein betroffen ist, so gilt gemeinhin die Verbesserung der sprachlichen
Kompetenzen dieser Schüler als ein erster Lösungsansatz auf dem Weg zu höherem
schulischen Erfolg und damit besserer gesellschaftlicher Integration. Die Notwendigkeit
besonderer Förderkonzepte und Lernstrategien ist jedoch nicht erst seit den Ergebnissen der
Pisa-Studie erkannt worden, sondern spielt schon seit längerer Zeit in der Deutschdidaktik
und besonders in deren Teildisziplin „Deutsch als Zweitsprache“ eine tragende Rolle.
Natürlich standen hierbei zunächst die Lernschwierigkeiten und Sprachprobleme der
Angehörigen großer Migrationskulturen im Mittelpunkt: in erster Linie türkisch-, arabischund
russisch-sprechender Kinder und Jugendlicher. Aber auch andere Kulturen des
europäischen Sprachraums finden sich meist hinlänglich thematisiert in der einschlägigen
Fachliteratur wieder, die asiatischen Sprachkulturen sind dagegen eher unterrepräsentiert.1
Vom Vietnamesischen einmal abgesehen, trifft dies ganz besonders auf die südostasiatischen
Sprachen zu, auch wenn an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden muss, dass diese schon
allein aufgrund der geringeren Migrationszahlen, nicht von primärer Bedeutung sind. Die
Schwierigkeiten, die Kinder dieser Sprachgemeinschaften haben, sich in und außerhalb des
Unterrichtsgeschehens zurechtzufinden, sind jedoch häufig kaum geringer als die ihrer
türkisch- und arabisch-stämmigen Mitschüler. In dieser Hausarbeit soll der Schwerpunkt auf
die Situation der thailändischen Migrantenkinder gelegt und veranschaulicht werden, vor
welchen sozial-, kulturell- und sprach-spezifischen Problemen diese Schülergruppe steht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Deutsch als Zweitsprache
- 1. Grundlagen - Zum Migrationsbegriff
- 2. Theorien und Wege des Zweitspracherwerbs
- 3.,,Deutsche Sprache -schwere Sprache“ – Problemfelder und Schwierigkeiten.
- III. Förderkonzepte und Strategien
- 1. Pädagogische und didaktische Prinzipien
- 2. Methodische Überlegungen.....
- IV. Thailändische Migrantenkinder
- 1. Versuch einer Einordnung – soziale Herkunft.
- 2. Kulturelle und strukturelle Besonderheiten..
- 3 Kurze Einführung in das Thailändische.
- V. Praktischer Teil: Lernstrategien und Förderkonzepte
- 1. Unterrichtsgegenstand und Lernziele..
- 2. Stellung der Stunde innerhalb der Unterrichtsreihe & Stundenverlauf...
- 3. Methodische und didaktische Überlegungen.
- VI. Fazit und Schlusswort.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die sprachlichen Herausforderungen thailändischer Migrantenkinder im deutschen Schulsystem. Sie beleuchtet die spezifischen sozialen, kulturellen und sprachlichen Schwierigkeiten, denen diese Schülergruppe gegenübersteht. Im Zentrum stehen die Entwicklung von Förderkonzepten und Lernstrategien, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder zugeschnitten sind.
- Sprachliche Herausforderungen im Deutschlernen für thailändische Migrantenkinder
- Soziale und kulturelle Faktoren, die den Spracherwerb beeinflussen
- Entwicklung von Förderkonzepten und Lernstrategien
- Methodische und didaktische Überlegungen im Unterricht
- Vergleichende Betrachtung der thailändischen Sprache und der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Deutsch als Zweitsprache" und die besonderen Herausforderungen von Migrantenkinder im deutschen Schulsystem ein. Im zweiten Kapitel werden grundlegende Konzepte der Migration und des Zweitspracherwerbs erläutert, sowie die spezifischen Schwierigkeiten für Migrantenkinder im deutschen Sprachraum beleuchtet. Kapitel III fokussiert auf Förderkonzepte und Strategien, die im Unterricht eingesetzt werden können. Das vierte Kapitel widmet sich der Situation thailändischer Migrantenkinder, ihrer sozialen Herkunft, kulturellen Besonderheiten und der thailändischen Sprache im Vergleich zum Deutschen. Im fünften Kapitel werden die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln auf die reale Unterrichtssituation bezogen und verschiedene Methoden und Verfahrensweisen vorgestellt, die im Umgang mit den sprachlichen Defiziten und Problemen der Kinder hilfreich sein können. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Deutsch als Zweitsprache, Migrantenkinder, thailändische Sprache, Sprachförderung, Interkulturelle Kompetenz, Lernstrategien, Unterrichtskonzepte, soziale Herkunft, kulturelle Besonderheiten, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Welchen spezifischen Herausforderungen begegnen thailändische Migrantenkinder?
Sie stehen vor einer Kombination aus sozialen, kulturellen und sprachspezifischen Problemen, die oft weniger thematisiert werden als bei größeren Migrationsgruppen.
Was versteht man unter „doppelter Halbsprachigkeit“?
Dieser Begriff beschreibt das Phänomen, wenn Migrantenkinder weder ihre Herkunftssprache noch die Zielsprache (Deutsch) auf einem altersgemäßen, kompetenten Niveau beherrschen.
Wie unterscheidet sich das Thailändische strukturell vom Deutschen?
Das Thailändische ist eine Tonsprache mit einer gänzlich anderen Grammatik und Schrift, was den Erwerb des Deutschen als Zweitsprache besonders komplex macht.
Welche Rolle spielen kulturelle Besonderheiten beim Spracherwerb?
Kulturelle Werte und Erziehungsmuster beeinflussen das Lernverhalten und die Interaktion im Unterricht, was bei der Entwicklung von Förderkonzepten berücksichtigt werden muss.
Welche Förderstrategien sind für diese Schülergruppe effektiv?
Notwendig sind didaktische Prinzipien, die interkulturelle Kompetenz fördern und gezielte methodische Ansätze zur Überwindung spezifischer sprachlicher Defizite bieten.
Warum sind asiatische Sprachkulturen in der Fachliteratur oft unterrepräsentiert?
Dies liegt primär an den im Vergleich zu anderen Gruppen (z. B. türkisch- oder russischsprachig) geringeren Migrationszahlen, was jedoch die individuelle Problematik nicht mindert.
- Arbeit zitieren
- Stephan Kilter (Autor:in), 2005, Deutsch als Zweitsprache - Sprachförderung thailändischer Migrantenkinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116630