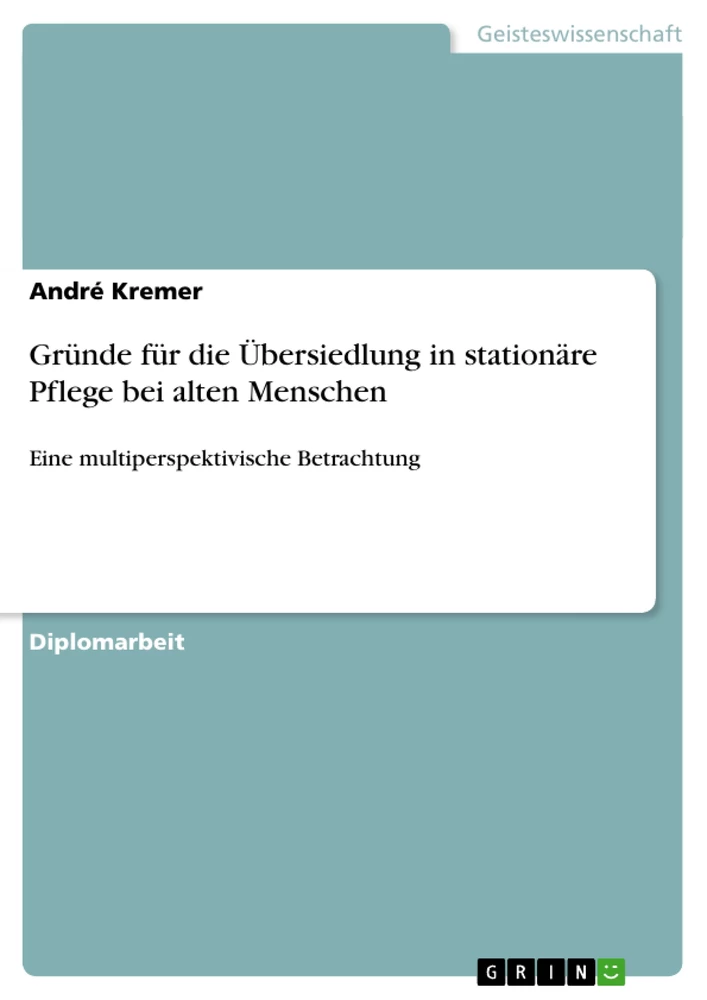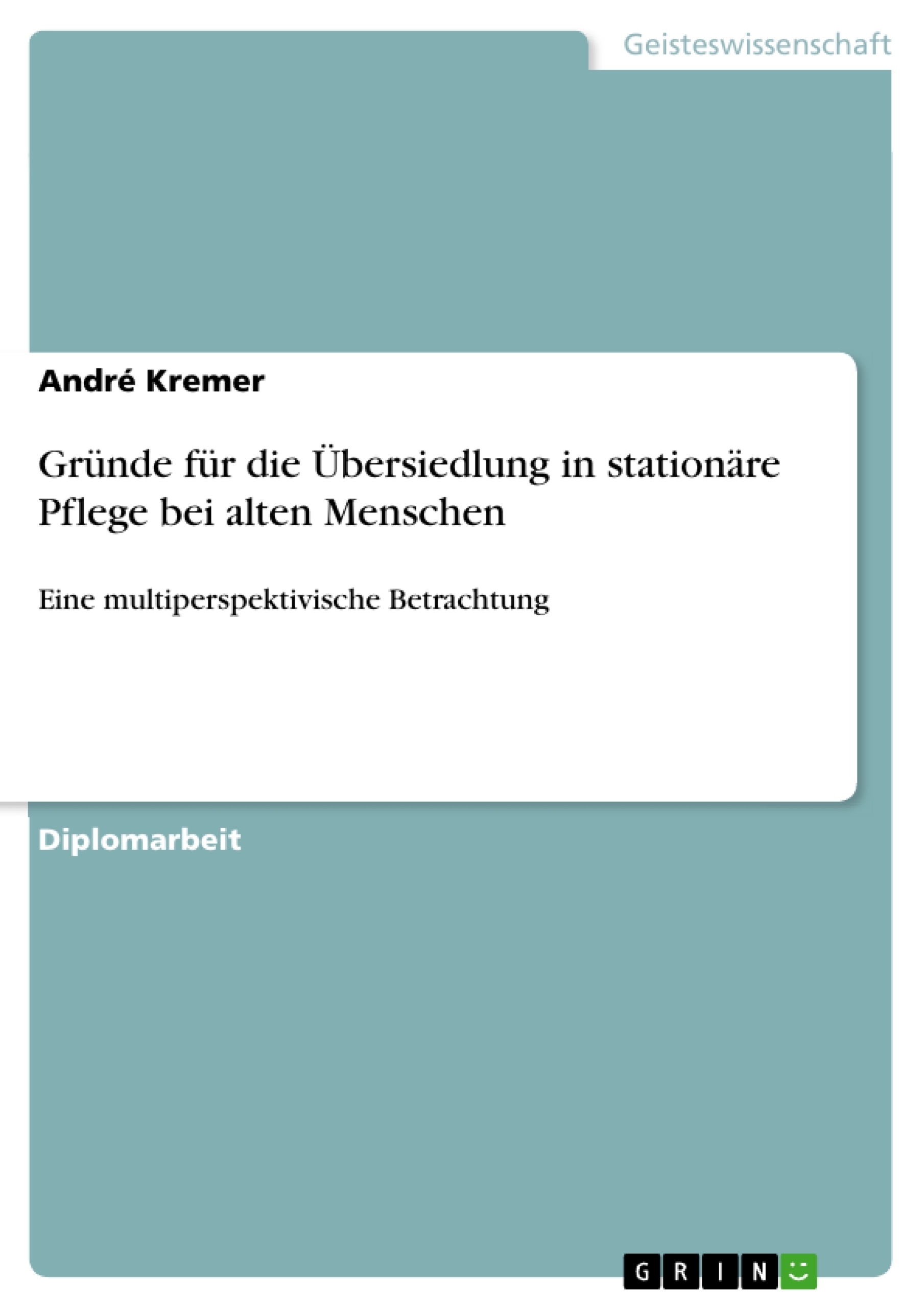„Der Eintritt alter Menschen in Alten- und Pflegeheime ist in der Bundesrepublik nach wie vor stark vernachlässigt und oft auf mikrosoziologische und psychologische Fragestellungen eingeengt“ (Klein et al. 1997, S. 55). Der von Klein et al. in den Jahren 1995 und 1996
durchgeführte Erhebung zu den soziostrukturellen Merkmalen der institutionalisierten Bevölkerung (Altenheimsurvey) liegt jedoch mittlerweile schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. In der Zwischenzeit sind viele Forschungsvorhaben durchgeführt worden, die sich mit
diesem Thema entweder in direkter Weise befassten oder Ergebnisse produziert haben, die Hinweise auf die Gründe für Heimübersiedlungen geben. Die hier vorliegende Arbeit ist mit dem Anliegen geschrieben worden, wesentliche Forschungsergebnisse zu erfassen und - wo dies offensichtlich erscheint – in Beziehung zueinander zu setzen. Ausgangspunkte der Arbeit sind auf der einen Seite das Begriffspaar Pflege und Pflegebedürftigkeit und auf der anderen Seite gesamtgesellschaftliche Prozesse und die Akteure, die mit diesem Begriffspaar in Beziehung stehen. Dies sind erstens die sozialpolitischen Akteure, die in dieser Arbeit in Gestalt der für Pflege und Pflegebedürftigkeit relevanten sozialpolitischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.
Zweitens pflegeprofessionelle Akteure, die Pflegedienstleistungen in den verschiedenen Settings der Pflegeversorgung erbringen. Drittens Akteure aus dem sozialen Netzwerk von pflegebedürftigen Menschen, die Pflegeleistungen ausschließlich im häuslichen Bereich erbringen, und viertens die von Pflegebedürftigkeit betroffenen Menschen selbst, deren individuelle Lebenslage mitbestimmend für den Umgang mit der eigenen Pflegebedürftigkeit
ist.
Die Pflegebedürftigkeit ist ein Phänomen, das vorwiegend ältere Menschen betrifft. Wie aber an dem Spektrum der eben genannten Akteure zu erkennen ist, erfolgt die Finanzierung, Organisation und Durchführung der Pflege gesamtgesellschaftlich. Daher wird Pflege und Pflegebedürftigkeit in der vorliegenden Arbeit ebenso aus einer demografischen Perspektive
betrachtet. Eine weitere Bedeutung für Pflege und Pflegebedürftigkeit nehmen diejenigen gesellschaftlichen Phänomene ein, die mit dem Begriff Individualisierung in Verbindung gebracht werden. Bei Prognosen über die zukünftige Ausgestaltung und Finanzierung der Pflegeversorgung steht dieser Begriff nicht selten Pate für pessimistisch gefärbte Erwartungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erläuterung wichtiger Begriffe
- 2.1. Erläuterung und Abgrenzung der altersbezogenen wissenschaftlichen Disziplinen
- 2.2. Demografischer Wandel - definitorische Erfassung eines viel verwendeten Begriffs
- 2.3. Modernisierung und Individualisierung – eine Reflexion gesellschaftlicher Wandlungsprozesse
- 3. Der Altersbegriff im Blick wissenschaftlicher Disziplinen
- 3.1. Soziohistorische Entstehungsgeschichte der Lebensphase Alter
- 3.2. Soziologische Kriterien zur Abgrenzung der Lebensphase Alter
- 3.3. Die Lebensphase Alter nach dem Lebenslagenkonzept
- 3.4. Das Alter aus Sicht der Medizin
- 3.5. Die klassischen Alterskonzepte der Sozialen Gerontologie
- 3.5.1. Aktivitätskonzept
- 3.5.2. Disengagementkonzept
- 3.5.3. Kontinuitätskonzept
- 3.5.4. Gesamteinschätzung der klassischen Alterskonzepte
- 4. Gesellschaftliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen
- 4.1. Pflegebedürftigkeit im Kontext deutscher Sozialpolitik
- 4.1.1. Wie die Pflegebedürftigkeit zu einem Sozialen Problem wurde
- 4.1.2. Die Soziale Pflegeversicherung als sozialpolitische Antwort auf Pflegebedürftigkeit
- 4.1.3. „Ambulant vor Stationär“ – Ein Grundsatz der Sozialen Pflegeversicherung
- 4.2. Der Einfluss des demografischen Wandels auf die Entwicklung der Pflegeversorgung seit Einführung der Sozialen Pflegeversicherung
- 4.3. Die Konsequenzen des demografischen Wandels für das Gesundheitswesen
- 4.4. Zwischenfazit
- 5. Die Rolle sozialprofessioneller Akteure
- 5.1. Pflegebedürftigkeit und Pflege im Kontext pflegewissenschaftlicher Konzepte
- 5.1.1. Potentiale und Defizite professioneller ambulanter und teilstationärer Hilfen
- 5.1.2. Bedingungen für die Inanspruchnahme professioneller ambulanter Hilfen in häuslichen Pflegearrangements
- 5.1.3. Soziostrukturelle Merkmale der institutionalisierten pflegebedürftigen Bevölkerung
- 5.2. Alternative und kombinierte Versorgungskonzepte
- 5.3. Zwischenfazit
- 6. Die Bedeutung sozialer Netzwerke
- 6.1. Pflegebedürftigkeit im Kontext Sozialer Netzwerke – eine erste Bestandsaufnahme
- 6.2. Familiale Soziale Netzwerke
- 6.2.1. Familie gestern, heute, morgen – Über den Wandel einer fundamentalen Institution deutscher Sozialpolitik
- 6.2.2. Destabilisierende Einflüsse in familialen Pflegearrangements
- 6.2.3. Pflegemotive und pflegekulturelle Orientierungen
- 6.3. Die Bedeutung sozialer Unterstützung von nicht-familialen Netzwerkpartnern im Kontext von Pflegebedürftigkeit
- 6.4. Zwischenfazit
- 7. Individuelle Perspektiven
- 7.1. Stadt-Land-Unterschiede in den Lebenslagen pflegebedürftiger Menschen
- 7.2. Finanzielle Situation älterer Menschen
- 7.3. Wohn- und Lebenswelten
- 7.4. Soziale Beziehungen
- 7.5. Objektiver Gesundheitszustand & subjektive Gesundheitseinschätzung
- 7.6. Zwischenfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Gründen für die Übersiedlung in stationäre Pflege bei alten Menschen. Sie verfolgt das Ziel, die komplexen Faktoren, die zu dieser Entscheidung führen, aus multiperspektivischer Sicht zu beleuchten und zu analysieren. Die Arbeit untersucht sowohl gesellschaftliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen als auch die Rolle sozialprofessioneller Akteure und die Bedeutung sozialer Netzwerke. Darüber hinaus werden individuelle Perspektiven pflegebedürftiger Menschen in den Blick genommen.
- Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Pflegeversorgung
- Die Rolle der Sozialen Pflegeversicherung und die Bedeutung von "Ambulant vor Stationär"
- Die Bedeutung sozialer Netzwerke für die Pflegebedürftigen und ihre Familien
- Die Herausforderungen und Chancen der professionellen Pflege
- Individuelle Lebenslagen und Entscheidungsfaktoren im Kontext der Übersiedlung in stationäre Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 erläutert wichtige Begriffe wie "altersbezogene wissenschaftliche Disziplinen", "demografischer Wandel", "Modernisierung" und "Individualisierung". Kapitel 3 analysiert den Altersbegriff aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, darunter die soziohistorische Entstehungsgeschichte, soziologische Kriterien, das Lebenslagenkonzept und die klassischen Alterskonzepte der Sozialen Gerontologie. Kapitel 4 beleuchtet die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen der Pflegebedürftigkeit in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die Soziale Pflegeversicherung und die Auswirkungen des demografischen Wandels. Kapitel 5 untersucht die Rolle sozialprofessioneller Akteure und die Bedeutung pflegewissenschaftlicher Konzepte im Kontext der Pflegebedürftigkeit. Kapitel 6 befasst sich mit der Bedeutung sozialer Netzwerke, insbesondere familialer Netzwerke, für die Pflegebedürftigen und ihre Familien. Kapitel 7 analysiert individuelle Perspektiven pflegebedürftiger Menschen, indem es verschiedene Aspekte wie Stadt-Land-Unterschiede, finanzielle Situation, Wohn- und Lebenswelten, soziale Beziehungen und den Gesundheitszustand beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Pflegebedürftigkeit, stationäre Pflege, Demografischer Wandel, Soziale Pflegeversicherung, Ambulante Pflege, Familiale Netzwerke, Soziale Netzwerke, Professionelle Pflege, Individuelle Lebenslagen und Entscheidungsfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Warum ziehen alte Menschen in eine stationäre Pflegeeinrichtung um?
Die Gründe sind komplex und umfassen den Gesundheitszustand, die Überlastung familialer Netzwerke, finanzielle Aspekte sowie die individuelle Wohn- und Lebenswelt.
Was bedeutet der Grundsatz "Ambulant vor Stationär"?
Es ist ein Leitprinzip der deutschen Pflegeversicherung, das darauf abzielt, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung zu versorgen.
Welche Rolle spielt der demografische Wandel für die Pflege?
Die zunehmende Zahl älterer Menschen bei gleichzeitigem Rückgang der familiären Unterstützungspotenziale stellt die Finanzierung und Organisation der Pflege vor große Herausforderungen.
Wie haben sich familiale Pflegenetzwerke verändert?
Durch Individualisierung und Mobilität sind traditionelle Familienstrukturen instabiler geworden, was die Inanspruchnahme professioneller ambulanter oder stationärer Hilfen notwendiger macht.
Was sind die klassischen Alterskonzepte der Sozialen Gerontologie?
Dazu gehören das Aktivitätskonzept, das Disengagementkonzept und das Kontinuitätskonzept, die unterschiedliche Sichtweisen auf das Altern und die Lebensgestaltung im Alter bieten.
Gibt es Unterschiede in der Pflegeversorgung zwischen Stadt und Land?
Ja, die Arbeit untersucht Stadt-Land-Unterschiede in den Lebenslagen pflegebedürftiger Menschen, die sich auf die Verfügbarkeit von Diensten und sozialen Netzwerken auswirken.
- Quote paper
- Diplom André Kremer (Author), 2008, Gründe für die Übersiedlung in stationäre Pflege bei alten Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116721