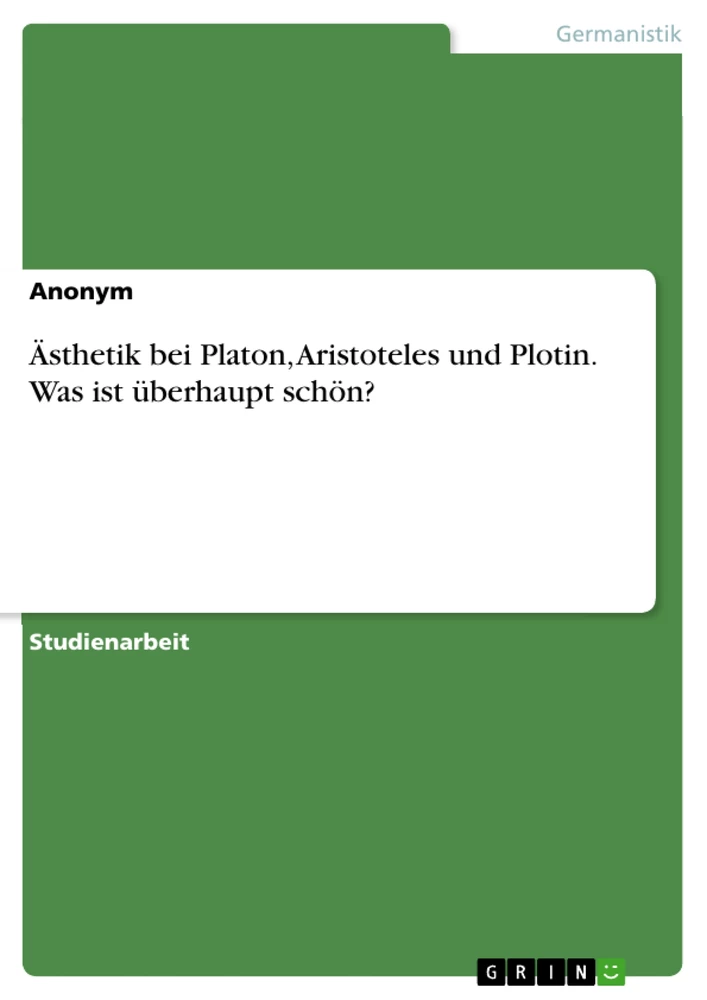Was ist überhaupt schön? Eine spontane Antwort darauf wird bei den meisten Befragten höchstwahrscheinlich subjektiv geprägt sein, je nach persönlichem Geschmack und individuellen Vorlieben. Tatsächlich begleitet die Frage die Menschheit schon seit über 2300 Jahren – zumindest reichen die schriftlich überlieferten Aufzeichnungen bis dahin zurück. Eine Vielzahl von bekannten Philosophen und Dichtern hat sich seitdem mit der Ästhetik beschäftigt: Beginnend bei Platon, Aristoteles, Plotin bis hin zu Kant, Hegel und Nietzsche. Die Geschichte der Ästhetik hat ihren Ursprung im antiken Griechenland. Dort begründete Platon die erste systematische Ästhetik und schuf den Grundstein für alle weiteren ästhetischen Überlegungen, selbst für seine größten Kritiker wie zum Beispiel Nietzsche.
Weitere wirkmächtige antike Philosophen der Ästhetikgeschichte waren Aristoteles, der wohl bekannteste Schüler Platons, und Plotin, der mit seiner Platon-Vergegenwärtigung die letzte große, antike, philosophische Strömung begründete: den Neuplatonismus. Beide entwickelten eigene Ideen und Überzeugungen zur Ästhetik, natürlich immer unter Rückgriff auf Platons Philosophie.
Die zentrale Fragestellung der nachfolgenden Untersuchung lautet daher, wie Plotins Position zwischen Platons und Aristoteles zu verorten ist. Als Arbeitsthese dient Lambert Wiesings Aussage, wie entscheidend – aber auch wie unterschiedlich – die Stellung der Ästhetik in einem idealistischen System sein kann. Eine vergleichende Analyse der verschiedenen Ideen, Ansichten und Überzeugungen ermöglicht eine Einordnung ihres Wirkens für die Ästhetikgeschichte und kann dadurch rückblickend die philosophische Bedeutung ihrer Überlegungen verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Idealistisches System
- Plotin und Platon
- Idealistisches System
- Schönheitsbegriff
- Kunstbegriff/ Kunstverständnis
- Plotin und Aristoteles
- Kunstbegriff/ Kunstverständnis
- Plotins Platon und Aristoteles Platon
- Mimesis
- Plotin und Platon
- Plotin und Aristoteles
- Schluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung befasst sich mit dem ästhetischen Denken von Plotin im Kontext der Philosophien von Platon und Aristoteles. Ihr Ziel ist es, Plotins Position im Vergleich zu den beiden großen antiken Denkern zu analysieren und seine spezifischen Beiträge zur Ästhetik zu beleuchten.
- Vergleich des idealistischen Systems von Platon und Plotin
- Untersuchung der Schönheitsbegriffe bei Platon und Plotin
- Analyse des Kunstbegriffs in den Philosophien von Platon, Plotin und Aristoteles
- Rekonstruktion des Einflusses Platons auf Plotin und Aristoteles
- Bedeutung der Mimesis in der ästhetischen Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Untersuchung ein: Wie lässt sich Plotins Position zwischen Platon und Aristoteles verorten? Dabei werden die wichtigsten Aspekte der antiken Ästhetik beleuchtet und der methodische Rahmen der Analyse vorgestellt.
Das erste Kapitel vergleicht die Philosophien von Platon und Plotin hinsichtlich ihres idealistischen Systems. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansichten über die Beziehung zwischen der sichtbaren und der idealen Welt beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden die Schönheitsbegriffe von Platon und Plotin analysiert. Dabei wird insbesondere die Bedeutung der Liebe zum Schönen und die Rolle der Kunst im Kontext der jeweiligen Philosophien betrachtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Kunstverständnis bei Plotin und Aristoteles. Es wird analysiert, wie sich die beiden Denker auf Platons Kunstbegriff beziehen und welche spezifischen Ansätze sie selbst entwickelten.
Schlüsselwörter
Die Untersuchung fokussiert auf die Schlüsselbegriffe des Schönen, der Mimesis, des Scheins und der Wahrheit. Darüber hinaus werden wichtige Themen wie das idealistische System, die Rolle der Kunst und der Einfluss von Platon auf die Ästhetik der Antike beleuchtet.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Ästhetik bei Platon, Aristoteles und Plotin. Was ist überhaupt schön?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167314