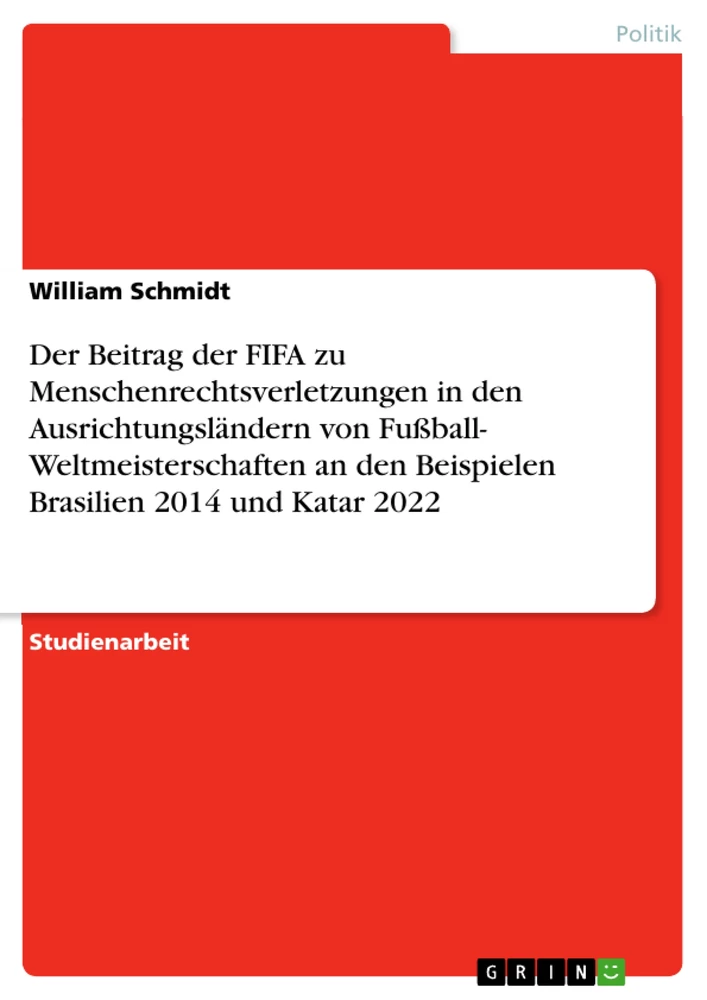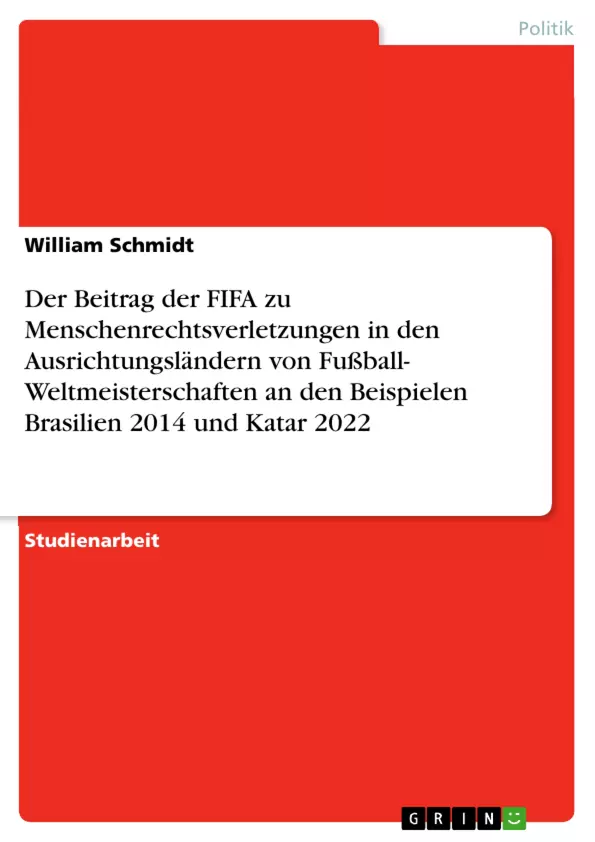Die FIFA Weltmeisterschaft der Männer 1994 wird in den USA ausgetragen. Im zweiten Gruppenspiel treffen die USA auf Kolumbien. Kolumbien ist Mitfavorit auf den Titel, muss das Spiel aber gewinnen, um eine Runde weiter zu kommen. Bereits vor dem Spiel ging per Fax eine Bombendrohung ein, adressiert an einen der Mittelfeldspieler Kolumbiens. Nach 35 Minuten Spielzeit will Andres Escobar, ein kolumbianischer Verteidiger, eine Flanke der USA abwehren und erzielt dabei ein Eigentor. Kolumbien verliert das Spiel zwei zu eins und scheidet aus dem Turnier aus. Wenige Tage nach der Rückkehr seines Teams ist Andres Escobar tot. Unbekannte hatten ihn auf offener Straße erschossen.
Neben großen Emotionen ist der Fußball schon lange nicht mehr nur Leidenschaft und Freude, sondern in ein komplexes Konstrukt aus ökonomischen, finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen eingebettet. Mit dem Recht eine Weltmeisterschaft ausrichten zu dürfen gehen dabei viele Verpflichtungen einher: Visumsfreiheit für alle an einer WM beteiligten Personen; die Garantie der Sicherheit auf Kosten des ausrichtenden Staates; eine Steuerbefreiung der FIFA und etwaiger Drittparteien, die an der Weltmeisterschaft beteiligt sind sowie arbeitsrechtliche und sonstige Ausnahmeregelungen, für direkt an der Weltmeisterschaft beteiligte Unternehmen und Personen.
Diese Arbeit kann und soll nicht den Anspruch erheben, als Grundlage für eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der FIFA zu dienen. Dafür bietet diese Arbeit weder den Rahmen, noch ist sie daraufhin ausgelegt. Als global agierende Organisation agiert sie aber nicht in einem rechtsfreien Raum und ihre Monopolstellung ist durchaus kritisch zu betrachten. Obwohl die FIFA keinen eigenen Verein stellt, besitzt sie ein Monopol auf das begehrteste Kollektivgut der Welt – Fußball. Die Zuschauer*innenzahlen der Weltmeisterschaften zeigen, wie groß der Einfluss der FIFA sein kann, aber auch welche Verantwortung sie trägt. Wie sie diese Verantwortung nutzt, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Die Ambivalenz zwischen theoretischen Werten auf der einen und dem realen Handeln der FIFA auf der anderen Seite, soll in dieser Arbeit, anhand von zwei Beispielen, untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Menschenrechte
- 2.1. Internationale Menschenrechtscharta
- 2.2. Recht auf Arbeit
- 2.2.1. Vereinigungsrecht und Kollektivverhandlungen
- 2.2.2. Zwangsarbeit
- 2.2.3. Diskriminierung
- 2.3. Recht auf angemessenen Wohnraum
- 2.4. Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
- 3. FIFA
- 3.1. Zweck und Ziele der FIFA
- 3.2. FIFA und die Menschenrechte
- 4. Analysebeispiele
- 4.1 Brasilien
- 4.1.1. Zwangsumsiedelungen
- 4.1.2. Einordnung vor dem Hintergrund der Menschenrechte
- 4.1.3. Rolle der FIFA
- 4.1.4. Fazit Brasilien
- 4.2. Katar
- 4.2.1. Kafala-System
- 4.2.2. Verstoß gegen arbeitsvertragliche Regelungen und Gesundheitsschutz
- 4.2.3. Verbot von Kollektivverhandlungen
- 4.2.4. Einordnung vor dem Hintergrund der Menschenrechte
- 4.2.5. Rolle der FIFA
- 4.2.6. Fazit Katar
- 5. Fazit
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der FIFA zu Menschenrechtsverletzungen in den Ausrichtungsländern von Fußball-Weltmeisterschaften. Die Hauptziele sind die Einordnung der relevanten Menschenrechte, die Analyse der Rolle der FIFA als Institution und die Untersuchung von konkreten Beispielen aus Brasilien 2014 und Katar 2022. Die Arbeit vermeidet eine juristische Auseinandersetzung mit der FIFA.
- Menschenrechte und ihre Verletzung im Kontext von Fußball-Weltmeisterschaften
- Die Rolle und Verantwortung der FIFA im Umgang mit Menschenrechten
- Analyse konkreter Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Brasilien und Katar
- Die Ambivalenz zwischen den theoretischen Werten der FIFA und ihrem realen Handeln
- Der Einfluss des wirtschaftlichen und politischen Kontextes auf die Menschenrechtssituation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Ambivalenz des Fußballs zwischen Freude und komplexen ökonomischen, finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen heraus. Sie benennt die Verpflichtungen, die mit der Ausrichtung einer Weltmeisterschaft einhergehen, und hebt die Monopolstellung der FIFA hervor. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Verantwortung der FIFA im Umgang mit Menschenrechten anhand von zwei Beispielen: Brasilien 2014 und Katar 2022.
2. Menschenrechte: Dieses Kapitel definiert Menschenrechte und stellt relevante internationale Menschenrechtsdokumente und -rechte vor, die für die weitere Analyse der Menschenrechtsverletzungen im Kontext der Fußball-Weltmeisterschaften relevant sind. Es betont die Interdependenz der Menschenrechte und legt die Grundlage für die spätere Bewertung der Handlungen der FIFA.
3. FIFA: Kapitel 3 beschreibt die FIFA als Institution, ihren Zweck und ihre Ziele. Es legt den Grundstein für die Analyse der Rolle und Verantwortung der FIFA im Hinblick auf Menschenrechte und schafft die Verbindung zwischen den im vorherigen Kapitel dargestellten Menschenrechten und dem Handeln der FIFA.
4. Analysebeispiele: Dieses Kapitel analysiert Brasilien 2014 und Katar 2022 als Fallstudien. Es untersucht die konkreten Menschenrechtsverletzungen in beiden Ländern, insbesondere in Bezug auf das Recht auf angemessenen Wohnraum in Brasilien und das Recht auf Arbeit in Katar. Die Rolle der FIFA in diesen Kontexten wird kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
FIFA, Menschenrechte, Fußball-Weltmeisterschaft, Brasilien, Katar, Recht auf Arbeit, Recht auf angemessenen Wohnraum, Zwangsarbeit, Kafala-System, Verantwortung, Monopol, Menschenrechtsverletzungen, Internationale Menschenrechtscharta.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Beitrag der FIFA zu Menschenrechtsverletzungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der FIFA zu Menschenrechtsverletzungen in den Ausrichtungsländern von Fußball-Weltmeisterschaften, insbesondere in Brasilien 2014 und Katar 2022. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rolle der FIFA als Institution und der Einordnung relevanter Menschenrechte, ohne juristische Auseinandersetzung mit der FIFA.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Hauptziele sind die Einordnung relevanter Menschenrechte, die Analyse der Rolle der FIFA und die Untersuchung konkreter Beispiele aus Brasilien und Katar. Es wird die Ambivalenz zwischen den theoretischen Werten der FIFA und ihrem realen Handeln beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Menschenrechte und deren Verletzung im Kontext von Fußball-Weltmeisterschaften, die Rolle und Verantwortung der FIFA, konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Brasilien und Katar, den Einfluss des wirtschaftlichen und politischen Kontextes und die Ambivalenz zwischen den theoretischen Werten der FIFA und ihrem realen Handeln.
Welche Menschenrechte werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Recht auf Arbeit (inklusive Vereinigungsrecht, Kollektivverhandlungen, Zwangsarbeit und Diskriminierung) und das Recht auf angemessenen Wohnraum. Die Internationale Menschenrechtscharta dient als Grundlage.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Menschenrechten, ein Kapitel zur FIFA, eine Analyse von Fallbeispielen (Brasilien und Katar) und abschließende Kapitel mit Fazit und Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind enthalten.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Brasilien 2014?
Die Analyse Brasiliens konzentriert sich auf Zwangsumsiedlungen im Kontext der Weltmeisterschaft und deren Einordnung vor dem Hintergrund der Menschenrechte, sowie auf die Rolle der FIFA in diesem Zusammenhang.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse von Katar 2022?
Die Analyse Katars untersucht das Kafala-System, Verstöße gegen arbeitsvertragliche Regelungen und Gesundheitsschutz, das Verbot von Kollektivverhandlungen und die Rolle der FIFA in Bezug auf diese Menschenrechtsverletzungen.
Welche Rolle spielt die FIFA laut der Arbeit?
Die Arbeit analysiert kritisch die Rolle und Verantwortung der FIFA im Umgang mit Menschenrechten in den untersuchten Ländern. Es wird untersucht, wie die FIFA auf die identifizierten Menschenrechtsverletzungen reagiert hat und welche Verantwortung sie trägt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Der Inhalt des Fazits wird im Dokument selbst beschrieben und hier nicht explizit wiederholt, um die Vollständigkeit zu wahren. Siehe Kapitel 5 im Dokument).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: FIFA, Menschenrechte, Fußball-Weltmeisterschaft, Brasilien, Katar, Recht auf Arbeit, Recht auf angemessenen Wohnraum, Zwangsarbeit, Kafala-System, Verantwortung, Monopol, Menschenrechtsverletzungen, Internationale Menschenrechtscharta.
- Quote paper
- William Schmidt (Author), 2021, Der Beitrag der FIFA zu Menschenrechtsverletzungen in den Ausrichtungsländern von Fußball- Weltmeisterschaften an den Beispielen Brasilien 2014 und Katar 2022, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167386