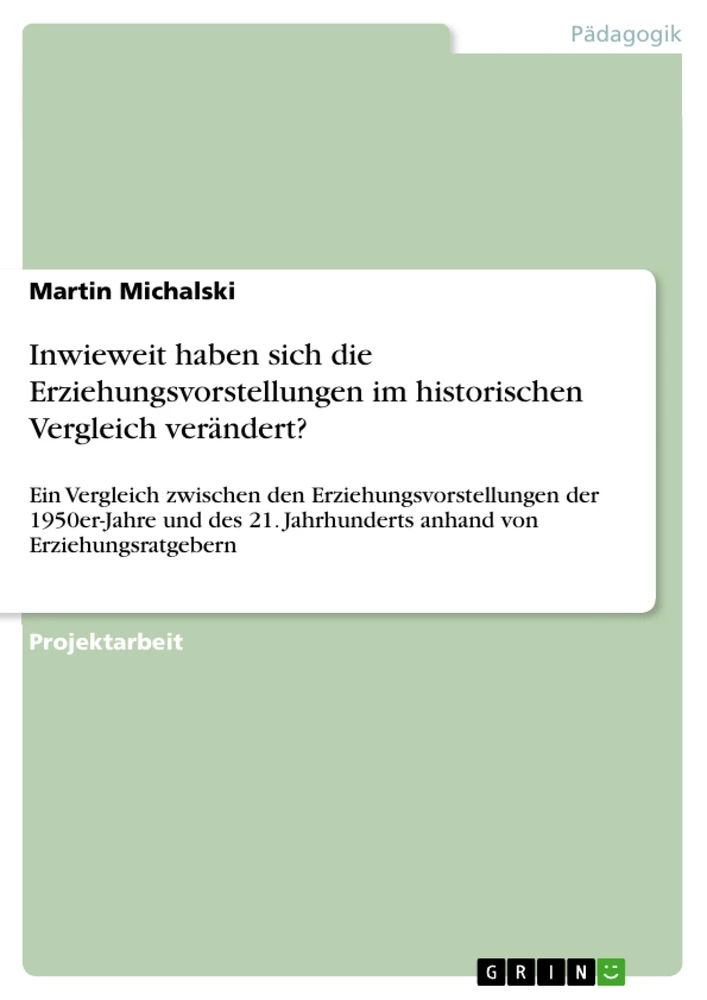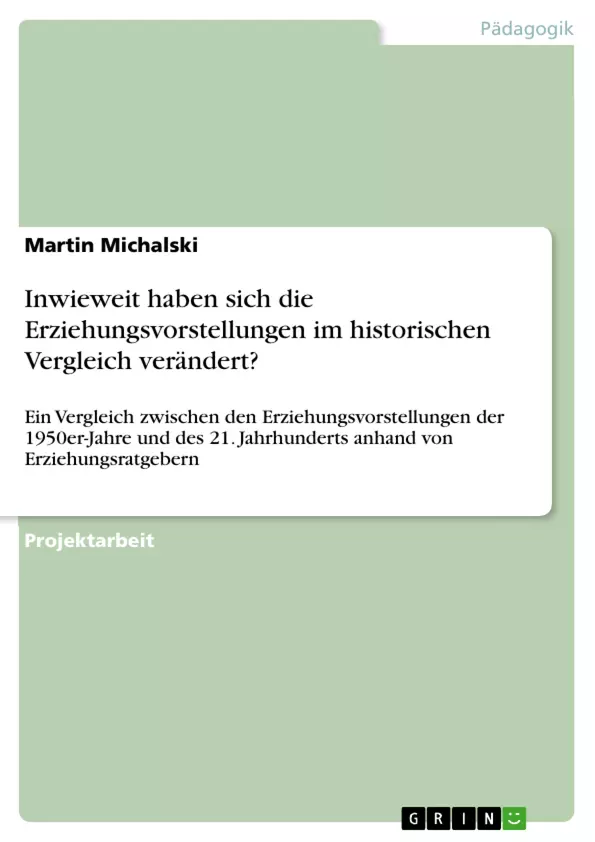Welche Vorstellung von Erziehung werden in den Erziehungsratgebern des 21. Jahrhunderts überhaupt propagiert und inwieweit haben sich diese Erziehungsvorstellungen im historischen Vergleich, und zwar genauer gesagt im Vergleich zu den 1950er-Jahren verändert? Weisen diese beiden Zeitspannen komplett gegensätzliche Vorstellungen von Erziehung auf oder lassen sich doch Gemeinsamkeiten finden?
Um diese Frage beantworten zu können und die möglichen Veränderungen herauszuarbeiten, wird im ersten inhaltlichen Teil dieser Arbeit zunächst der Forschungsstand dargestellt, um zu schauen, welche wissenschaftlichen Ergebnisse und Tendenzen über die Erziehungsratgeberliteratur und die dort enthaltenen Erziehungsvorstellungen bereits erarbeitet wurden. In Anschluss daran wird Wahl des Forschungsgegenstands, also Erziehungsratgeber in Hinsicht auf die Forschungsfrage begründet. Im zweiten inhaltlichen Kapitel wird dann das methodische Vorgehen der Analyse, die in dieser Arbeit durchgeführt wird und darauf abzielt, die Erziehungsvorstellung der jeweiligen Zeiträume zu erarbeiten, erläutert und begründet.
Darauffolgend wird die Auswahl der Erziehungsratgeber, die hier untersucht werden, anhand bestimmter Auswahlkriterien dargelegt. Den Kern der Arbeit bildet dann die Ergebnisdarstellungen, in der die Ergebnisse aus der Analyse der Erziehungsratgeber präsentiert und vor dem Hintergrund des Forschungsstandes diskutiert werden. Bevor die Ergebnisse dann zusammenfassend diskutiert werden, findet im letzten inhaltlichen Teil dieser Arbeit noch einmal ein Praxistransfer statt, in dem anhand der Ergebnisse der Untersuchung mögliche Folgen und Maßnahmen für Professionalisierungsprozesse und für pädagogisches Handeln in der Schule bzw. in der Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 2.1. Erziehungsratgeber als Forschungsgegenstand
- 3. Methodisches Vorgehen
- 3.1. Auswahl der Erziehungsratgeber
- 4. Ergebnisdarstellung
- 4.1. Erziehungsziel
- 4.2. Eltern-Kind-Beziehung
- 4.3. Bestrafung
- 4.4. Erziehungsstil
- 5. Transfer Praxis
- 5.1. Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schüler/-innen
- 5.2. Kindeswohlgefährdung
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen in Erziehungsvorstellungen zwischen den 1950er Jahren und dem 21. Jahrhundert anhand von Erziehungsratgebern. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den propagierten Erziehungszielen, der Eltern-Kind-Beziehung, Bestrafungsmethoden und Erziehungsstilen herauszuarbeiten.
- Vergleichende Analyse von Erziehungsratgebern aus den 1950er Jahren und dem 21. Jahrhundert
- Identifizierung von Veränderungen in Erziehungszielen und -methoden
- Untersuchung der Darstellung der Eltern-Kind-Beziehung in den Ratgebern
- Analyse der Rolle von Bestrafung in unterschiedlichen Erziehungskonzepten
- Übertragung der Forschungsergebnisse auf die Praxis im Bildungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kindererziehung ein und stellt die Forschungsfrage nach den Veränderungen der Erziehungsvorstellungen zwischen den 1950er Jahren und dem 21. Jahrhundert in den Mittelpunkt. Sie beleuchtet die Unsicherheiten von Eltern im Umgang mit der Erziehung in der heutigen Zeit und die Bedeutung von Erziehungsratgebern als Quelle von Ratschlägen. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung.
2. Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zu Erziehungsratgebern. Es zeigt, dass Erziehungsratgeber in der Forschung bisher eine eher vernachlässigte Gattung darstellen und meist nur als historische Quellen herangezogen werden. Es werden relevante Studien vorgestellt, die Erziehungsratgeber als zentralen Forschungsgegenstand behandeln, und die Auswahlkriterien für die eigenen Untersuchungen werden im Kontext der bestehenden Literatur begründet.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Erziehungsratgebern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Veränderungen in Erziehungsvorstellungen zwischen den 1950er Jahren und dem 21. Jahrhundert anhand von Erziehungsratgebern. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Erziehungszielen, der Eltern-Kind-Beziehung, Bestrafungsmethoden und Erziehungsstilen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den propagierten Erziehungszielen, der Eltern-Kind-Beziehung, Bestrafungsmethoden und Erziehungsstilen zwischen den beiden untersuchten Zeiträumen. Sie analysiert die Darstellung der Eltern-Kind-Beziehung, die Rolle von Bestrafung und vergleicht verschiedene Erziehungskonzepte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Methodisches Vorgehen, Ergebnisdarstellung, Transfer Praxis und Zusammenfassung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und Methodik vor. Der Forschungsstand beleuchtet die bisherige Forschung zu Erziehungsratgebern. Die Ergebnisdarstellung präsentiert die Analyseergebnisse zu Erziehungszielen, Eltern-Kind-Beziehung, Bestrafung und Erziehungsstil. Das Kapitel "Transfer Praxis" überträgt die Ergebnisse auf den Bildungsbereich. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Welche Methode wurde verwendet?
Die genaue Methodik der Auswahl und Analyse der Erziehungsratgeber wird im Kapitel "Methodisches Vorgehen" detailliert beschrieben. Die Arbeit vergleicht Erziehungsratgeber aus den 1950er Jahren und dem 21. Jahrhundert, um Veränderungen in Erziehungsvorstellungen aufzuzeigen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisdarstellung (Kapitel 4) präsentiert die Ergebnisse der vergleichenden Analyse von Erziehungsratgebern. Die einzelnen Unterkapitel (4.1-4.4) konzentrieren sich auf Erziehungsziele, Eltern-Kind-Beziehung, Bestrafung und Erziehungsstil. Die Ergebnisse zeigen auf, wie sich diese Aspekte im Laufe der Zeit verändert haben.
Welche praktische Relevanz hat die Arbeit?
Das Kapitel "Transfer Praxis" (Kapitel 5) überträgt die Forschungsergebnisse auf die Praxis im Bildungsbereich. Konkret werden die Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schüler/-innen und Aspekte der Kindeswohlgefährdung beleuchtet.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Auswahl von Erziehungsratgebern aus den 1950er Jahren und dem 21. Jahrhundert. Der Forschungsstand (Kapitel 2) beschreibt die Auswahlkriterien und berücksichtigt die bestehende Literatur zum Thema Erziehungsratgeber.
Welche Forschungslücke wird geschlossen?
Die Arbeit trägt dazu bei, die Forschungslücke zu Erziehungsratgebern zu schließen, da diese in der Forschung bisher eher vernachlässigt wurden und meist nur als historische Quellen betrachtet wurden. Diese Arbeit behandelt Erziehungsratgeber als zentralen Forschungsgegenstand.
- Quote paper
- Martin Michalski (Author), 2021, Inwieweit haben sich die Erziehungsvorstellungen im historischen Vergleich verändert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1168231