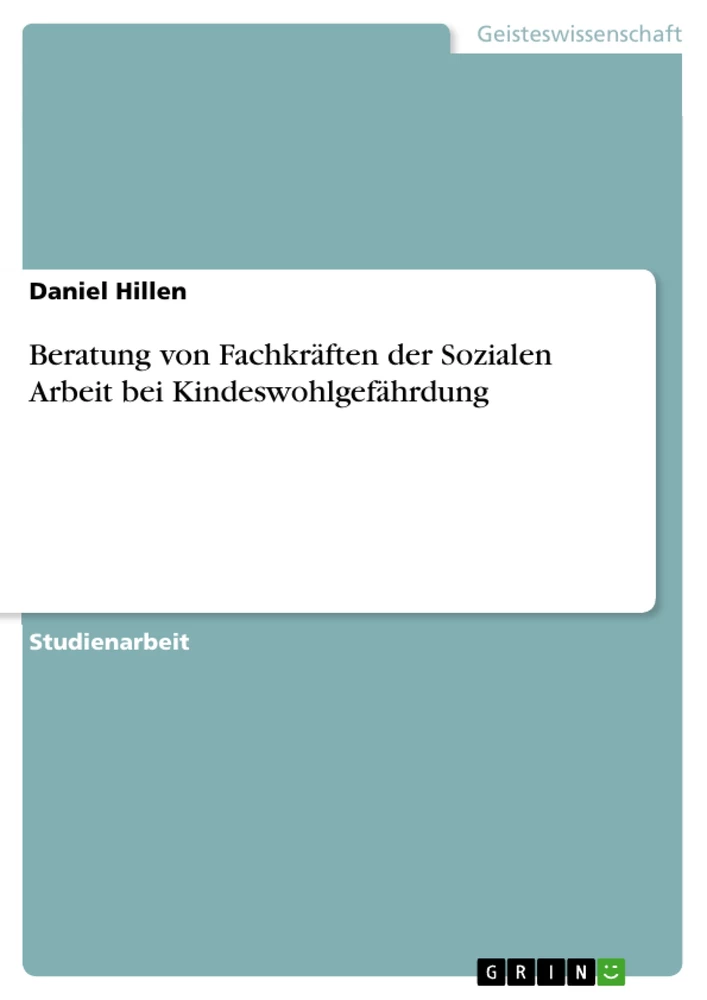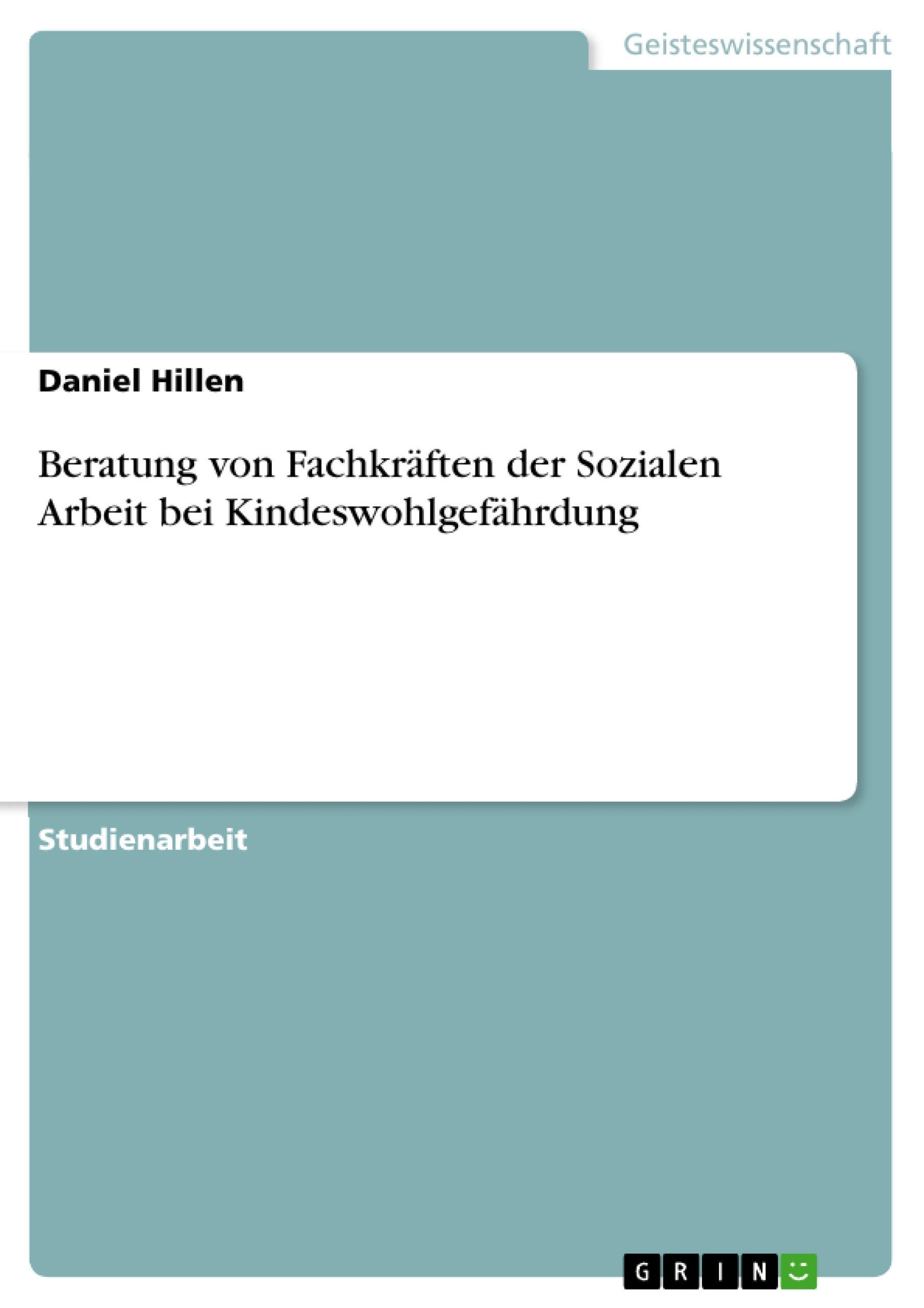In dieser Arbeit wird das Erkennen einer Kindeswohlgefährdung seitens einer Fachkraft der Sozialen Arbeit thematisiert. Dies soll Aufschluss darüber geben, welche Beratungsmöglichkeiten Fachkräfte innerhalb einer sozialpädagogischen Einrichtung und darüber hinaus haben. Aufgrund dessen wird in dieser Ausarbeitung primär die Beratung fokussiert und es wird nicht der Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf das komplexe Thema der Kindeswohlgefährdung erhoben.
Zu Beginn dieser Hausarbeit wird der Begriff des Kindeswohls und die damit verbundenen Rechte und Pflichten der Eltern ebenso wie die des Staates kurz erläutert. Im Anschluss wird der Terminus der Beratung im Kontext für Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung kurz erläutert. Hier soll zunächst geklärt werden, welche Rechte Fachkräfte in Bezug auf Beratung generell haben. Daraufhin wird dargestellt, welche Beratungsansätze in diesem Kontext greifen und wer für die Beratung zuständig ist. Folgend wird veranschaulicht wie eine erste Beratung abläuft. Abschließend wird thematisiert, welche institutionellen Anlaufstellen es für Fachkräfte der Sozialen Arbeit gibt und wie diese zusammenarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtliche Herleitung des Begriffes „Kindeswohl“
- Definition von Beratung im Kontext für Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung
- Ansätze zur Beratung von Fachkräften der Sozialen Arbeit bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
- Institutionelle und Prozessberatende Abläufe bei dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
- Institutionelle Anlaufstellen zur Beratung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Erkennen einer Kindeswohlgefährdung seitens einer Fachkraft der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, Aufschluss darüber zu geben, welche Beratungsmöglichkeiten Fachkräfte innerhalb einer sozialpädagogischen Einrichtung und darüber hinaus haben. Die Arbeit fokussiert sich primär auf die Beratung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf das komplexe Thema der Kindeswohlgefährdung.
- Rechtliche Definition des Kindeswohls und die damit verbundenen Rechte und Pflichten der Eltern sowie des Staates
- Definition von Beratung im Kontext für Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung und die Rechte der Fachkräfte in Bezug auf Beratung
- Vorstellung verschiedener Beratungsansätze in diesem Kontext und die Zuständigkeit für die Beratung
- Veranschaulichung des Ablaufs einer ersten Beratung
- Institutionelle Anlaufstellen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung und deren Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kindeswohlgefährdung ein und beleuchtet die steigenden Fallzahlen sowie die Herausforderungen bei der Definition und Bearbeitung dieses komplexen Themas. Kapitel 2 analysiert die rechtliche Herleitung des Begriffs „Kindeswohl“ und beleuchtet die Rechte und Pflichten der Eltern sowie des Staates in Bezug auf das Kindeswohl. Kapitel 3 definiert den Begriff der Beratung im Kontext für Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beratung.
Kapitel 4 stellt verschiedene Ansätze zur Beratung von Fachkräften der Sozialen Arbeit bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vor. Kapitel 5 beschreibt die institutionellen und prozessberatenden Abläufe bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Kapitel 6 widmet sich den institutionellen Anlaufstellen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung und deren Zusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Kindeswohlgefährdung, Beratung, Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Rechtliche Rahmenbedingungen, Elternrechte, staatliche Intervention, Beratungsansätze, institutionelle Anlaufstellen, Zusammenarbeit, Kindeswohl, Schutz des Kindes.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Beratung bei Kindeswohlgefährdung?
Ziel ist es, Fachkräfte der Sozialen Arbeit beim Erkennen von Gefährdungslagen zu unterstützen und ihnen Handlungssicherheit durch fachliche Beratung zu geben.
Welche Rechte haben Fachkräfte in Bezug auf Beratung?
Fachkräfte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung durch insoweit erfahrene Fachkräfte (IseF), um das Risiko einer Gefährdung professionell einzuschätzen.
Wie läuft eine erste Beratung bei Verdacht auf Gefährdung ab?
In der Regel werden die Beobachtungen anonymisiert besprochen, Risikofaktoren analysiert und die nächsten Schritte zur Sicherstellung des Kindeswohls geplant.
Welche institutionellen Anlaufstellen gibt es?
Neben internen Fachkräften in Einrichtungen stehen das Jugendamt, Erziehungsberatungsstellen und spezielle Kinderschutz-Zentren als Partner zur Verfügung.
Was sind die Pflichten des Staates beim Kindeswohl?
Der Staat hat ein Wächteramt. Wenn Eltern ihrer Fürsorgepflicht nicht nachkommen können oder wollen, muss der Staat intervenieren, um das Kind zu schützen.
- Citation du texte
- Daniel Hillen (Auteur), 2019, Beratung von Fachkräften der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169098