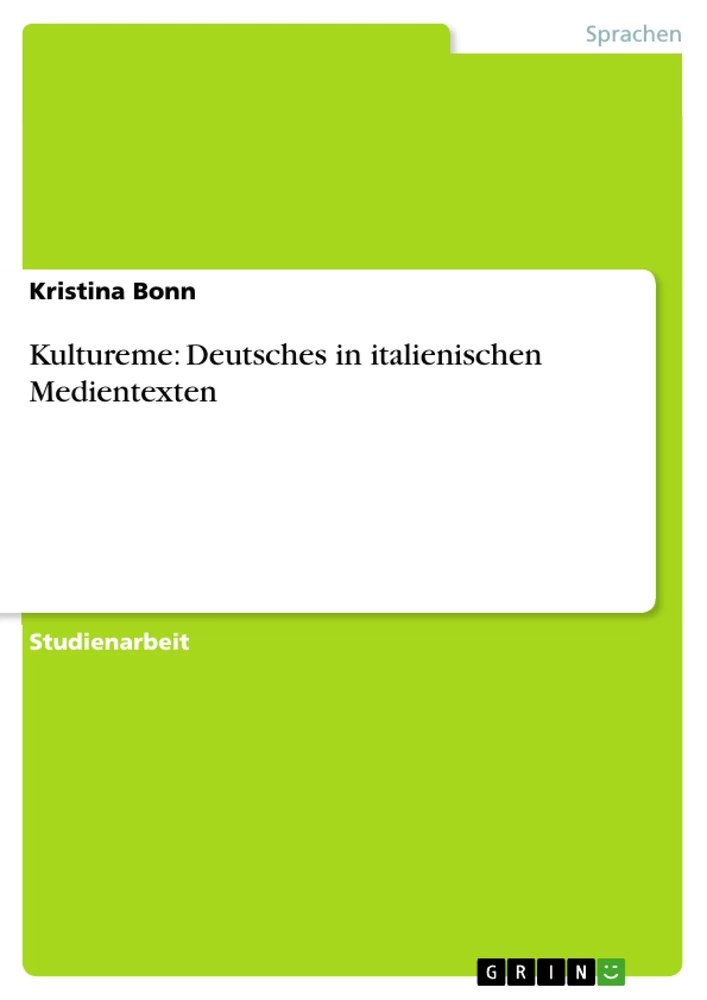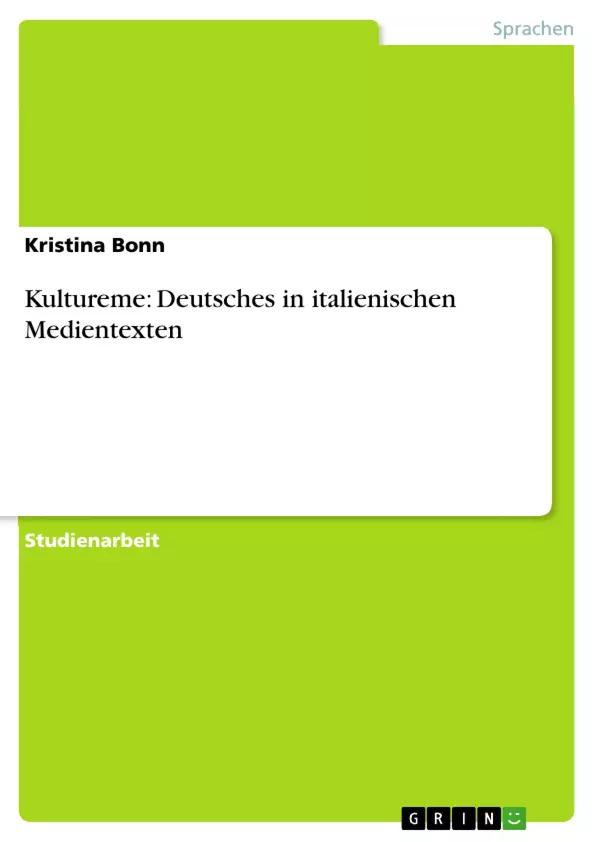Seit einigen Jahrzehnten rückt die Weltbevölkerung immer näher zusammen. Telefone,
Mobiltelefone, Internet und Flugverkehr ermöglichen internationale Beziehungen
und eine schnelle, weltweite Kommunikation. Dieser Trend zeigt sich auch in
der Entwicklung der einzelnen Sprachen: Einerseits strebt man sowohl in den Wissenschaften
als auch in Wirtschaft und Technik nach einem fachspezifischen, internationalen
Wortschatz, andererseits werden durch den engen Kontakt der Sprachen
fremdsprachliche Wörter übernommen oder entlehnt. Entgegen dieser Entwicklung
gibt es bestimmte Lexeme, die man als ‚nationalen Wortschatz’ bezeichnen könnte,
einen kultur- und landesspezifischen Wortschatz, der von Geschichte und Tradition
eines Landes bestimmt ist. Dieser kulturspezifische Wortschatz bereitet Übersetzern
große Schwierigkeiten und Mühen. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, die
Kulturspezifika zu definieren und für diese verschiedene
Übersetzungsmöglichkeiten darzustellen und ihre Funktionen und
Verwendungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Ausgehend vom Titel dieser Arbeit Kultureme: Deutsches in italienischen Medientexten
werden zunächst der Pressetext, seine Merkmale und sein
Kommunikationsmodell genauer analysiert. Anschließend ist dargestellt, was in der
Übersetzungswissenschaft unter den Begriffen Kulturspezifik und kulturellen
Unterschieden verstanden wird. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich diese auf
Text- und lexikalischer Ebene wiederfindet. Auf lexikalischer Ebene ist der Begriff
des Kulturems Gegenstand der Analyse und die durch Kulturspezifik entstehenden
Übersetzungsprobleme werden aufgezeigt.
Dieser Arbeit liegt eine mehrmonatige Untersuchung verschiedener italienischer
Printmedien zugrunde. Bei der Zusammenstellung des Korpusmaterials war es von
besonderer Bedeutung, ein möglichst breites und repräsentatives Spektrum an
Printmedien auf Kultureme zu untersuchen. Daher waren vier verschiedene Tageszeitungen,
il Messaggero, la Repubblica, la Stampa und der Corriere della Sera,
neben der Wochenzeitung l’ Espresso, der wöchentlich erscheinenden Frauenzeitschrift
Donna, dem Monatsreisejournal Meridiani und der monatlich erscheinenden
militärischen Fachzeitschrift Rivista Italiana Difesa Gegenstand der Korpusanalyse.
Auch die untersuchten Artikel sollten möglichst über verschiedene landesspezifische,
geographische, institutionelle, politische oder soziale Sachverhalte oder
Ereignisse der Bundesrepublik Deutschland berichten. [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Pressetext
2.1 Allgemeine Merkmale
2.2 Bedeutung für die Übersetzungswissenschaft
2.3 Das Kommunikationsmodell eines über ausländische Themen berichtenden Presseartikels
3 Kulturspezifik und kulturelle Unterschiede
3.1.1 Unterscheidung der Kulturspezifika
3.2 Kulturabhängigkeit von Texten
3.3 Kulturabhängigkeit auf lexikalischer Ebene
3.3.1 Definition und Abgrenzung des Begriffs Kulturem
3.3.2 Übersetzungsschwierigkeiten durch Kultureme
3.3.3 Übersetzungsverfahren für Kultureme
4 Korpusanalyse
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
6.1 Quellen und im Korpus verzeichnete Siglen
6.2 Internetadressen
6.3 Lexika
6.4 Fachliteratur
1 Einleitung
Seit einigen Jahrzehnten rückt die Weltbevölkerung immer näher zusammen. Telefone, Mobiltelefone, Internet und Flugverkehr ermöglichen internationale Beziehungen und eine schnelle, weltweite Kommunikation. Dieser Trend zeigt sich auch in der Entwicklung der einzelnen Sprachen: Einerseits strebt man sowohl in den Wissenschaften als auch in Wirtschaft und Technik nach einem fachspezifischen, internationalen Wortschatz, andererseits werden durch den engen Kontakt der Sprachen fremdsprachliche Wörter übernommen oder entlehnt. Entgegen dieser Entwicklung gibt es bestimmte Lexeme, die man als ‚nationalen Wortschatz’ bezeichnen könnte, einen kultur- und landesspezifischen Wortschatz, der von Geschichte und Tradition eines Landes bestimmt ist. Dieser kulturspezifische Wortschatz bereitet Übersetzern große Schwierigkeiten und Mühen. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, die Kulturspezifika zu definieren und für diese verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten darzustellen und ihre Funktionen und Verwendungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Ausgehend vom Titel dieser Arbeit Kultureme: Deutsches in italienischen Medientexten werden zunächst der Pressetext, seine Merkmale und sein Kommunikationsmodell genauer analysiert. Anschließend ist dargestellt, was in der Übersetzungswissenschaft unter den Begriffen Kulturspezifik und kulturellen Unterschieden verstanden wird. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich diese auf Text- und lexikalischer Ebene wiederfindet. Auf lexikalischer Ebene ist der Begriff des Kulturems Gegenstand der Analyse und die durch Kulturspezifik entstehenden Übersetzungsprobleme werden aufgezeigt.
Dieser Arbeit liegt eine mehrmonatige Untersuchung verschiedener italienischer Printmedien zugrunde. Bei der Zusammenstellung des Korpusmaterials war es von besonderer Bedeutung, ein möglichst breites und repräsentatives Spektrum an Printmedien auf Kultureme zu untersuchen. Daher waren vier verschiedene Tageszeitungen, il Messaggero, la Repubblica, la Stampa und der Corriere della Sera, neben der Wochenzeitung l’ Espresso, der wöchentlich erscheinenden Frauenzeitschrift Donna, dem Monatsreisejournal Meridiani und der monatlich erscheinenden militärischen Fachzeitschrift Rivista Italiana Difesa Gegenstand der Korpusanalyse. Auch die untersuchten Artikel sollten möglichst über verschiedene landesspezifische, geographische, institutionelle, politische oder soziale Sachverhalte oder Ereignisse der Bundesrepublik Deutschland berichten.
Das Korpus ist nach verschiedenen Kriterien gegliedert: Erstens sind die Kultureme in einer Primärtafel nach Datum und Zeitschrift sortiert aufgelistet und anschließend nummeriert, und zweitens sind sie nach ihrer formalen Gestalt sortiert.
2 Der Pressetext
2.1 Allgemeine Merkmale
Der Zeitungstext ist meist ein gemeinsprachlicher Text mit Elementen aus politischen, wirtschaftlichen oder anderen Fachsprachen. Seine Hauptfunktion besteht in der Übermittlung von Nachrichten in stilistisch wertfreier und kritikloser Weise (Lüger 1983:66). Ein Pressetext dient jedoch nicht nur dazu, seine Leser zu informieren, sondern er kann auch anderen publizistischen Funktionen dienen, wie beispielsweise der Meinungsbildung oder der Unterhaltung. Analog zu diesen unterschiedlichen publizistischen Funktionen variiert auch die Darstellungsform der Zeitungsartikel, die entweder tatsachenbetont, meinungsbetont oder phantasiebetont orientiert sein kann (Lüger 1983:18). Stilistisch zeichnen sich Pressetexte durch kurze Einfachsätze (Lüger 1983:23), Abnahme der hypotaktischen Satzformen (Lüger 1983:25) und Nominalstil (Lüger 1983:25,26) aus. Unter Nominalstil versteht Lüger (1983:26), dass durch die Aneinanderreihung vieler Nomen Satzgefüge wie beispielsweise Temporalsatz-Hauptsatz auf einen Einfachsatz verkürzt werden und deren Information komprimiert wird.
2.2 Bedeutung für die Übersetzungswissenschaft
Lüger zufolge spiegelt die Sprache in Pressetexten den „Sprachzustand ihrer Zeit“ (Lüger 1983:22)[1] und kann deshalb besonders gut als Grundlage für allgemeinere synchrone und diachrone Sprachbeschreibungen genutzt werden. Überträgt man diese Feststellung auf eine Untersuchung von Pressetexten, kann diese demnach Aufschluss darüber geben, inwiefern deutsche Kulturspezifika in der italienischen Gemeinsprache vorhanden sind, in welcher sprachlichen Form sie anzutreffen sind und Kulturspezifika aus welchen Themenbereichen als bekannt und welche als unbekannt vorauszusetzen sind. Das bedeutet wiederum, dass Schwierigkeiten der Übersetzung von kulturspezifischen Elementen durch eine Untersuchung von Pressetexten gemindert werden könnten. Die Medientextanalyse könnte die Rolle einer Voruntersuchung einnehmen, die über den Bekanntheitsgrad von kulturspezifischen Elementen eines Landes in dem Sprachgebrauch eines anderen Landes informiert. Eine solche Analyse von Medientexten könnte dem Übersetzer eine Arbeitserleichterung und Entscheidungshilfe bei der schwierigen Frage der Übersetzung von Kulturspezifika sein.
Henschelmann (1980:31,32) warnt jedoch davor, das Sprachverhalten der Tagespresse im Bezug auf moderne kulturspezifische Elemente unreflektiert nachzuahmen, da journalistisches Arbeiten oftmals unter Zeitdruck und daher selten sorgfältig erfolgt. Diese Warnung scheint berechtigt, denn Journalisten sind keine Übersetzer, haben also nicht notwendigerweise Fremdsprache- und Landeskundeunterricht genossen. Das Korpus bestätigt mehrfach, wie fehlerhaft und unsauber Journalisten mit Übersetzungsaufgaben umgehen. In der Ausgabe vom 26.06.2001 der Wochenzeitung il Secolo wurde die Junge Union, die politische Jugendorganisation der CDU, als cuotidiano [186][2], also Tageszeitung bezeichnet , in der Ausgabe von März 1998 des Meridiani definierte man das deutsche Lexem „Diele“ [252] als „il magazzino per i carri e gli attrezzi“, als Aufbewahrungsort für Wagen und Werkzeuge. Sowohl im Corriere della Sera [77] als auch im Messaggero [5] vom 06.07.2001 bezeichnet man Hannelore Kohl in Analogie zum Begriff „First Lady“ als „erste Frau“ Deutschlands. Die Presse suggeriert fälschlicherweise, dass es sich um eine konventionelle, deutsche Bezeichnung für die Ehepartnerin des Bundeskanzlers handelt.
2.3 Das Kommunikationsmodell eines über ausländische Themen berichtenden Presseartikels
Grundsätzlich unterscheidet sich die Kommunikationssituation eines Pressetextes von Kollers (2001:106) zweisprachigem Kommunikationsmodell, in dem der Übersetzer die Funktion des Empfängers und des Senders zugleich übernimmt. Basierend auf Bühlers Organonmodell der Sprache (1934:28) und analog zu Kollers zweisprachigem Kommunikationsmodell (2001:106) wird im Folgenden ein Kommunikationsmodell für den Pressetext erstellt, das um eine Ebene der Kulturzugehörigkeit erweitert ist. Die drei Fundamente des Modells, also Sender, Text, Empfänger sind jeweils einer Kultur und Sprachgemeinschaft zugeordnet, so dass deutlich wird, wo und wie sich die Kulturspezifik niederschlägt. Ein Presseartikel jedweden Themenbereichs stellt eine einsprachige Kommunikationssituation da.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Sender kommuniziert über das Medium eines Zeitungsartikels mit dem Empfänger. Das Besondere dieses Modells ist, dass der Sender, der Journalist, und der Empfänger, der Zeitungsleser, grundsätzlich der selben Kultur- und Sprachgemeinschaft angehören. Der Zeitungsartikel ist ein übliches Kommunikationsmedium derselben Sprachgemeinschaft. Nur die Inhalte, über die der Journalist seine Leser zu berichten anstrebt, sind unmittelbar mit der fremden Kultur verbunden. Er informiert sie beispielsweise über Ereignisse aus den unterschiedlichsten inhaltlichen Bereichen eines fremden Landes, wie dies zumeist in Tageszeitungen oder Wochenzeitungen geschieht, oder er stellt das Land, seine traditionellen und geographischen Besonderheiten vor, wie dies eher in Reisezeitschriften oder im Kulturteil der Tageszeitungen möglich ist. Sachliche Informationen und Fakten über das fremde Land werden vom Sender im Text umgesetzt und werden als kulturspezifische Elemente des fremden Landes markiert.
Aus diesen Feststellungen ergeben sich wichtige Schlussfolgerungen für die Kompetenzen des Journalisten:
1. Zunächst muss der Journalist die Kulturspezifik als solche erkennen und verstehen.
2. Darüber hinaus benötigt er eine tiefe Kenntnis der fremden Sprache und der fremden Kultur.
3. Da ein Journalist seine Informationen nicht immer persönlich notiert, sondern von einer zentralen Nachrichtenagentur erhält, in Deutschland von der DPA und in Italien von der Ansa, sollte er durch seine eigenen Kenntnisse die Möglichkeit haben, die Informationen seiner Quelle zu überprüfen.
Diese Kompetenzen sind als besonders wichtig zu erachten, da er ebenfalls durch das Verfassen eines Textes über eine fremde Kulturgemeinschaft, wie der Übersetzer durch die Translation eines fremdsprachlichen Textes zu einem „Kulturmittler“ (Vermeer 1994:31) wird. Das Modell des Pressetextes lässt sich anschließend wieder auf das zweisprachige Kommunikationsmodell einer Übersetzung zurückführen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus diesem Modell wird deutlich, dass die Kulturspezifik schon als Bestandteil des AS-Textes in den ausgangssprachlichen Text eingeht und der Übersetzer sowohl mit der Ausgangskultur als auch mit der Zielkultur gleichermaßen vertraut sein sollte. Die Translation wird zum Übertragen eines Textes in eine andere Sprache unter Berücksichtigung kultureller Bedingungen. Sie fungiert somit als „transkultureller Transfer“ (Vermeer 1994:33), da der Text als Element der Ausgangssprache und -kultur zum Element der Zielsprache wird, beziehungsweise der Zielkultur. Das Translat ist das Produkt dieser kulturabhängigen Übersetzung. Im Unterschied zum Modell des Pressetextes müssen die kulturspezifischen Elemente nicht unbedingt als Elemente der Ausgangskultur markiert werden. Sie können auch durch zielkulturelle Elemente ersetzt werden[3]. Dieser Sachverhalt wird im Modell durch den rosafarbenen und grünen Kreis im Feld des zielsprachlichen Textes verdeutlicht.
3 Kulturspezifik und kulturelle Unterschiede
Da sowohl der Begriff Kulturspezifika, als auch der Begriff Kulturem das Lexem Kultur beinhaltet, müsste zunächst einmal definiert werden, was unter Kultur zu verstehen ist. Die übersetzungswissenschaftliche Literatur bezieht sich mehrfach, beispielsweise Vermeer (1986:178), Reiß/Vermeer (1984:26) Stolze (1992:205), auf Göhrings Kulturdefinition:
„Kultur ist all das, was man wissen, beherrschen und empfinden können muß, um beurteilen zu können, wo sich Einheimische in ihren verschiedenen Rollen erwartungskonform oder abweichend verhalten, um sich selbst in der betreffenden Gesellschaft erwartungskonform verhalten zu können, sofern man dies will und nicht etwa bereit ist, die jeweils aus erwartungswidrigem Verhalten entstehenden Konsequenzen zu tragen“.
Die Wertung Stolzes (1992:205), dass es sich um eine „brauchbare“ Definition handele, ist fraglich, da sie nur vorsichtig einen groben Rahmen absteckt, aber keine Inhalte benennt, die eine Kultur ausmachen. Darüber hinaus sind auch die Termini Einheimische, erwartungskonform und abweichend sehr ungenau, werfen einige Fragen auf und müssten zunächst einmal operationalisiert werden. Wird unter dem Terminus Einheimische die Bevölkerung eines Landes, die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft oder gar einer Kulturgemeinschaft verstanden? Verlaufen Kulturgrenzen entlang Landesgrenzen? Zu wessen Erwartungen soll man sich konform verhalten und wo ist festgelegt, was als konformes Verhalten betrachtet wird und was nicht? All diese Fragen zeigen, wie schwierig es ist, eine umfassende Definition für den Begriff Kultur zu finden. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle nicht weiter auf die Diskussion des Kulturbegriffes eingegangen werden.
Für die folgende Untersuchung wird kultureller Unterschied als eine traditionelle, geographische, politische, institutionelle, historische, soziale, rechtliche und eine das menschliche Verhalten betreffende Andersartigkeit zweier Ländern, insbesondere Italiens und Deutschlands, definiert.
Innerhalb der Sprache manifestiert sich Kulturspezifik auf ganz unterschiedliche Weise und führt zu Übersetzungsschwierigkeiten. Schon auf phonologischer Ebene kann Kulturspezifik zu Schwierigkeiten führen, da jede Sprache ein eigenes sprachspezifisches Phoneminventar aufweist [93]. Im Bereich der Pragmatik, in dem Sprache als Handlung untersucht wird, manifestiert sich Kulturspezifik in unterschiedlichen Sprechakten. Routineformeln wie Gruß- und Verabschiedungs-, Entschuldigungs- und Vorstellungsformeln, was sich an der chinesischen Begrüßungsformel „Wohin gehen sie?“ veranschaulichen lässt, sind kulturabhängig.
Auf semantischer Ebene kann Kulturspezifik sowohl das Denotat betreffen, das durch ein Zeichen bezeichnete Objekt der Wirklichkeit, als auch das Konnotat, die kulturspezifische Bedeutungskomponente, die die Grundbedeutung eines Ausdrucks überlagert (Bußmann 1990:410). Betracht man das sprachliche Zeichen in der von Saussure formulierten Zweiseitigkeit, so können sowohl Signifiant, der Lautkörper, als auch Signifié, das Konzept des Inhaltes kulturabhängig sein. Im Folgenden soll jedoch nur auf die Textebene und die lexikalische Ebene eingegangen werden, weil sich dort die gravierendsten Probleme bei einem Translat entwickeln können.
3.1.1 Unterscheidung der Kulturspezifika
Stolze (1992:207) geht davon aus, dass ein Übersetzer auf „kulturelle Inkongruenzen“ in seinen Texten zu reagieren habe. Vermeer (1986, 1986a) hat auf die Bedeutung kultureller Unterschiede aufmerksam gemacht, und seither hat man diese in der Übersetzungswissenschaft immer wieder aufgegriffen. Stolze versucht, die kulturellen Unterschiede genauer voneinander abzugrenzen. Er unterscheidet reale Inkongruenzen, wenn Realia aus einer Kultur in der anderen nicht bekannt sind, formale Inkongruenzen, wenn Texte zwar als solche in der Zielkultur bekannt sind, aber üblicherweise in anderer sprachlicher Gestalt vorliegen. Zuletzt nennt er semantische Inkongruenzen und versteht darunter Wörter mit kulturspezifische Konnotationen, die in der Übersetzung zu abweichendem oder unerwünschtem Verständnis führen. Diese Einteilung bereitet Schwierigkeiten, weil Text- und Wortebene miteinander vermischt werden. Hansen (1996:68) versteht, sich ebenfalls auf Stolze beziehend, die formalen Inkongruenzen als Kulturspezifika des AT, die zwar in der Zielkultur vorhanden sind, jedoch eine andere sprachliche Gestalt besitzen. Als Beispiel führt sie den Eigennamen Chruschtschow (Hansen 1996:71) an, der in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich geschrieben werde. Worauf Stolze zusätzlich aufmerksam macht, ist die Notwendigkeit des Wissens über den Bekanntheitsgrad der Kulturspezifika.
3.2 Kulturabhängigkeit von Texten
Grundsätzlich sind Texte nach den Sprachfunktionen Darstellung, Ausdruck und Appell zu unterscheiden (Reiß 1983:18). Jeder Sprachfunktion kann ein Texttyp zugeordnet werden: der darstellenden Funktion der inhaltsbetonte, informative Texttyp, dem Ausdruck der formbetonte, expressive und der Appellfunktion der verhaltensorientierte, operative Texttyp. Jedem Texttyp lässt sich wiederum eine bestimmte Textsorte zuordnen: dem informativen Texttyp beispielsweise die Textsorten Bericht, Gebrauchsanweisung, Sachbuch, dem formbetonten Text beispielsweise die Textsorten Roman, Lyrik, Schauspiel und dem appellbetonten Texttyp beispielsweise die Textsorten Reklame oder Propaganda (Reiß 1983:18).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
D Durch den Texttyp sind die Übersetzungsmethode und die Rangfolge des in der Zielssprache zu Bewahrenden festgelegt: Für den informativen Text bedarf es der Invarianz auf der Inhaltsebene, für den expressiven Texttyp der Invarianz der künstlerischen Gestaltung und der appellbetonte Text fordert die Identität des textimmanenten Appells (Reiß 1983:18).
Henschelmann (1980:29) unterscheidet nicht Texttypen, sondern Thematiktypen nach ihrer Gerichtetheit in bezug auf den AS- und/oder ZS-Kulturkontext. Sie beschreibt die verschiedenen Relationen, die zwischen einem Text in Abhängigkeit von seiner „Thematik“ und einer jeweiligen Kultur bestehen können. Sie unterscheidet vier Thematiken in Texten (vgl. Henschelmann 1980:29,30):
(1) Texte, die sich mit „internationaler Thematik“ beschäftigen: Solche Gegenstände und Sachverhalte begründen räumlich mehr oder weniger umfassende (übernationale) Kommunikationsgemeinschaften, an denen AS-und ZS- Empfänger teilhaben, sei es aktiv, aus dem Bedürfnis nach kommunikativem Kontakt (z.B. als Fachleute oder Lernende auf dem Gebiet der Atomphysik), sei es passiv, aufgrund der Lebensumstände (z.B. als Mitglieder hochentwickelter Industrieländer, einer Gesellschaft mit westlichem Lebensstil).
(2) Texte, die sich mit landesspezifischen Gegenständen befassen, d.h. mit geographischen, institutionellen, sozialen usw. Sachverhalten der AS-Empfänger.
(3) Texte, die sich mit Themen aus dem ZS-Kulturkontext befassen (z.B. ein französischer Originaltext, der das parlamentarische System der Bundesrepublik darstellt).
(4) Texte, die sich mit Themen befassen, die ein Land betreffen, das weder zum AS- noch zum ZS-Kulturkontext gehört.
Fraglich ist jedoch, ob ihre Unterscheidung sich nicht ausschließlich auf informative, inhaltsbetonte Texte bezieht, da in formbetonten, fiktiven Texten solche Thematiken selten so eindeutig vorzufinden sind. In ihnen schlägt sich Kulturspezifik in starkem Maße auch indirekt nieder. Wird der Einzelne zum Produzenten eines Textes, so schlägt sich in diesem Text, in den fiktiven Welten, Figuren und Handlungen, dessen Kultur nieder (vgl. Vermeer 1994:34).
Kulturspezifik kann sich in einem formbetonten Text aber auch direkt niederschlagen, nämlich in der Textsorte. Sie kann an einen spezifischen Kulturkontext gebunden sein, wie Inhoffen (1991:30) an der Textsorte des japanischen bunraku -Theaters verdeutlicht. Dieses bunraku -Theater ist eine Art Puppentheater für Erwachsene. Es gilt in Japan als anspruchsvolle literarische Gattung. Einem europäischen Leser dürfte die Textsorte unbekannt sein.
[...]
[1] Er bezieht sich auf Eggers, H. (1977): Deutsche Sprachgeschichte, Bd. IV, Reinbek.
[2] Im Folgenden markiert die eckige Klammer mit Nummerierung, dass das Beispiel aus dem anhängenden Korpus stammt und gibt an, wo es dort nachzuschlagen ist.
[3] Vgl. unter Punkt 3.2. Kollers adaptierende und transferierende Übersetzungsmethode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Kulturem?
Ein Kulturem ist ein Lexem des nationalen Wortschatzes, das tief in der Geschichte und Tradition eines Landes verwurzelt ist und oft schwer zu übersetzen ist.
Warum bereiten Kulturspezifika Übersetzern Schwierigkeiten?
Da sie landesspezifische Sachverhalte (politisch, sozial, institutionell) beschreiben, für die es in der Zielsprache oft keine direkte Entsprechung gibt.
Welche italienischen Medien wurden untersucht?
Die Korpusanalyse umfasst Tageszeitungen wie „il Messaggero“ und „Corriere della Sera“ sowie Magazine wie „l’Espresso“ und „Donna“.
Wie gehen italienische Journalisten mit deutschen Begriffen um?
Die Arbeit zeigt auf, dass Journalisten oft unter Zeitdruck unsauber übersetzen, z.B. wenn die „Junge Union“ fälschlicherweise als Tageszeitung bezeichnet wird.
Welche Übersetzungsverfahren werden für Kultureme genutzt?
Es werden verschiedene Verfahren wie Entlehnung, Umschreibung oder die Suche nach funktionalen Äquivalenten diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Kristina Bonn (Autor:in), 2002, Kultureme: Deutsches in italienischen Medientexten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116981