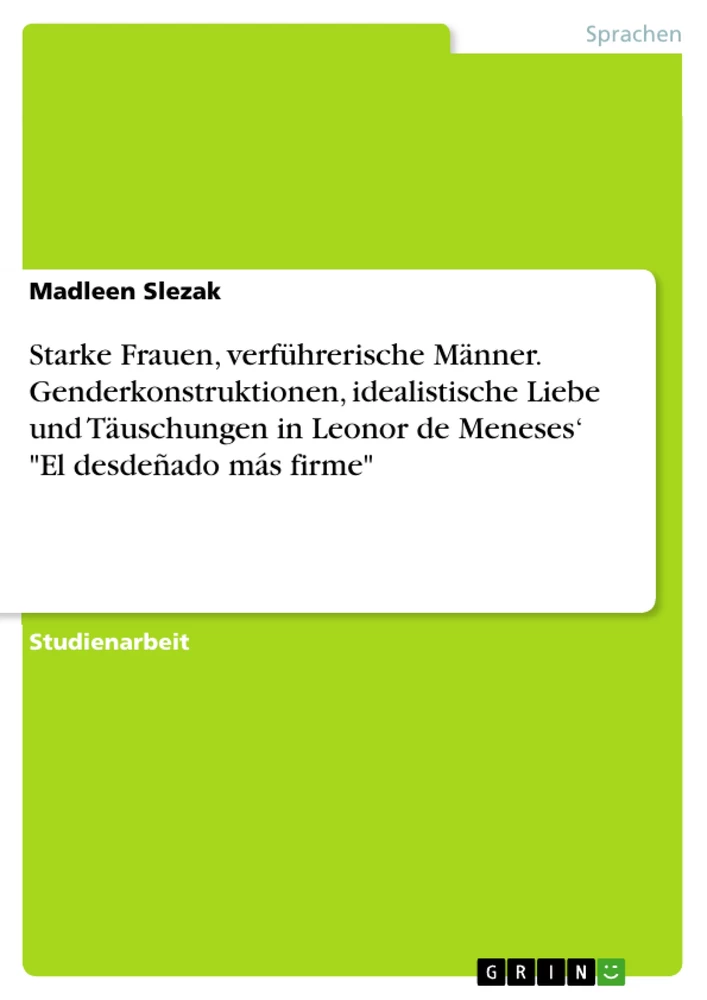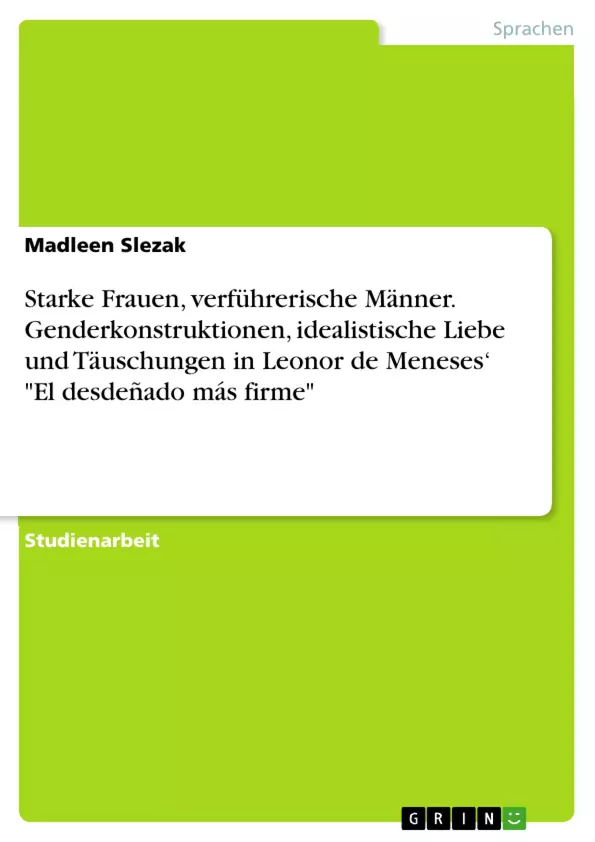Der Gegenstand der vorliegenden Hausarbeit ist die Geschlechterkonstruktion in der Novelle El desdeñado más firme von Leonor de Meneses. Der Kurzroman wurde aus dem Zeitalter des Siglo de Oro heraus verfasst und steht in dessen soziokulturellen Kontext. Deutlich wird dies anhand eines Geschlechterdiskurses. Die Geschlechter sind in den festgefahrenen Verhaltensnormen einer höfischen Gesellschaft gefangen und verfolgen oftmals das neuplatonische Liebeskonzept und den Ehrenkodex der „natürlichen Ordnung“. Meneses schlüsselt spielerisch die idealistische Vorstellung auf und verleiht den Figuren auf eine charmante Art einen eigenen Willen, eine eigene Meinung und einen individuellen Charakter. Die spielerische Entfaltung kommt deutlich bei den Hauptfiguren Lisis de Toledo und Don César zum Vorschein. Die beiden Figuren und Lisis de Madrid stehen im Mittelpunkt der Hausarbeit. Sie werden den drei Galanen Don Felipe, Don Luis und dem Marqués gegenübergestellt, die den Kontrast zu den anderen Charakteren bilden.
Im ersten Teil konzentriert sich die Hausarbeit auf die Entfaltung der Literatur im goldenen Zeitalter. Weiter wird die patriarchalische Struktur und die Liebesphilosophie thematisiert und das stilistische Mittel der Schein-Sein-Antithetik herausgestellt. Im zweiten Teil wird die Theorie aus dem ersten Teil anhand der Novelle El desdeñado más firme untersucht. Hier wird das Verhalten einzelner Figuren analysiert und gegenübergestellt. Weiter wird die Frage nach der Verwendung des stilistischen Mittels des „engaño“ und „desengaño“ revidiert und eine Schlussbetrachtung erstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Goldene Zeitalter
- Entfaltung der Literatur, der Sprache und des Theaters
- Gesellschaftsstrukturen und Liebesphilosophie
- Die „,engaño-desengaño“-Thematik in Spanien
- El desdeñado más firme
- Aufbau und Inhalt des Kurzromans
- Strukturalistische Lesart der Diskussionspunkte
- Genderkonstruktionen und idealistische Liebeskonzeption
- Täuschung als stilistisches Mittel
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Geschlechterkonstruktion in Leonor de Meneses' Novelle „El desdeñado más firme“. Sie analysiert den Kurzroman im Kontext des spanischen Siglo de Oro, der von festgefahrenen Geschlechterrollen und dem neuplatonischen Liebeskonzept geprägt war. Die Arbeit untersucht, wie Meneses diese Konzepte auf spielerische Weise dekonstruiert und den Figuren eine eigene Willenskraft, Meinung und Persönlichkeit verleiht.
- Geschlechterkonstruktionen im spanischen Barock
- Die Rolle des neuplatonischen Liebeskonzepts in der Literatur
- Die Darstellung von Täuschung als stilistisches Mittel
- Die Analyse der Figuren Lisis de Toledo, Don César, Don Felipe, Don Luis und dem Marqués
- Die Interpretation des „engaño“ und „desengaño“ in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Fragestellung und den Fokus der Hausarbeit dar. Es wird erläutert, dass die Arbeit die Geschlechterkonstruktion in Leonor de Meneses' Novelle „El desdeñado más firme“ im Kontext des spanischen Siglo de Oro untersucht. Besonders die Figuren Lisis de Toledo, Don César und Lisis de Madrid stehen im Mittelpunkt der Analyse, die sie den drei Galanen Don Felipe, Don Luis und dem Marqués gegenüberstellt. Die Hausarbeit gliedert sich in zwei Teile, die sich mit dem kulturellen Umfeld des Siglo de Oro und der Analyse der Novelle befassen.
- Das Goldene Zeitalter: Dieser Abschnitt befasst sich mit der kulturellen Blütezeit des spanischen Siglo de Oro, geprägt von politischer Macht und einem reichen kulturellen Reichtum. Er beschreibt die Entwicklung der Literatur, der Sprache und des Theaters im 16. und 17. Jahrhundert, wobei er auf die Themen des „conceptismo“ und „culteranismo“ eingeht. Der Abschnitt beleuchtet auch die patriarchalische Struktur und die Liebesphilosophie des Zeitalters sowie die Verwendung der Schein-Sein-Antithetik als stilistisches Mittel.
- El desdeñado más firme: Dieser Abschnitt analysiert Leonor de Meneses' Novelle „El desdeñado más firme“. Es werden der Aufbau und der Inhalt des Kurzromans sowie die Figuren und ihre Interaktionen beleuchtet. Der Abschnitt widmet sich den Genderkonstruktionen und der idealistischen Liebeskonzeption in der Novelle sowie der Verwendung von Täuschung als stilistischem Mittel.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: spanisches Barock, Geschlechterkonstruktion, Leonor de Meneses, „El desdeñado más firme“, neuplatonisches Liebeskonzept, „engaño“, „desengaño“, Figurenanalyse, Siglo de Oro.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "El desdeñado más firme"?
Der Kurzroman von Leonor de Meneses thematisiert Geschlechterrollen und das neuplatonische Liebeskonzept im spanischen Siglo de Oro.
Wie werden Frauenfiguren bei Meneses dargestellt?
Meneses verleiht ihren Frauenfiguren, wie Lisis de Toledo, einen eigenen Willen und bricht damit die patriarchalischen Verhaltensnormen auf.
Was bedeutet "engaño" und "desengaño"?
Es beschreibt das barocke Spannungsfeld zwischen Schein (Täuschung) und Sein (Enttäuschung/Erkenntnis) in der höfischen Gesellschaft.
Was ist das neuplatonische Liebeskonzept?
Eine idealisierte Form der Liebe, die auf geistiger Vollkommenheit basiert und oft mit strengen Ehrenkodizes verknüpft war.
Was ist das Besondere am Siglo de Oro?
Es war das "Goldene Zeitalter" Spaniens, geprägt von einer kulturellen Blüte in Literatur, Theater und Kunst trotz starrer sozialer Strukturen.
- Quote paper
- Madleen Slezak (Author), 2021, Starke Frauen, verführerische Männer. Genderkonstruktionen, idealistische Liebe und Täuschungen in Leonor de Meneses‘ "El desdeñado más firme", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169956