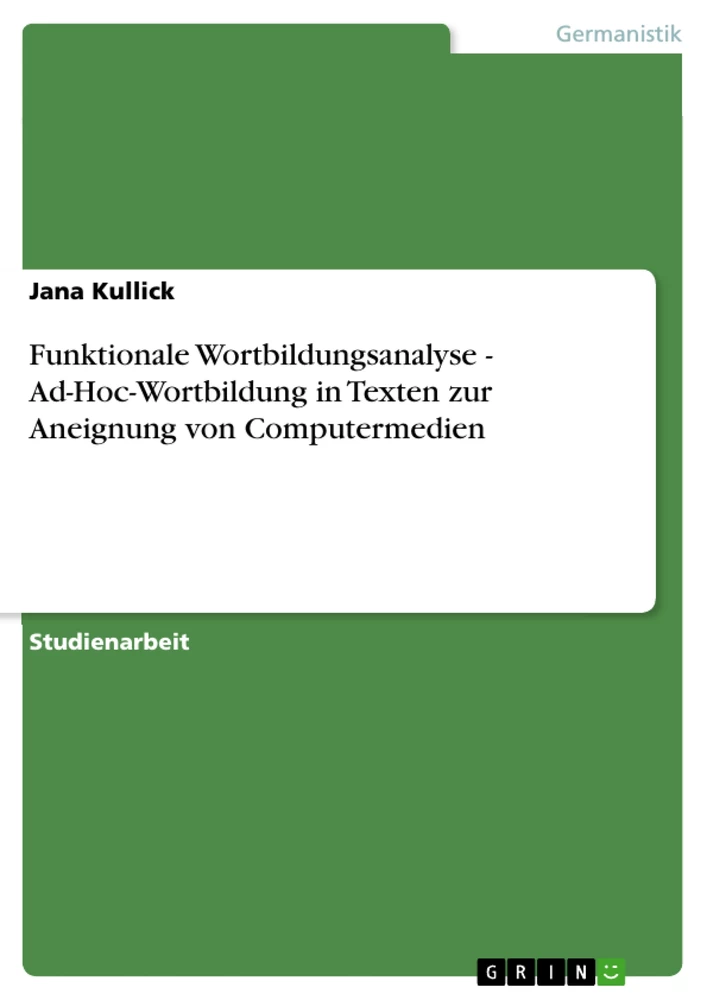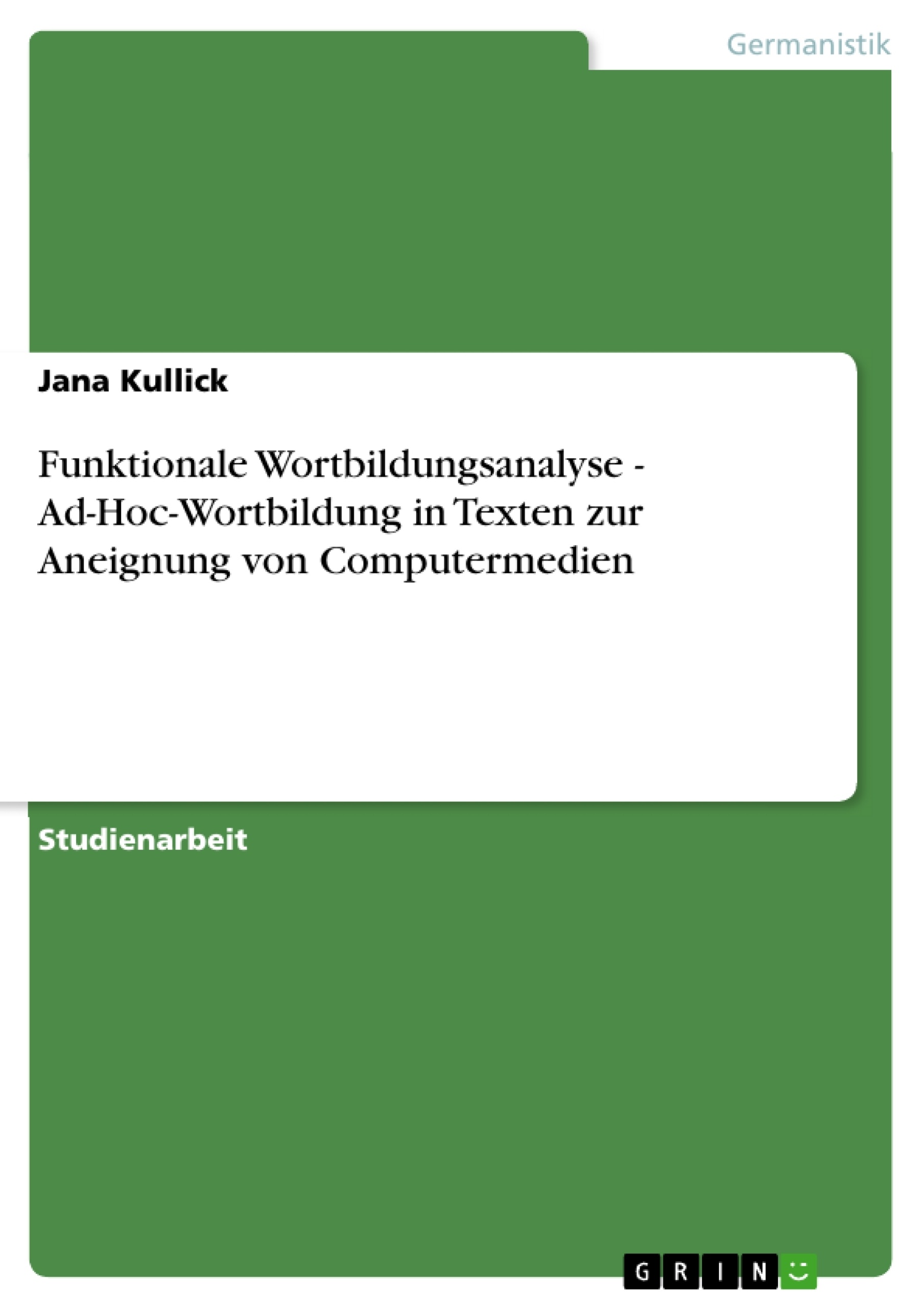Wortbildungen können zum einen danach analysiert werden, nach welchen Regularitäten bereits lexikalisierte Wortbildungsprodukte gebildet wurden. Zum anderen besteht aber auch die Möglichkeit, Wortneubildungen als nicht lexikalisierte Einheiten im Text zu untersuchen. Dies hat den Vorteil, textspezifische Wortbildungsverfahren, die sonst durch den Prozeß der Lexikalisierung bereits verblaßt sind, anhand der semantischen Strukturen im Vor- oder Nachtext verdeutlichen zu können und auf ihre kommunikativen Funktionen zu hinterfragen. Dies ist nach MATUSSEK (1994, 13) in Abgrenzung zur strukturellen Beschreibung (bzw. als Ergänzung zu dieser) von Wortbildung zu betrachten. Die Wortbildungsanalyse bereits lexikalisierter Lexeme in Texten ist aus dieser (funktionalen) Perspektive demnach lediglich als ein Phänomen der "Wort-Wahl" und nicht der "Wort-Bildung" (HOHENHAUS 1996, 259) beschreibbar.
Wortneubildungen (im Text) sind allerdings im Gegensatz zu der eher ko- und kontextfreien Betrachtung lexikalisierter WBK nur im Zusammenhang zur sonstigen Diskursorganisation angemessen zu beschreiben, da sie in deren Strukturen eingebettet sind:
"Wortneubildungen sind (…) Produkte eines Sprechers oder Schreibers, der sich damit an die Adresse eines Hörers oder Lesers richtet. Der Sprecher macht sich dabei dem Hörer nur dann verständlich, wenn er sich im Akt der individuellen Wortneubildung an die Bauelemente und Baugesetze hält, die in der Sprachgemeinschaft kollektiv verwendet werden" (MATUSSEK 1994, 9).
Und "damit der Bildungsprozeß nachvollzogen werden kann, [müssen] diese Wortneubildungen im Zusammenhang mit ihrem Entstehungskontext behandelt [werden], da der Verlauf des Textprozesses belegbaren Aufschluß über den Bildungsprozeß eines neuen komplexen Lexems geben kann" (Matussek 1994, 32).
Neben der besonderen Berücksichtigung des diskurs-strukturellen Zusammenhangs, ist aus semantisch-konzeptueller Perspektive eine Einschränkung der Wortbildungsanalyse auf den ersten Ableitungsschritt vom Basislexem zur erweiterten Bildung notwendig (vgl. RICKHEIT 1993, 46). Dies hat seine Ursache in der Interferenz lexikalischer und struktureller (morphologischer) Wortbildungsprozesse. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Struktureller vs. Funktionaler Zugriff ...
- Das Material….......
- Allgemeine Tendenzen der WNB im Kontext von Computermedien......
- Spezifizierende Klassifikation zur Herstellung 'eindeutiger' Referenz.........
- Anaphorische Pronominalisierung
- Kataphorische Pronominalisierung
- Visuelle Pronominalisierung
- Zusammenfassung
- Benennung mittels Analogie, Metapher und 'Platzhalter' ...
- Funktions-analoge Übertragungen
- Metaphern…......
- 'Platzhalter' und Wortfindungsprozesse
- Zusammenfassung mittels 'Dummy-compounds'
- Zusammenfassung..
- Transkriptsiglen...
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die funktionalen Aspekte der Ad-hoc-Wortbildung in Texten, die sich mit der Aneignung von Computermedien befassen. Sie geht davon aus, dass Wortneubildungen in Texten nicht nur als lexikalisierte Einheiten, sondern auch als text-spezifische Bildungen mit kommunikativen Funktionen betrachtet werden sollten. Die Arbeit konzentriert sich auf die semantischen Strukturen und den Entstehungskontext der Wortneubildungen im Text.
- Analyse der Ad-hoc-Wortbildung im Kontext der Computermedien-Aneignung
- Untersuchung der semantischen Strukturen von Wortneubildungen im Text
- Bedeutung des Entstehungskontexts für die Interpretation von Wortneubildungen
- Abgrenzung der funktionalen Wortbildungsanalyse von der strukturellen Analyse
- Anwendung von Wortbildungsanalyse auf die Beschreibung von Texten
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel 1 stellt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die strukturelle und die funktionale Wortbildungsanalyse gegenüberstellt. Es argumentiert, dass die funktionale Perspektive die text-spezifischen Aspekte von Wortneubildungen besser erfassen kann.
- Kapitel 2 beschreibt das verwendete Material, welches aus Texten zur Aneignung von Computermedien besteht.
- In Kapitel 3 werden allgemeine Tendenzen der Wortneubildung in Texten zur Computermedien-Aneignung beleuchtet.
- Kapitel 4 fokussiert auf die spezifizierende Klassifikation von Wortneubildungen, die zur Herstellung eindeutiger Referenzen beitragen. Es analysiert verschiedene Formen der Pronominalisierung, wie anaphorische, kataphorische und visuelle Pronominalisierung.
- Kapitel 5 untersucht die Benennung von Begriffen mittels Analogie, Metapher und 'Platzhaltern'. Es analysiert die Funktions-analogen Übertragungen, Metaphern und Wortfindungsprozesse im Kontext von Wortneubildungen.
- Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Zusammenfassung von Begriffen durch die Verwendung von 'Dummy-compounds'.
Schlüsselwörter
Ad-hoc-Wortbildung, funktionale Wortbildungsanalyse, Computermedien-Aneignung, Textanalyse, semantische Strukturen, Entstehungskontext, Pronominalisierung, Analogie, Metapher, 'Platzhalter', 'Dummy-compounds', lexikalische Einheiten, text-spezifische Bildungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Ad-hoc-Wortbildung?
Es handelt sich um Wortneubildungen, die spontan im Text entstehen, um spezifische kommunikative Lücken zu füllen, und die noch nicht im Wortschatz (Lexikon) fest verankert sind.
Warum ist der Kontext für Wortneubildungen so wichtig?
Da Ad-hoc-Bildungen nicht lexikalisiert sind, ergibt sich ihre Bedeutung erst aus den semantischen Strukturen im Vor- oder Nachtext des Sprechers.
In welchem Bereich wurde die Wortbildung untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf Texte zur Aneignung von Computermedien, wo oft neue Begriffe für technische Funktionen geschaffen werden müssen.
Was sind „Dummy-compounds“?
Das sind zusammengesetzte Wörter, die als Platzhalter dienen, um komplexe Sachverhalte im Textfluss kurz zusammenzufassen.
Wie unterscheiden sich strukturelle und funktionale Wortbildungsanalyse?
Die strukturelle Analyse schaut auf Bildungsgesetze, während die funktionale Analyse die kommunikative Rolle der Neubildung im Diskurs betrachtet.
- Citation du texte
- Jana Kullick (Auteur), 1998, Funktionale Wortbildungsanalyse - Ad-Hoc-Wortbildung in Texten zur Aneignung von Computermedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11701