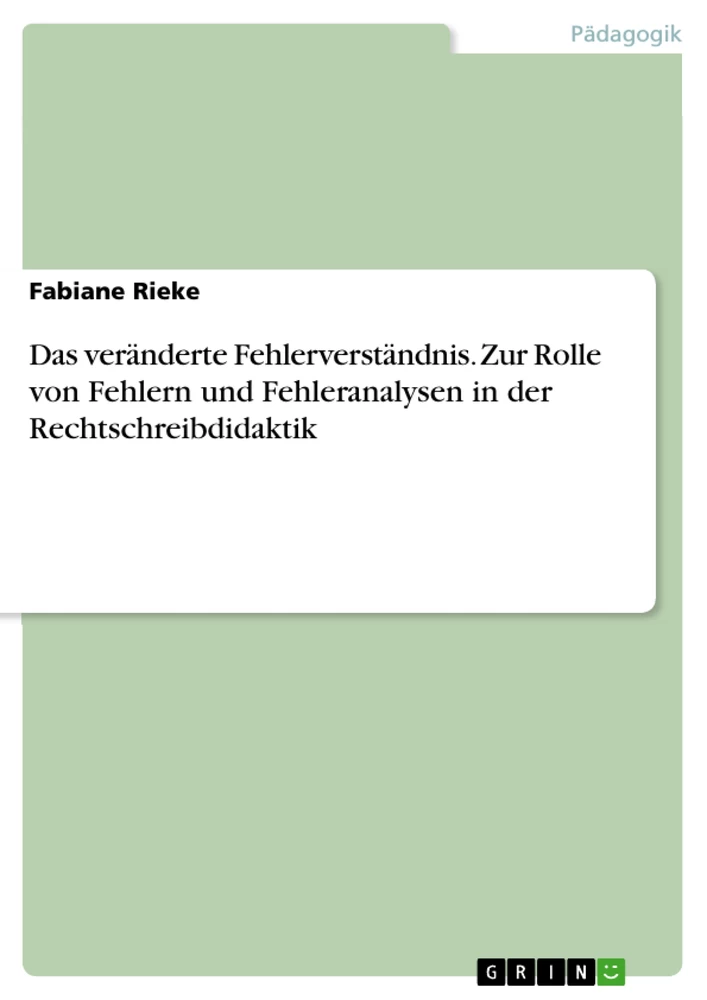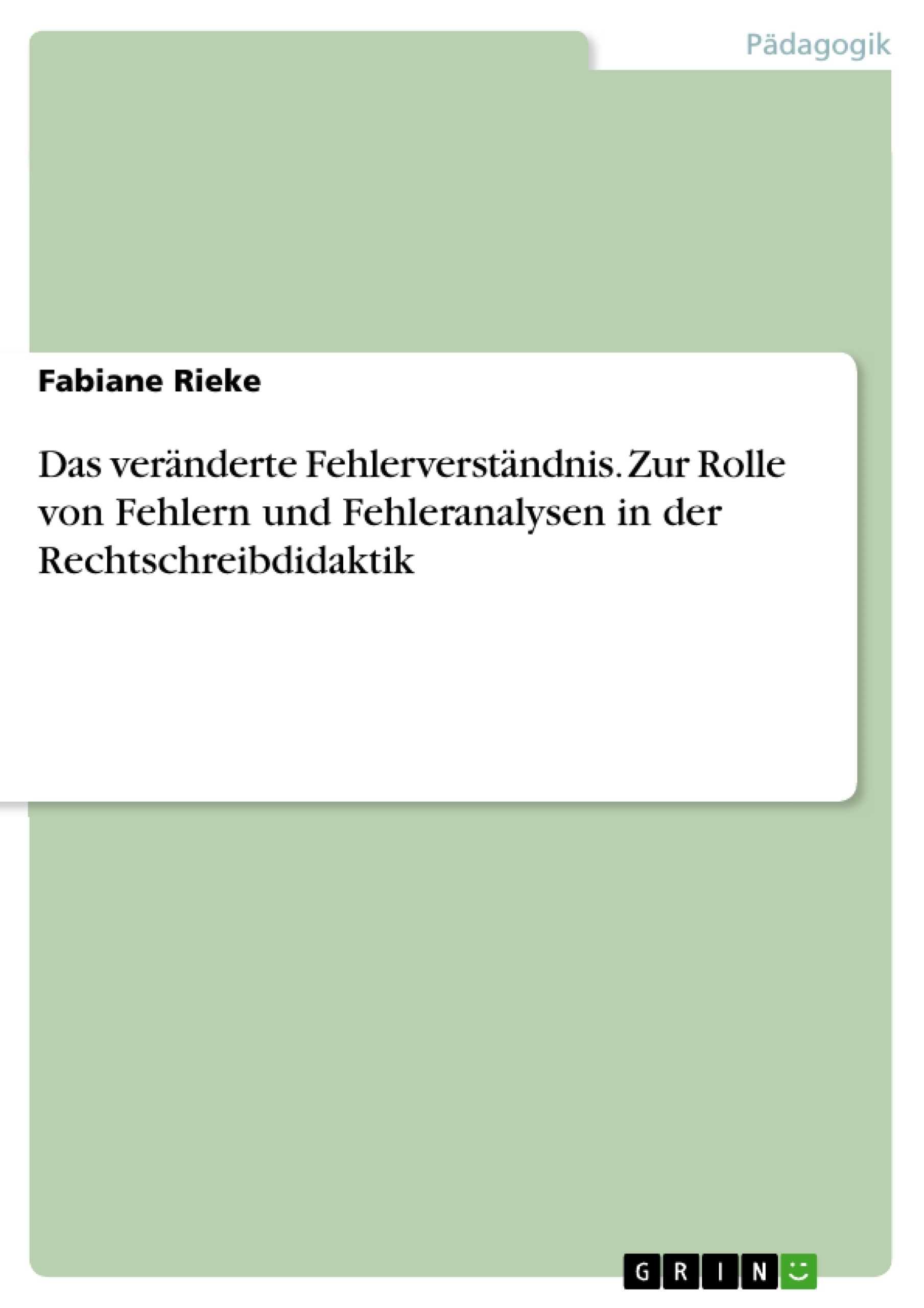Im 16. Jahrhundert diente die Orthographie der Schrift primär dazu, dem „einfaltigen leyen” Lesbarkeit und Verständnis zu erleichtern. Dabei wurden Abweichungen von den festgesetzten Normen als „Gewohnheitsschreibungen” akzeptiert, da das Kriterium der Lesbarkeit, welches überflüssige Zierde der Schrift ausschloss, als wichtiger angesehen wurde. Dennoch entwickelte sich schon relativ früh ein Prestigedenken. Auch wenn der Begriff „Fehler” noch nicht verwendet wurde, wurde dem „unrechten schreybe[r]” nachgesagt, dass er bei Missachtung der Orthographie den Brief verderbe und seinen geringen Bildungsstand preisgebe.
Diese angedeutete, negative Einstellung gegenüber Fehlern wurde im 18. Jahrhundert erneut forciert. Dadurch, dass die Normierung von Rechtschreibung anstieg, folgte auch ein Wachstum von Missgunst gegenüber Schreibungen, die der Orthographie widersprachen. Der Begriff des „Fehlers” fand sehr häufig seine Verwendung als „Delikt”, welches der „Delinquet” vorsätzlich verursachte. Demnach waren Fehler nicht nur Indikator für eine Schwäche im Charakter, sondern vor allem für rückständige Intelligenz.
Inhaltsverzeichnis
- Der historische Wandel des Fehlerverständnisses
- Die Hambuger Schreibprobe- ein standardisierter Test
- Rüdiger Urbaneks nichtstandadisierte Form zur Einschätzung der Rechtschreibkompetenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Fehlerverständnisses in der Rechtschreibdidaktik und beleuchtet, wie sich dieses Verständnis auf die Bewertung und Förderung von Rechtschreibkompetenzen auswirkt. Darüber hinaus wird gezeigt, wie standardisierte und nicht-standardisierte Tests die Rolle von Fehlern in der Analyse von Rechtschreibkompetenzen neu definieren.
- Historische Entwicklung des Fehlerverständnisses
- Die Rolle von Fehlern im Schriftspracherwerb
- Standardisierte und nicht-standardisierte Tests zur Rechtschreibdiagnostik
- Qualitative vs. quantitative Fehleranalyse
- Entwicklungsorientierte Sichtweise auf Fehler
Zusammenfassung der Kapitel
1 Der historische Wandel des Fehlerverständnisses
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Fehlerverständnisses in der Rechtschreibdidaktik. Es zeigt, wie sich die Einstellung gegenüber Fehlern von einer primär negativen, moralischen Bewertung hin zu einer positiven, lernfördernden Perspektive gewandelt hat. Die Arbeit verfolgt dabei die verschiedenen Stadien der Entwicklung von der traditionellen Fehlervermeidung bis hin zu modernen Konzepten, die Fehler als notwendige Bestandteile des Lernprozesses begreifen.
2 Die Hambuger Schreibprobe- ein standardisierter Test
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Hamburger Schreibprobe (HSP), einem standardisierten Test zur Fehleranalyse in der Rechtschreibdidaktik. Der Test fokussiert auf die Erfassung der strategischen Kompetenz der Kinder und stellt Fehler nicht als Defizite, sondern als Ausdruck des Lernprozesses dar. Es wird erläutert, wie die HSP die individuellen Lernfortschritte der Kinder erfasst und Fördermaßnahmen ableitet.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Fehlerverständnis, Rechtschreibdidaktik, Fehleranalyse, Hamburger Schreibprobe, standardisierte Tests, nicht-standardisierte Tests, Lernprozess, Strategische Kompetenz, Entwicklungsorientiertes Lernen.
Häufig gestellte Fragen zur Rechtschreibdidaktik
Wie hat sich das Verständnis von Rechtschreibfehlern historisch gewandelt?
Fehler wandelten sich von einer moralischen Verurteilung im 18. Jahrhundert hin zu einer modernen Sichtweise, die Fehler als notwendige Schritte im Lernprozess begreift.
Was ist die Hamburger Schreibprobe (HSP)?
Die HSP ist ein standardisierter Test zur Analyse der Rechtschreibstrategien von Kindern, der individuelle Lernfortschritte statt reiner Defizite misst.
Was unterscheidet qualitative von quantitativer Fehleranalyse?
Die quantitative Analyse zählt die Anzahl der Fehler, während die qualitative Analyse untersucht, welche Rechtschreibstrategien das Kind bereits anwendet.
Was bedeutet eine „entwicklungsorientierte Sichtweise“ auf Fehler?
Fehler werden als Indikatoren dafür gesehen, auf welcher Stufe des Schriftspracherwerbs sich ein Schüler befindet.
Warum ist die Normierung der Rechtschreibung didaktisch relevant?
Die Normierung setzt den Rahmen für die Bewertung, aber die Didaktik muss zwischen dem Ziel der Norm und dem individuellen Lernprozess vermitteln.
- Citar trabajo
- Fabiane Rieke (Autor), 2012, Das veränderte Fehlerverständnis. Zur Rolle von Fehlern und Fehleranalysen in der Rechtschreibdidaktik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170508