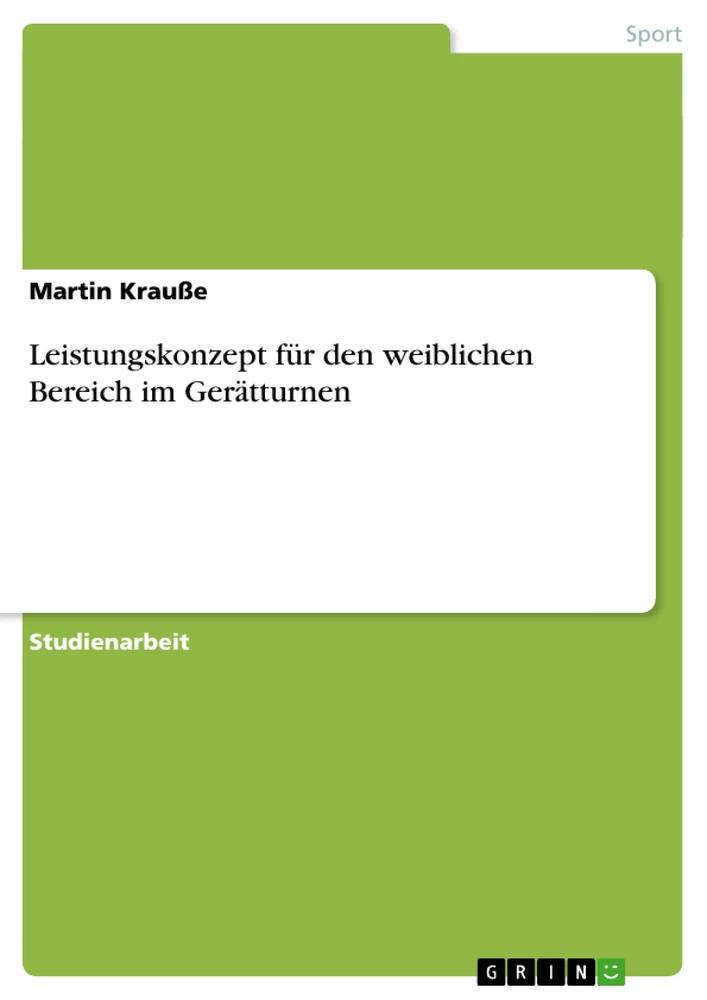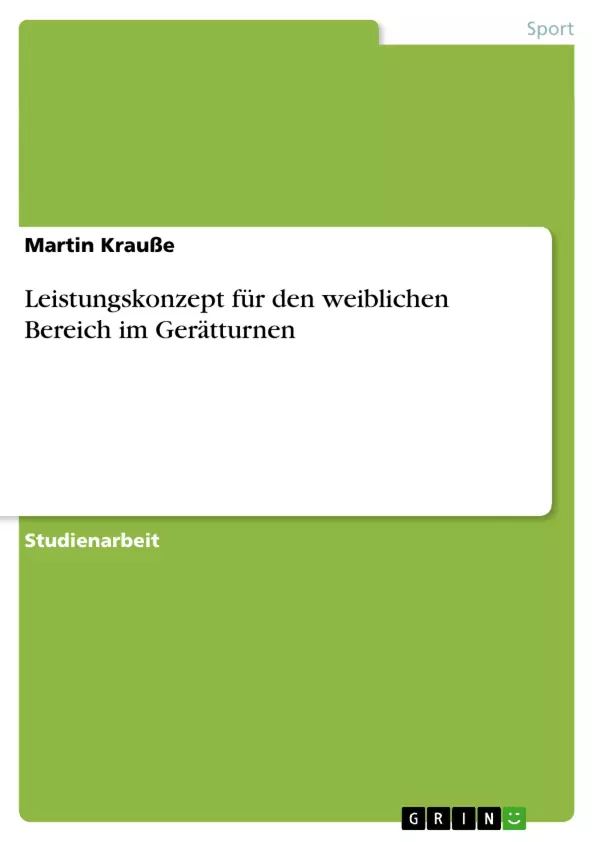In der internationalen Anschluss- und Spitzenleistung des Gerätturnens wird immer mehr auf einwandfreie Technik, saubere, ästhetische Ausführung und eine Anhebung des Schwierigkeitsgrades Wert gelegt (vgl. S. 3, Rahmentrai-ningskonzeption Gerätturnen weiblich 2007).
Das vorliegende Trainingskonzept vermittelt das Anforderungsprofil und die
Trainingsplanung im Bereich Gerätturnen weiblich. Es zeigt den Aufbau einer kontinuierlich stabilen Leistungsschiene vom Anfängerbereich bis zum Hoch-leistungstraining.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Körperliches Anforderungsprofil
2.1. Allgemeine körperliche Merkmale
2.2. Turnspezifische Merkmale
3. Anforderungsprofil
3.1. Kraft
3.2. Schnelligkeit
3.3. Beweglichkeit
3.4. Ausdauer
4. Trainingsplanung
4.1. Anfängerprogramm, Grundausbildung, Grundlagentraining
4.2. Aufbautraining
4.3. Anschlusstraining
5. Zusammenfassung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der internationalen Anschluss- und Spitzenleistung des Gerätturnens wird immer mehr auf einwandfreie Technik, saubere, ästhetische Ausführung und eine Anhebung des Schwierigkeitsgrades Wert gelegt (vgl. S. 3, Rahmentrainingskonzeption Gerätturnen weiblich 2007).
Das vorliegende Trainingskonzept vermittelt das Anforderungsprofil und die
Trainingsplanung im Bereich Gerätturnen weiblich. Es zeigt den Aufbau einer kontinuierlich stabilen Leistungsschiene vom Anfängerbereich bis zum Hochleistungstraining.
Die Basis dieses Konzeptes bildet der Rahmentrainingsplan Gerätturnen weiblich des Deutschen Turnbundes. Zielsetzung ist die Bereitstellung eines Leitfadens zu einer systematischen Förderung des Nachwuchses bis zum Erreichen der internationalen Anschluss- und Spitzenleistung. Hierbei werden grundlegende Aussagen zum Anforderungsprofil in den Bereichen Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer getroffen. Grundlage für das Erreichen der Zielsetzung ist die Gegebenheit der erläuterten körperlichen und turnspezifischen Merkmale. In der Trainingsplanung wird auf den kontinuierlichen Aufbau der Anforderungen eingegangen.
2. Körperliches Anforderungsprofil
2.1. Allgemeine körperliche Merkmale
Neben gesundheitlichen und intellektuellen Aspekten spielen die Körperbaumerkmale eine wesentliche Rolle bei der Eignungserkennung. Die hier vorgeschlagenen Kennziffern sind eine Orientierung und basieren auf dem Rahmentrainingsplan des Deutschen Turnbundes.
Körperbaumerkmale (Physiognomie):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(vgl. Tabelle S. 14, Rahmentrainingskonzeption Gerätturnen weiblich 2007)
Von diesen Orientierungskennziffern können Abweichungen auftreten. Hierbei sollte der motorische Gesamteindruck und die allgemeine Leistungsfähigkeit der Auswahlentscheidung zu Grunde gelegt werden.
Es ist neben den Körperbaumerkmalen auch auf die Körperhaltung und Stellung der Extremitäten zu achten. Erforderliche Merkmalsausprägungen sind eine flache S-Form der Wirbelsäule und eine straffe Bauchdecke. Die Schultern müssen breiter sein als das Becken. Der Oberkörper sollte keine Brustkorbveränderung besitzen und einen graden achsengerechten Rücken. Die Beine sollten gerade und schlank und das Fußgewölbe normal ausgeprägt sein. Knie und Füße müssen mit Unterstützung gestreckt werden können. Es dürfen hier keine deutlich nicht korrigierbaren Mängel in der Knie- beziehungsweise Fußgelenkstreckung erkennbar sein (vgl. S. 14, Rahmentrainingskonzeption Gerätturnen weiblich 2007).
2.2. Turnspezifische Merkmale
Allgemeine koordinative und konditionelle Voraussetzungen sollten gegeben sein. Für die Umsetzung der Ausbildungsinhalte ist eine gute motorische Lernfähigkeit erforderlich. Die Turner sollten Mut und Risikobereitschaft zeigen und über einen hohen Grad an Belastbarkeit verfügen.
Die Turnspezifischen Merkmale sollten immer unter Beachtung individueller Besonderheiten, wie biologisches Alter oder Trainingsalter erschlossen werden.
(vgl. S. 15, Rahmentrainingskonzeption Gerätturnen weiblich 2007)
3. Anforderungsprofil
3.1. Kraft
Kraft im Sport ist die Fähigkeit des Nerv – Muskelsystems, durch Innervations– und Stoffwechselprozesse mit Muskelkontraktionen Wiederstände zu überwinden, ihnen entgegenzuwirken beziehungsweise sie zu halten (vgl. S. 40, Grosser/Starischka/Zimmermann 2008).
Für das Turnen ist die Kraftsituation der Schwerkraft und dem eigenen Körpergewicht entgegenzuwirken von größerer Bedeutung, wie beispielsweise dem Winkelstütz. Ebenfalls soll die eigene Körpermasse beim Sprung beschleunigt werden können. Das Ziel der Krafttrainingsmaßnahmen sollte es sein, eine hohe Ausprägung der Maximalkraft, Schnellkraft und Reaktivkraft zu erreichen. Es ist wichtig, Bewegungen in möglichst kurzer Zeit durchführen zu können. Dabei muss willkürlich die höchstmögliche Kraft gegen einen unüberwindbaren Widerstand aufgebracht werden können. Um in kurzer Zeit möglichst große Impulse zu erzeugen, wird die Schnellkraft benötigt. Bei Bewegungsformen, bei denen nach Niedersprüngen der Boden schnell verlassen werden muss, durch einen Prellabsprung, tritt der sogenannte Dehnungs- Verkürzungs- Zyklus auf. Die gute Ausprägung der Reaktivkraft ist erforderlich, um die häufig auftretenden Reaktivbewegungen effizient auszuführen.
3.2. Schnelligkeit
Allgemein versteht man unter dem in der Sportpraxis gewachsenem Begriff Schnelligkeit die Fähigkeit, auf Grund kognitiver Prozesse, maximaler Willenskraft und der Funktionalität des Nerv- Muskel- Systems höchstmögliche Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeit, vorwiegend gegen geringe Widerstände zu erzielen (vgl. S. 87, Grosser/Starischka/Zimmermann 2008).
Die verschiedenen Formen der Schnelligkeit sind abhängig vom zentralen Nervensystem, der Stiffness, der Reaktivkraft, einem genetisch hohen Anteil an schnellzuckenden Muskelfasern und einer hochausgeprägten Bewegungskoordination sowie Rhythmusgefühl als Voraussetzung.
Für das Gerätturnen ist besonders die Form der Kraftschnelligkeit und Sprintkraft erforderlich. Beispielweise Beschleunigungsbewegungen beim Sprung, welche mit einem Antritt zu vergleichen sind, erfordern diese Form der Schnelligkeit. Diese „komplexe“ Schnelligkeitsform ist eine kombinierte Funktion aus den Bedingungen der elementaren Schnelligkeit, der Kraft und der spezifischen Ausdauer. Außerdem besteht eine Abhängigkeit von der
„Fähigkeit des Sportlers, seine Bewegungen in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen, unter denen die motorische Aufgabe gelöst wird, rationell zu koordinieren“.
(Werchoschanski 1988, S. 89, zitiert in Grosser/Starischka/Zimmermann 2008)
[...]
- Quote paper
- Martin Krauße (Author), 2008, Leistungskonzept für den weiblichen Bereich im Gerätturnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117054