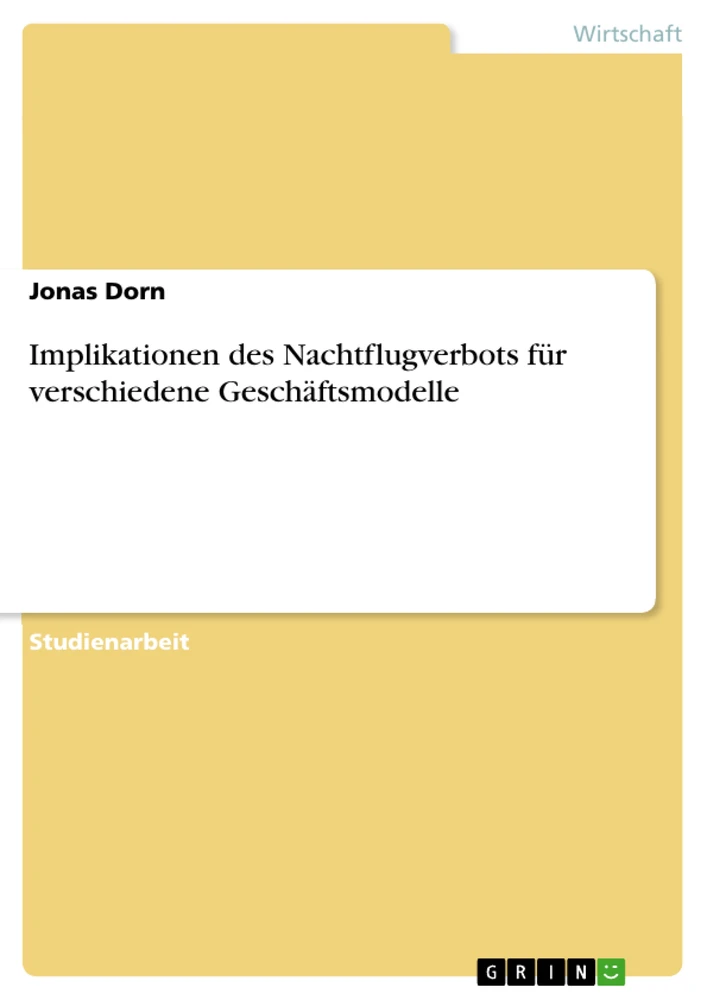Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Bedeutung des Nachtflugverbots für ganz bestimmte Typen von Fluggesellschaften zu untersuchen. Untersucht wurden die ökonomischen, ökologischen und politischen Auswirkungen auf zwei Typen von Luftfrachtunternehmen, nämlich die sogenannten Low Cost Carrier am Beispiel der Ryanair Holdings, und die sogenannten Network Carrier am Beispiel der deutschen Lufthansa AG.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Begriffsklärungen
- 1.3 Forschungsstand
- 2. Das Geschäftsmodell der Network-Carrier am Beispiel der Lufthansa AG
- 2.1 Passagierverkehr
- 2.2 Frachtverkehr
- 3. Entwicklung und Organisation von Ryanair
- 4. Auswirkungen eines Nachtflugverbotes für beide Geschäftsmodelle
- 4.1 Auswirkungen für die Lufthansa AG
- 4.1.1 Ökonomische Auswirkungen
- 4.1.2 Ökologische Auswirkungen
- 4.1.3 Politische Auswirkungen
- 4.2 Auswirkungen auf die Ryanair Holdings PLC
- 4.2.1 Ökonomische Auswirkungen
- 4.2.2 Ökologische Auswirkungen
- 4.2.3 Politische Auswirkungen
- 5. Zwischenfazit
- 5.1 Gegenüberstellung der Auswirkungen
- 5.2 Mögliche Lösungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den ökonomischen, ökologischen und politischen Auswirkungen eines Nachtflugverbots auf Fluggesellschaften. Insbesondere untersucht sie die Unterschiede in den Auswirkungen auf Network-Carrier und Low-Cost-Carrier am Beispiel der Lufthansa AG und Ryanair Holdings. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung von Nachtflugverboten für die Luftfahrtbranche zu gewinnen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Das Geschäftsmodell von Network-Carrier und Low-Cost-Carrier
- Ökonomische Auswirkungen von Nachtflugverboten
- Ökologische Auswirkungen von Nachtflugverboten
- Politische Auswirkungen von Nachtflugverboten
- Mögliche Lösungsansätze für die Herausforderungen von Nachtflugverboten
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit dargelegt. Es werden die wichtigsten Begriffe, wie Nachtflugverbot, Network Carrier und Low-Cost-Carrier, definiert und der aktuelle Forschungsstand zum Thema Nachtflugverbote beleuchtet.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Geschäftsmodell von Network-Carrier am Beispiel der Lufthansa AG. Es wird die strategische Positionierung der Lufthansa AG als Network-Carrier erläutert, die sich durch ein end-to-end-Transportangebot und einen Fokus auf Qualität auszeichnet.
Im dritten Kapitel wird die Entwicklung und Organisation von Ryanair vorgestellt. Ryanair ist ein typischer Vertreter von Low-Cost-Carrier und setzt auf eine Kostenführerschaftsstrategie, die durch eine starke Fokussierung auf den Flugtransport und die Minimierung von Nebenkosten geprägt ist.
Das vierte Kapitel analysiert die Auswirkungen eines Nachtflugverbots auf die beiden Geschäftsmodelle. Es werden sowohl die ökonomischen, ökologischen als auch politischen Auswirkungen für die Lufthansa AG und Ryanair Holdings untersucht.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und stellt die Unterschiede in den Auswirkungen von Nachtflugverboten auf Network-Carrier und Low-Cost-Carrier heraus. Es werden auch mögliche Lösungsansätze zur Bewältigung der Herausforderungen von Nachtflugverboten diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Nachtflugverbot, Network-Carrier, Low-Cost-Carrier, ökonomische Auswirkungen, ökologische Auswirkungen, politische Auswirkungen und Lösungsansätze. Sie analysiert die Unterschiede in den Auswirkungen von Nachtflugverboten auf die beiden Geschäftsmodelle und untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten im Zusammenhang mit Nachtflugverboten in der Luftfahrtbranche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Untersuchung zum Nachtflugverbot?
Die Arbeit untersucht die ökonomischen, ökologischen und politischen Auswirkungen eines Nachtflugverbots auf verschiedene Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften.
Welche Fluggesellschaften dienen als Beispiele in der Arbeit?
Die Lufthansa AG repräsentiert das Modell der Network-Carrier, während Ryanair Holdings PLC als Beispiel für Low-Cost-Carrier dient.
Wie wirkt sich ein Nachtflugverbot ökonomisch auf Network-Carrier aus?
Für Network-Carrier wie die Lufthansa sind Nachtflüge besonders für den Frachtverkehr und die effiziente Nutzung von Hub-and-Spoke-Systemen wichtig; ein Verbot kann hier zu hohen Kosten führen.
Welche ökologischen Auswirkungen hat ein Nachtflugverbot?
Die Arbeit analysiert, inwieweit ein Verbot zur Lärmreduktion und Entlastung der Anwohner beiträgt, aber auch, ob es zu einer Verlagerung von Emissionen führt.
Was unterscheidet das Geschäftsmodell von Ryanair von dem der Lufthansa?
Ryanair setzt auf Kostenführerschaft und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, während die Lufthansa als Network-Carrier auf Qualität und ein umfassendes globales Streckennetz über Drehkreuze setzt.
Gibt es Lösungsansätze für die Herausforderungen durch Nachtflugverbote?
Die Arbeit diskutiert mögliche Lösungsansätze, um den Schutz der Bevölkerung mit den wirtschaftlichen Interessen der Luftfahrtbranche in Einklang zu bringen.
- Citation du texte
- Jonas Dorn (Auteur), 2011, Implikationen des Nachtflugverbots für verschiedene Geschäftsmodelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170767