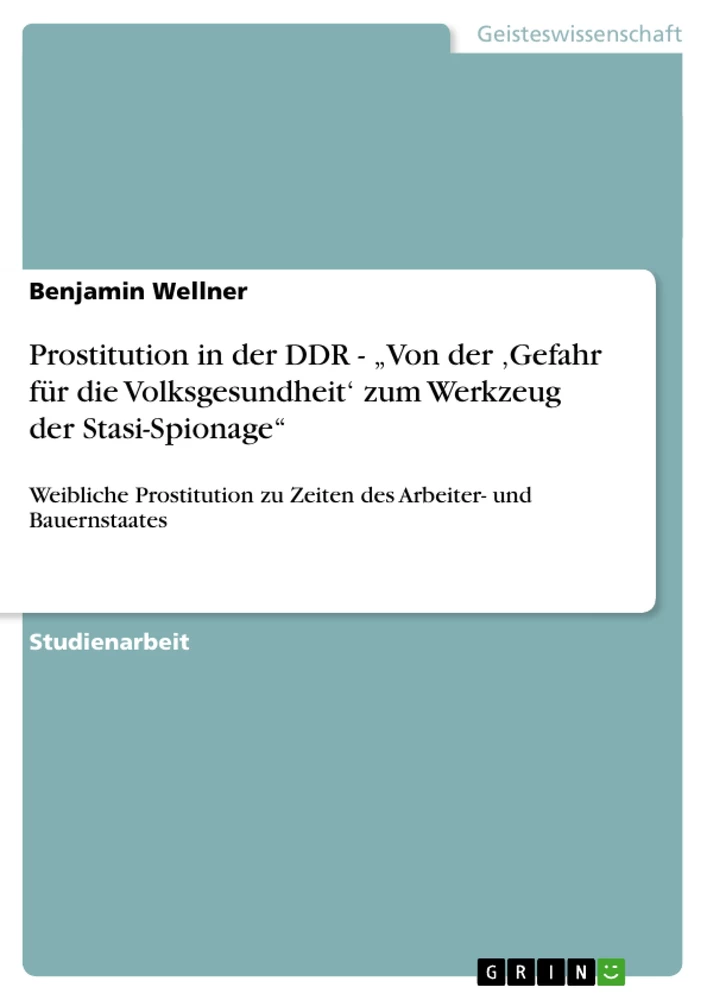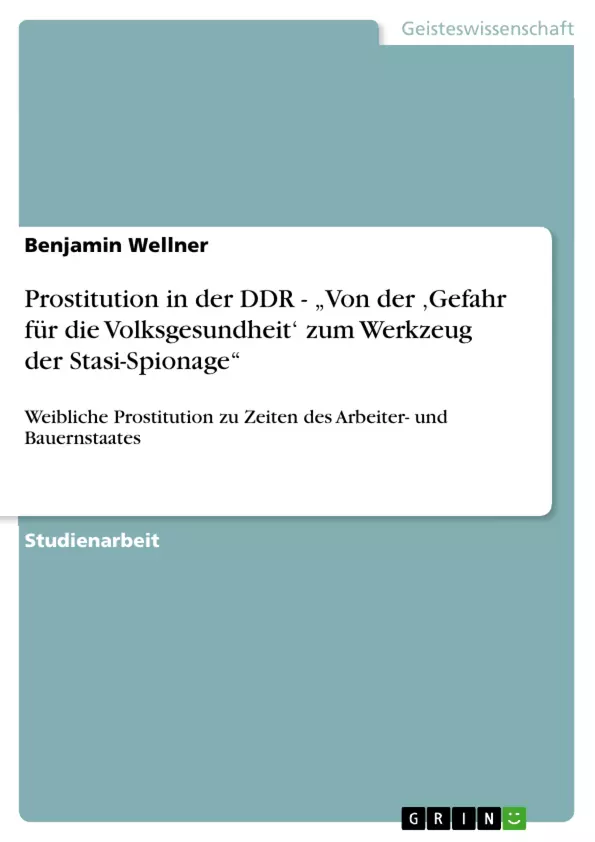Prostitution wird seit ewigen Zeiten als das „älteste Gewerbe der Zeit“ bezeichnet. Durch
jede Form von gesellschaftlichem Zusammenlebens zog sich das Phänomen „käufliche
Liebe“. Auch im durchgeplanten System der ehemaligen DDR gab es Bedarf an
weiblichen Prostituierten. In der Nachkriegszeit nicht vordergründig moralisch
behandelt, änderten sich für sie die Umstände grundlegend mit der Einführung des
neuen Strafgesetzbuches 1968 in DDR. Fortan galten die Freudenmädchen strafrechtlich
als arbeitsscheu und gingen ihrer eigentlichen Bestimmung - arbeitstätig und Mutter zu
sein - nicht nach. Auch das Strafmaß erhöhte sich enorm, womit sich der Staat erhoffte,
Prostitution allmählich aus dem Bild der Öffentlichkeit entrücken zu können. Die
Erwartung, das Phänomen der »leichten Mädchen« würde in der DDR bald aussterben1,
wurde jedoch nicht erfüllt. Zwar reduzierte sich die Medienberichterstattung auf ein
Minimum, jedoch gingen die meisten Prostituierten ihrer Tätigkeit in einem heimlicheren
Rahmen weiterhin nach.
Mit Beginn der 70er Jahre wurden dann zunehmend junge Frauen vom „Ministerium für
Staatssicherheit“ (MfS) angeworben. Ihre Aufgabe: Intimbeziehungen zu Personen aus
dem „Nichtsozialistischen Ausland“ herzustellen und damit in Kenntnis wichtiger
Informationen und intimer Details zu gelangen.
Bis zum Ende der DDR entwickelte sich die Prostitution weiter und es etablierten sich
„Hochburgen“ wie Leipzig, Rostock oder Ost-Berlin.
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der DDR-Prostitution und den problematischen
Umstand, dass sie in der DDR 1968 zwar strafrechtlich verboten, dennoch über die
gesamte Existenz der Deutschen Demokratischen Republik hinweg vom „Ministerium für
Sicherheit“ als Mittel der Spionage eingesetzt wurde.
Auf theoretischer Grundlage August Bebels basierend, soll auch die Stellung der
Prostitution in der sozialistischen Gesellschaft zur Antwortfindung einbezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Problemaufriss
- 1.2 Zentrale Fragestellung
- 2. GRUNDLAGEN
- 2.1 Begriffsdefinition „Prostitution“
- 2.2 Das Frauenbild in der DDR
- 3. PROSTITUTION IN DER DDR
- 3.1 Die weibliche Prostitution im Sozialismus (August Bebel)
- 3.2 Die Gesetzeslage zur Prostitution in der DDR
- 3.2.1 Bis 1968
- 3.2.2 Ab 1968
- 3.3 Zugänge für Frauen zur Prostitution in der DDR
- 3.4 Das „Lustgewerbe“ in der DDR von der Nachkriegszeit bis zum Ende der '80er Jahre
- 3.4.1 Die Nachkriegszeit - Aspekt „Existenzsicherung“
- 3.4.2 Die 1950er – Aspekt „Arbeitsintegration“
- 3.4.3 Die 1960er - Aspekt „Luxus und Strafgesetz“
- 3.4.4 Die 1970er – Aspekt „Informationsbeschaffung“
- 3.4.5 Die 1980er - Aspekt „Leipziger Messe und Rostocker Storchenbar“
- 4. SCHLUSSFOLGERUNG
- 5. ZUSAMMENFASSUNG
- 6. QUELLENVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung und die Rolle der weiblichen Prostitution in der DDR, insbesondere im Kontext des sozialistischen Frauenbildes und der staatlichen Repression. Sie hinterfragt die These August Bebels über die Prostitution als soziale Institution im Vergleich zu den realsozialistischen Gegebenheiten der DDR. Die Arbeit analysiert die Veränderungen der Prostitution über die Jahrzehnte und deren Nutzung durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS).
- Entwicklung der Prostitution in der DDR über verschiedene Jahrzehnte
- Das sozialistische Frauenbild und seine Widersprüche zur Realität der Prostitution
- Die Gesetzeslage zur Prostitution und deren Durchsetzung
- Die instrumentalisierung der Prostitution durch das MfS
- Vergleich der DDR-Realität mit August Bebels Theorie zur Prostitution
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der weiblichen Prostitution in der DDR ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Stellenwert der Prostitution im sozialistischen System in den Mittelpunkt. Sie skizziert den Wandel der Prostitution von der Nachkriegszeit bis zum Ende der DDR, wobei die Nutzung durch das MfS als zentrales Element hervorgehoben wird. Die Arbeit stützt sich auf die theoretische Grundlage August Bebels und untersucht, inwieweit seine These von der Prostitution als notwendiger Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft auf die DDR übertragbar ist.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Prostitution“ und beleuchtet das Frauenbild in der DDR. Es differenziert zwischen der gängigen Definition und der spezifischen Situation in der DDR, wobei „Geschenke-Sex“ als eine verbreitete Form der Prostitution beschrieben wird, die von den Frauen selbst oft nicht als solche definiert wurde. Der zweite Teil behandelt die sozialistische Frauenpolitik der DDR, die auf Gleichstellung und Integration der Frau in den Erwerbssektor abzielte, um eine wirtschaftliche Unabhängigkeit von Männern zu erreichen. Der Widerspruch zwischen diesem Ideal und der Realität der Prostitution wird angedeutet.
3. Prostitution in der DDR: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Prostitution in der DDR, beginnend mit einem historischen Abriss der weiblichen Prostitution im Sozialismus nach August Bebel. Es analysiert die Rechtslage, die sich 1968 grundlegend änderte, und die verschiedenen Wege, auf denen Frauen in die Prostitution gelangten. Die Entwicklung der Prostitution über die Jahrzehnte wird detailliert dargestellt, beginnend mit der Nachkriegszeit, wo Existenzsicherung im Vordergrund stand, über die 1950er Jahre mit dem Fokus auf Arbeitsintegration, die 1960er mit dem Aspekt von Luxus und Strafverfolgung, die 1970er Jahre mit der zunehmenden Nutzung durch das MfS zur Informationsbeschaffung, bis hin zu den 1980er Jahren mit Hochburgen wie Leipzig und Rostock. Der Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und der Veränderung der Prostitution wird hier deutlich.
Schlüsselwörter
Prostitution, DDR, Sozialismus, Frauenbild, Staatssicherheit (MfS), August Bebel, Gesetzeslage, Geschenke-Sex, Informationsbeschaffung, Existenzsicherung, Arbeitsintegration, „Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr“ (HWG).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Prostitution in der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung und Rolle der weiblichen Prostitution in der DDR. Sie analysiert die Prostitution im Kontext des sozialistischen Frauenbildes, staatlicher Repression und der Nutzung durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Ein Vergleich mit August Bebels Theorie zur Prostitution als sozialer Institution bildet einen weiteren Schwerpunkt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Prostitution über die Jahrzehnte, das sozialistische Frauenbild und dessen Widersprüche zur Realität, die Gesetzeslage und deren Durchsetzung, die Instrumentalisierung der Prostitution durch das MfS und einen Vergleich der DDR-Realität mit August Bebels Theorie.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung der Prostitution in der DDR von der Nachkriegszeit bis zum Ende der 1980er Jahre. Die einzelnen Jahrzehnte (1950er, 1960er, 1970er, 1980er) werden jeweils mit spezifischen Aspekten (Existenzsicherung, Arbeitsintegration, Luxus/Strafverfolgung, Informationsbeschaffung etc.) untersucht.
Wie wird der Begriff "Prostitution" definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff "Prostitution" und beleuchtet die spezifischen Gegebenheiten in der DDR, wobei auch der Begriff „Geschenke-Sex“ als eine verbreitete, oft nicht als solche wahrgenommene Form der Prostitution erwähnt wird.
Welche Rolle spielte das sozialistische Frauenbild?
Die Arbeit untersucht den Widerspruch zwischen dem sozialistischen Frauenbild, das auf Gleichstellung und wirtschaftliche Unabhängigkeit abzielte, und der Realität der Prostitution in der DDR.
Welche Rolle spielte das MfS?
Die Arbeit analysiert die Nutzung der Prostitution durch das MfS, insbesondere die Informationsbeschaffung durch die Geheimpolizei im Laufe der Jahrzehnte.
Wie wird August Bebel in die Arbeit eingebunden?
Die Arbeit bezieht sich auf August Bebels Theorie zur Prostitution als sozialer Institution und untersucht, inwieweit seine These auf die Verhältnisse in der DDR übertragbar ist.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit enthält ein Quellenverzeichnis (im HTML nicht explizit aufgeführt, aber implizit durch die Inhaltsangabe angedeutet).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen, ein Kapitel zur Prostitution in der DDR, eine Schlussfolgerung, eine Zusammenfassung und ein Quellenverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prostitution, DDR, Sozialismus, Frauenbild, Staatssicherheit (MfS), August Bebel, Gesetzeslage, Geschenke-Sex, Informationsbeschaffung, Existenzsicherung, Arbeitsintegration, „Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr“ (HWG).
- Citation du texte
- Benjamin Wellner (Auteur), 2008, Prostitution in der DDR - „Von der ‚Gefahr für die Volksgesundheit‘ zum Werkzeug der Stasi-Spionage“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117093